Paul Valérys Gedicht „An die Platane“ ist im Grunde eine tiefe Nachdenklichkeit über das Leben, unsere Grenzen und das, wonach wir uns sehnen. Er nimmt die Platane als Beispiel, um uns etwas über uns selbst zu erzählen.
Am Anfang steht die Platane da, nackt und weiß, wie ein junger Mensch. Aber sie ist nicht ganz frei, denn ihre Wurzeln halten sie fest im Boden, der wie ein strenger Herrscher ist. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Freiheit und Fesseln zieht sich durchs ganze Gedicht. Die Erde, der Schlamm, klebt an ihr – das steht für alles Materielle, was uns im Leben festhält.
Valéry zeigt uns, dass der Baum nicht einfach nur da steht. Obwohl er nicht wandern kann, streckt er sich nach oben, zum Licht, wo die Säfte fließen. Das ist wie unser eigenes Streben nach Wissen, nach Erfüllung oder nach etwas Höherem. Die Platane wird reiner, indem sie sich nach oben streckt, aber sie kann ihre Wurzeln nicht kappen. Das bedeutet, wir können unseren irdischen Dasein nicht entfliehen.
Bäume und Menschen: Alle im selben Boot
Das Gedicht schaut dann auch auf andere Bäume wie Eichen, Kiefern oder Pappeln. Sie alle werden von der Erde oder dem Schicksal gefangen gehalten. Sie sind alle im „Griff der Toten“ und spüren, wie die Zeit vergeht. Das zeigt uns, dass alle Lebewesen das gleiche Schicksal teilen: Wir sind alle vergänglich und können der Zeit nicht entkommen.
Besonders bewegend ist die Beschreibung der Espe und der „vier Frauen im Buchenstamm“, die vergeblich gegen den Himmel anrudern. Sie sind zwar getrennt, aber irgendwie doch vereint in ihrem „Sich-nicht-kennen“. Das deutet auf eine tiefe Einsamkeit hin und darauf, dass unsere Versuche, uns von den irdischen Lasten zu befreien, oft scheitern. Ihre Seelen scheinen gelähmt, und selbst wenn sie abends zu Aphrodite beten (der Göttin der Liebe und Schönheit), empfinden sie Scham und Schrecken.
Die Platane als Künstler und ihr Schmerz
Die Platane wird aber besonders hervorgehoben. Sie ist freier von der groben Materie und ihre Äste strecken sich „ins Gold“ – ins Göttliche oder Schöne. Sie ist wie ein Traumbild am Tag und ein Geheimnis in der Nacht. Die Platane wird hier zum Symbol für Künstler und ihr Werk, das oft aus Leid und Kampf entsteht. Ihr „stolzer Streit“, wenn der Nordwind tost, zeigt die Größe und den Kampf, die zum Schaffen dazugehören.
Valéry fordert die Platane auf, sich zu winden und zu klagen, sich selbst zu geißeln, um den Schmerz zu spüren. Das zeigt, dass Leid und Kampf oft notwendig sind, um Kunst zu schaffen und tiefe Einsichten zu gewinnen. Die Stimme, die die Winde finden sollen, und die Hymne, die zu zukünftigen Vögeln steigen soll, stehen für die ewige Wirkung von Kunst und das, was aus durchlittenem Schaffen entsteht. Die Platane soll träumen, dass sie brennt – also leidenschaftlich für ihre Vision, ihre Reinheit und ihren Ausdruck kämpft.
Die Wahl und das Letzte Wort des Baumes
Der Dichter wählt die Platane aus, weil der Himmel sie so biegt, dass eine „starke Sprache“ aus ihr herauskommt. Die Platane wird zu einem Sprachrohr für etwas Höheres, einem Bogen, der Klänge und Bedeutungen aussendet.
Der Wunsch, dass die Baumnymphe die Platane berührt und der Dichter ihre „Schenkelkraft“ spürt, unterstreicht die Sehnsucht nach einer tiefen, fast körperlichen Verbindung zur Natur und zur Quelle der Inspiration.
Doch am Ende sagt der Baum klar „Nein“. Er sagt, dass der Sturm im All mit ihm genauso umgeht wie mit jedem Grashalm. Dieses „Nein“ ist eine Ablehnung davon, sich selbst zu überhöhen. Es ist eine Demut vor den universellen Gesetzen der Natur und die Anerkennung der eigenen Grenzen. Trotz aller inneren Kämpfe und des Strebens nach etwas Einzigartigem bleibt die Platane am Ende ein Teil des großen Ganzen, dem die gleichen Kräfte begegnen wie jedem anderen Lebewesen.
Kurz gesagt, „An die Platane“ ist ein komplexes Gedicht über die Spannung zwischen dem, was uns auf der Erde festhält, und unserem Wunsch nach etwas Größerem. Es geht um Leid und Kreativität und letztlich darum, unsere Rolle im großen Kreislauf des Lebens anzunehmen.
AN DIE PLATANE | Paul Valery
Geneigt, große Platane, bietest du dich nackt,
weiß, wie ein junger Skythe,
doch deine Reinheit stockt, dein Fuß ist fest gepackt
vom herrischen Gebiete.
Klingender Schatten, drin des gleichen Himmels Blau
sich stillt, das dich erregte,
die schwarze Mutter hält den reinen Fuß genau,
auf den der Schlamm sich legte.
Die Stirn, die wandern will, nimmt nie ein Wind dir mit;
der Erde sanfte Tücke
läßt niemals zu, daß über einen Schritt
dein Schatten sich entzücke!
Sie zieht nur, diese Stirn, indem sie steigt ins Licht,
wohin der Saft sich steigert;
so nimmst du, Reinheit, zu und brichst den Knoten nicht
der Bindung, die sich weigert!
Sieh die Lebendigen rings, die so wie dich im Zaum
hält die erlauchte Schlange;
Steineiche, Pinie, Pappel und Ahornbaum,
sie zählen währte lange,
die, in der Toten Griff, mit auf gesträhntem Fuß
den tauben Staub umfassen
und fühlen, wie ein Blühn, ein Samenflug im Fluß
der Zeit sie leicht verlassen.
Die Espe da, und dort vier Fraun im Buchenstamm,
die man gut unterscheidet,
sie rudern aussichtslos wider den Himmelsdamm,
mit Rudern ganz umkleidet.
So leben sie getrennt und weinen dumpf vereint
im gleichen Sich-nicht-kennen,
und wie umsonst der Silberglieder Spaltung scheint,
wo sie sich leise trennen.
Steigt abends dann ihr Hauch zu Aphroditen hin
aus ihrer Seele Lähmung,
so setzt sich, sehr erschreckt und still, die Jünglingin,
ganz glühend von Beschämung.
Ein Vorgefühl entsteht, das zärtlich an ihr zehrt,
und macht sie fast zunichte,
wie wenn ein naher Leib sich zu der Zukunft kehrt
mit neuem Angesichte …
Doch du mit Armen, rein und freier von dem Tier,
die sich ins Gold erheben,
der du bei Tag das Bild der Träume bist, die ihr
Geheimnis nachts dir geben,
thronender Überfluß von Blättern, stolzer Streit,
wenn Nordwind dröhnt, der scharfe,
und junger Winterhimmel hoch im Gold sein Leid
in der Platane Harfe
wagt auszuschrein!… Du mußt, du Leib, der weich sich wehrt,
dich winden und entwinden,
und klagen ohne Bruch, daß zu den Winden kehrt
die Stimme, die sie finden!
Schlag dich mit Geißeln, bis die Marter heiß dich brennt,
die selbst dir angetane,
und wehr der Flamme, die sich nicht vom Spane trennt,
die Rückkehr zu dem Spane!
Damit die Hymne steigt zu künftiger Vögel Flug,
und in dem ganzen Stamme
Reinheit der Seele zittre, weil er dies ertrug
und träumte, daß er flamme.
Dich hab ich auserwählt, Gestalt in einem Park,
trunken von deinem Wogen,
weil dich der Himmel biegt, bis eine Sprache stark
aus dir entspringt, o Bogen!
O, daß verliebt wie sonst die Dryas dich berührt,
dem Dichter nur gelänge,
daß er die Schenkelkraft, wie man ein Pferd verspürt,
an deine Glätte dränge!
Nein, sagt der Baum, sagt nein, im Glanz des Blätterschwalls
sein hohes Haupt bewegend,
mit dem der Sturm im All nicht anders umgeht als
mit jedem Gras der Gegend!
Aus dem Französischen von Rainer Maria Rilke.
-

Elisabeth Borchers – Märchen
1–2 MinutenJemand hat den Titel dieses Gedicht auf eine leere Seite geschrieben. Mit Bleistift, inkl. Seitenzahl. Das Buch – eine Jubiläumsausgabe von Elisabeth Borchers, erschienen zu ihrem 75. Geburtstag, gesammelt unter dem Titel Alles redet, schweigt und ruft – kam aus einem Antiquariat zu mir. Wessen Hand das war, weiß ich nicht. Aber die Geste hat…
-

Ein Paradies, das sich datieren lässt
in Lyrik4–6 MinutenZu Elisabeth Borchers‘ Gedicht – und was passiert, wenn ein Wort hinzukommt | Elisabeth Borchers, 1926 in Homberg am Rhein geboren, gehört zu den Lyrikerinnen, die man im deutschsprachigen Raum kennt, ohne dass man immer sagen könnte, warum. Sie hat Kinderbücher geschrieben, Gedichte, sie war lange Lektorin bei Suhrkamp. Ein Name. Vielleicht eine Assoziation: sorgfältig,…
-

Volkmar Mühleis – VON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN
1–2 MinutenVON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN hunderte von Seiten lang durch die Pariser Vorstädte zurück in Büchners Zeit über Gedichte hinter dem Eisernen Vorhang mitten durch ein Ideen-Gewimmel aus Reiselust einen Blick auf Rom werfen, um wieder bei einer Tasse Tee den Vögeln zu lauschen, Nachbarn in ihrem Kommen und Gehen, auf dem Sofa, das…
-

Von einem Buch zum andern übersetzen
in Lyrik1–2 MinutenEin Dank an Volkmar Mühleis für die Inspiration – Gelesen habe ich sein Gedicht „Von einem Buch zum andern wandern“ in Ausgabe 44 der WORTSCHAU. Es beschreibt Lesen als müheloses Bewegen durch Welten, als Genuss auf dem Sofa, das einem die Welt bedeutet. Ich habe ein anderes Lesen gelernt – eines, das nicht wandert, sondern…
-

Sirius / Hundstage
1–2 Minuten1 069 000 Sonnenweiten entferntstrahlt er, der hellste Sternim Sternbild des großen Hundes.16,9 Jahre braucht sein Lichtbis hierher. Vierzehn Sonnenließen sich aus seiner Masse formen. Die Ägypter warteten auf ihn,ungeduldig, denn sein Erscheinenin der Morgendämmerung bedeutete:der Nil wird steigen, der Segen kommt. In Griechenland bezeichnetesein Wiederauftauchen am Osthimmeldie Opora – Obst und Wein reiften,doch Hippokrates…
-

Wisława Szymborska – Die Gedichte
1–2 Minuten„… Um die Dichter steht es schlechter. Ihre Arbeit ist hoffnungslos unfotogen. Da sitzt jemand am Tisch oder liegt auf dem Sofa, starrt unablässig an die Wand oder die Decke, schreibt von Zeit zu Zeit sieben Zeilen, von denen er nach einer Viertelstunde eine streicht, und wieder vergeht eine Stunde, und es geschieht nichts… Welcher…
-

Jane Wels – Lilith
3–4 MinutenEin Gedicht von Jane Wels – auf Instagram von ihr geteilt – fragt nach einem Raum, in dem Sprache nicht mit Worten angefüllt ist. Das ist keine rhetorische Frage. Es ist eine, die Widerstand leistet gegen schnelle Antworten. Eine Annäherung. Die naheliegende Versuchung wäre, das Gedicht inhaltlich aufzulösen – aber bei Jane Wels funktioniert der…
-

Am Zweig
1–2 MinutenAm Zweig die Feder, klein, wiegt sich. Wildschweinschwärze aus dem Erdreich, beißt in die Nase. Mein weißer Hund im Schnee – fast weg. Foto: Oliver Simon
-
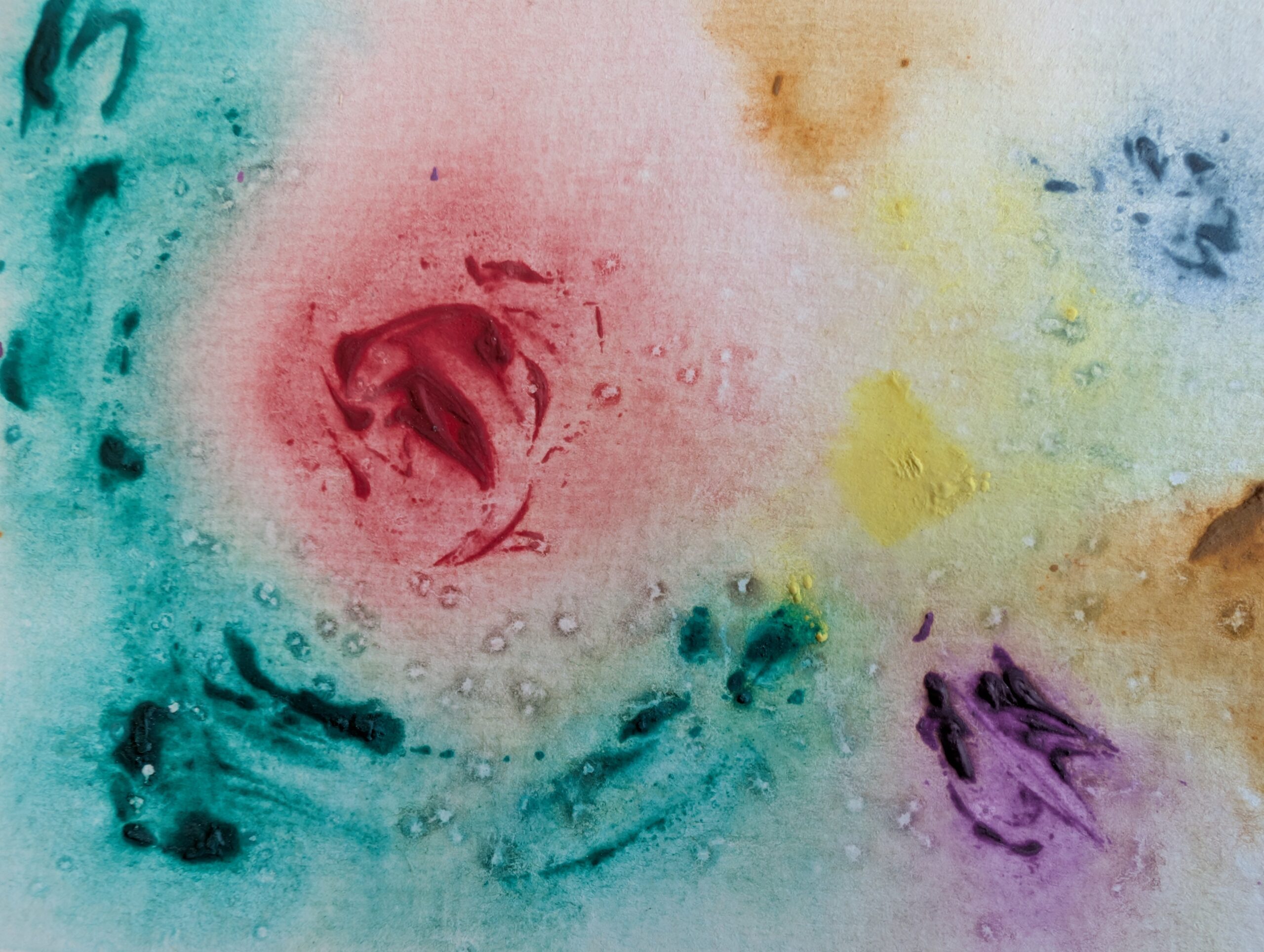
Udo Degener – Miklós Radnóti (1909–1944)
2–3 MinutenWer war Miklós Radnóti. Miklós Radnóti wurde 1909 in Budapest geboren, jüdischer Herkunft, ungarischer Dichter. Er schrieb früh, studierte Literatur, bewegte sich bewusst in der ungarischen Sprach- und Formtradition. In den 1930er Jahren wurde sein Leben zunehmend durch antisemitische Gesetze bestimmt. Er durfte nicht mehr regulär publizieren, wurde zu sogenannten Arbeitsdiensten eingezogen, also Zwangsarbeit ohne…
-

Udo Degener – Meine Gedichte sind
1–2 MinutenDer Text setzt mit einer Wiederholung ein. Jede Zeile beginnt gleich, und doch verschiebt sich der Gegenstand fortlaufend. „Meine Gedichte sind“ markiert keinen festen Besitz, sondern einen Ort, an dem immer wieder neu angesetzt wird. Die Gedichte werden nicht erklärt, sondern in Umlauf gebracht. Zunächst tauchen sie als Material auf: Schreibmaschinenpapier, eine genaue Sorte, versehen…
-

Nathalie Schmid: der geschmack von kartoffeln
3–4 MinutenNathalie Schmids Gedicht „der geschmack von kartoffeln“ porträtiert „einen schlag von frauen“ durch eine Collage körperlicher und alltäglicher Details, die auf den ersten Blick schlicht dokumentarisch wirken. Doch zwischen den Zeilen entfaltet sie eine Dichte, die mich bekümmert: ein Leben, das nur noch rückblickend Bedeutung hat. Verschlossene Innenwelten Die Frauen des Gedichts zeigen sich in…
-

Jane Wels – Bitte versuchen sie, …
3–5 MinutenAnnähernd gelesen | Zwischen Sprache, Ordnung und AuflösungJane Wels‘ Gedicht „Bitte versuchen Sie,“ ist ein Text über die Unmöglichkeit, gefasst zu werden – und zugleich ein Text, der sich selbst beim Versuch des Fassens beobachtet. Es spielt mit der Spannung zwischen Sprache und Identität, zwischen Ordnung und Auflösung, und ist dabei zugleich selbstreflexiv, ironisch und…
-
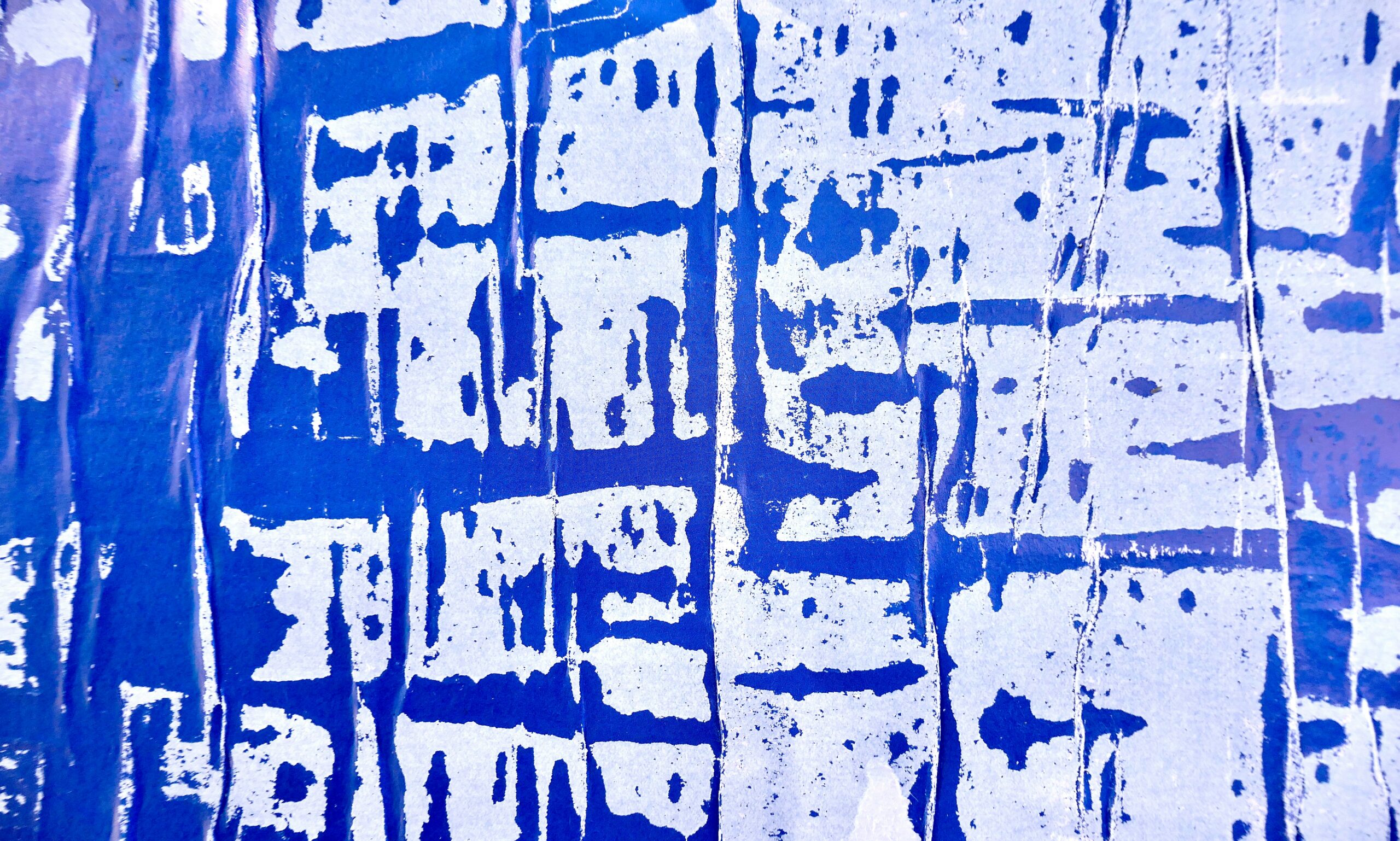
Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee
3–4 MinutenAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…
-

Martin Maurach – Fünf Fragmente, fünf Türen
2–4 MinutenMartin Maurach: Leben auf Geistes Schneide | Annähernd gelesen Fünf Zeilen die nicht als Gedicht nebeneinander stehen, sondern als ausgewählte Fragmente aus einer größeren Sammlung. Martin Maurach hat mir dankenswerterweise zur Entstehung geschrieben: Die Redaktion der „Konzepte“ hat aus seinen Prosafragmenten diese fünf ausgewählt und montiert. Der Text ist damit weniger als geschlossene Einheit zu…
-

Wenn Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein
4–6 MinutenÜber Kathrin Niemelas „pont des arts“ | Kathrin Niemelas Gedicht „pont des arts“ erschien in der Literaturzeitschrift Wortschau in einer Paris-Ausgabe. Es ist ein Text, der sich beim ersten Lesen entzieht – nicht weil er hermetisch wäre, sondern weil er so verdichtet ist, dass man ihn kaum greifen kann. Die Sprache ist präzise, die Klänge…
-

Maria Arimany – In den Wald muss man gehen, wenn es noch dunkel ist
in Lyrik3–5 MinutenMaria Arimanys Gedicht trägt einen vielversprechenden Titel: „In den Wald muss man gehen, wenn es noch dunkel ist“. Diese Idee birgt etwas Spannendes, fast Initiatisches – der Gang in die Dunkelheit als bewusste Entscheidung, als Schwelle zu einer anderen Wahrnehmung. Das Gedicht | Das Werk besteht aus zwei Spalten mit teils verrückten Zeilenumbrüchen. Die Autorin…
-

Annette Hagemann: ARTIST
3–5 MinutenDer Künstler als Versuchsanordnung und Schaustück? Auf den ersten Blick scheint Annette Hagemanns Gedicht ARTIST ein feines, fast ehrfürchtiges Porträt eines schöpferischen Menschen zu sein – eines, der sich einen Raum erbittet, um seine Arbeit zu tun: „Du hattest um den Geheimnisraum gebeten, das Innere des Turms ein leuchtender Lichthof …“ Ein Bild der Sammlung,…
-

Linda Gundermann: „Bindungsstil“ – Wenn Psychologie auf Herzschmerz trifft
3–4 MinutenManchmal landet man durch Zufall bei einem Lied, das einen nicht mehr loslässt. Bei mir war es eine Recherche zu Grit Lemkes Kinder von Hoy, die mich über den Singeklub Hoyerswerda zu Gundi und schließlich zu ihrer Tochter Linda Gundermann führte. Ihr Lied „Bindungsstil“ ist mir dabei begegnet – und ich höre es seitdem immer…
