Manchmal landet man durch Zufall bei einem Lied, das einen nicht mehr loslässt. Bei mir war es eine Recherche zu Grit Lemkes Kinder von Hoy, die mich über den Singeklub Hoyerswerda zu Gundi und schließlich zu ihrer Tochter Linda Gundermann führte. Ihr Lied „Bindungsstil“ ist mir dabei begegnet – und ich höre es seitdem immer wieder.
„Baby du passt nicht zu mein’m Bindungsstil“
Dieser Satz fasst zusammen, was an dem Lied so besonders ist: Hier spricht eine Frau über das Scheitern ihrer Beziehung nicht nur mit Gefühl, sondern mit dem Vokabular der Psychologie. „Bindungsstil“ – ein Begriff aus der Therapie, aus Ratgebern, aus Instagram-Grafiken über toxische Beziehungen. Und genau diese Vermischung macht etwas sichtbar: Wie wir heute über Liebe sprechen, hat sich verändert. Wir analysieren, wir benennen Muster, wir versuchen zu verstehen, was schiefgelaufen ist.
Aber hilft uns das wirklich? Oder steht uns diese ganze psychologische Sprache manchmal im Weg, wenn wir eigentlich einfach nur traurig sind?
Kreisende Gedanken und volle Windeln
Linda Gundermann beginnt mit einer Szene, die jede:r kennt, der schon mal eine Trennung durchgemacht hat: „Ich tanze in Kreisen im Gedankenfieber“. Diese nächtlichen Gedankenschleifen, in denen man immer wieder dasselbe durchkaut, ohne weiterzukommen. Und dann dieser Bruch: Vom psychologischen Fachbegriff („Bindungsstil“) zu „du scheißt dir die Hosen voll“.
Das ist keine schöne Metapher, das ist brutal direkt. Und genau so fühlt sich eine gescheiterte Beziehung oft an: Auf der einen Seite die Erkenntnis, dass man vielleicht einfach nicht zusammengepasst hat. Auf der anderen Seite die Wut darüber, dass der andere bei jeder echten Nähe die Flucht ergriffen hat.
Was mich besonders berührt, ist die zweite Strophe. Da wird es konkret: Siebzehn Liebesbriefe in alten Fotokisten. Ein gemeinsames Kind, das „FlowerPowerHippieLiebesKind“. Plötzlich geht es nicht mehr nur um die eigene Trauer, sondern um ein Kind, das beide Eltern im Gesicht trägt. „Die Familie, die wir nicht mehr sind“ – in diesem einen Satz steckt die ganze Schwere.
Die Last der richtigen Worte
Was passiert, wenn eine Mutter vor diesen Fotokisten sitzt, während das Kind im Nebenzimmer schläft? Sie versucht zu verstehen. Sie sucht nach Gründen. Und die Sprache, die ihr zur Verfügung steht, ist eben diese psychologische: Bindungsstil, Kompatibilität, Muster.
Der Refrain wiederholt diese Erkenntnis wie eine Beschwörung: „Baby du passt nicht zu mein’m Bindungsstil“. Als müsste sie es sich selbst immer wieder sagen, damit es wahr wird. Damit es weniger wehtut. Aber in dem fast entschuldigenden Satz „Ich dacht ja echt zur Liebe gehört Qual“ blitzt etwas anderes auf: Die Ahnung, dass sie vielleicht zu lange in einer Beziehung ausgeharrt hat, die ihr nicht gutgetan hat.
Der Wunsch nach dem Gegenteil
Im letzten Teil des Liedes entwirft sie ein Gegenbild: „Und wenn sie ja sagt, dann sagt sie sogar wann“. Diese Zukunftsvision einer Beziehung, in der jemand klar kommuniziert, verlässlich ist, sich nicht wegduckt. Die Wiederholung dieser Wünsche wirkt fast beschwörend – als könnte sie sich durch das Aussprechen eine andere, bessere Liebe herbeireden.
Zwischendurch bricht sie ab: „Gezeter bis: Wo war ich nochmal?“ Diese Momente zeigen die Zerrissenheit. Man verliert den Faden. Man springt zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Trauer und Hoffnung, zwischen dem Kind, das versorgt werden muss, und der eigenen Sehnsucht nach einer funktionierenden Partnerschaft.
Was bleibt
Linda Gundermanns „Bindungsstil“ ist ein Lied aus der Perspektive einer Frau, die beides sein muss: Mutter und Liebende. Die nach einer Trennung nicht einfach weiterleben kann, sondern Verantwortung trägt. Die verstehen will, was schiefgegangen ist – und dabei merkt, dass alle psychologischen Begriffe der Welt den Schmerz nicht kleiner machen.
Wir sprechen heute anders über Liebe als frühere Generationen. Wir haben mehr Worte, mehr Konzepte, mehr Erklärungen. Aber ob das die Trauer leichter macht? Das bleibt offen. Vielleicht hilft die Psychologie, Ordnung ins Chaos zu bringen. Vielleicht steht sie aber auch manchmal nur im Weg, wenn wir eigentlich einfach nur fühlen müssten.
Linda Gundermann ist die Tochter des Liedermachers Gerhard Gundermann (1955–1998), der als Baggerfahrer im Lausitzer Braunkohlerevier arbeitete und zu einer Symbolfigur des Ostens wurde. Grit Lemke beschreibt in ihrem dokumentarischen Roman „Kinder von Hoy“ (2021) die Kulturszene um den Singeklub Hoyerswerda, zu der auch Gerhard Gundermann gehörte.
Die Website der Band: http://langeleitung.com
-

Elisabeth Wesuls – Was ein Kind ist, um 1960
2–3 MinutenGegen das Kind als Postpaket | Beim Lesen eines kurzen Prosatextes über Kindheit „um 1960“ stellt sich ein unmittelbarer Impuls ein: Man möchte widersprechen. Nicht einer Meinung – sondern einem Bild. Der Text zählt auf, was einem Kind zugeschrieben wurde: dass man es „nichts fragen“ müsse, dass ihm „kein eigener Wille“ zugestanden wird, dass es…
-

Elisabeth Wesuls – Hohe Klinken
2–3 MinutenElisabeth Wesuls erzählt von einem Besuch, bei dem man nur eintreten darf, wenn man sich klein macht. Eine Annäherung: Das Eintreten ist kein Beginn, sondern bereits eine Prüfung. Die Tür muss geöffnet werden, nicht sie selbst tritt ein. Der Körper des Mannes entscheidet, wie viel Raum ihr zusteht. Sie passt nur hindurch, indem sie sich…
-

Nathalie Schmid: der geschmack von kartoffeln
3–4 MinutenNathalie Schmids Gedicht „der geschmack von kartoffeln“ porträtiert „einen schlag von frauen“ durch eine Collage körperlicher und alltäglicher Details, die auf den ersten Blick schlicht dokumentarisch wirken. Doch zwischen den Zeilen entfaltet sie eine Dichte, die mich bekümmert: ein Leben, das nur noch rückblickend Bedeutung hat. Verschlossene Innenwelten Die Frauen des Gedichts zeigen sich in…
-

Ein Zimmer für sich allein
3–5 MinutenEine Begegnung mit Virginia Woolf über Umwege – Ausgangspunkt: Eine Lithographie von Wolfgang Mattheuer Manchmal führen merkwürdige Wege zu einem Text. In meinem Fall begann es mit einer Lithographie des DDR-Künstlers Wolfgang Mattheuer in dem Band „Äußerungen“. Zu finden ist der Druck vor dem ersten Texteintrag, trägt den Titel „Abendliches Studium“ und stammt aus dem…
-

Den Mund über Wasser halten
6–9 MinutenEin Essay über männliche Verantwortung im Angesicht von Femiziden I. Das Gedicht als Warnsignal Kathrin Niemelas Gedicht „Beckenendlage“ beginnt mit einem medizinischen Begriff – einer riskanten Geburtslage – und endet im Ertränkungsbecken. Es verbindet die Hinrichtung verurteilter „Hexen“ im isländischen Drekkingarhylur mit Agnes Bernauer in der Donau und mit den ertrinkenden Frauen im Mittelmeer. Der…
-

Rachel Cusks „Outline“ – Die Kunst des Verschwindens
3–5 MinutenRachel Cusks „Outline“ (2014, dt. „Outline – Von der Freiheit, ich zu sagen“) markiert einen radikalen Neuanfang in ihrem Werk. Nach zwei autobiografischen Büchern über Scheidung und Mutterschaft, die ihr heftige Kritik einbrachten, entwickelt die britische Autorin (*1967) eine völlig neue Erzählform: Sie lässt ihre Ich-Erzählerin beinahe verschwinden. Eine Erzählerin ohne Geschichte Eine namenlose Schriftstellerin…
-

Gioconda Bellis Maurenlegende. Moderne Version
2–3 MinutenIch sehe von fern das Land, das ich verließ. Ich beweine als Frau, was ich als Mann nicht zu verteidigen wusste. Die historische Vorlage: Der Seufzer des Mauren Dieses kurze, aber kraftvolle Gedicht von Gioconda Belli nimmt Bezug auf eine der bekanntesten Erzählungen der spanischen Geschichte: die Legende vom „Seufzer des Mauren“ (el suspiro del…
-

Himbeeren – Valerie Zichy
4–6 MinutenHIMBEEREN das hier ist autofiktion. das ich hier ist autofiktion. das ich hinter diesem text isst gerne himbeeren. das ich hat oft ein schlechtes gewissen. und regelschmerzen. das ich trinkt heiße schokolade. das ich ist fiktiv. das ich ist ich und das ich ist nicht ich. das ich ist babysitterin. das ich zieht über-all die…
-

Linda Gundermann: „Bindungsstil“ – Wenn Psychologie auf Herzschmerz trifft
3–4 MinutenManchmal landet man durch Zufall bei einem Lied, das einen nicht mehr loslässt. Bei mir war es eine Recherche zu Grit Lemkes Kinder von Hoy, die mich über den Singeklub Hoyerswerda zu Gundi und schließlich zu ihrer Tochter Linda Gundermann führte. Ihr Lied „Bindungsstil“ ist mir dabei begegnet – und ich höre es seitdem immer…
-

Jane Wels‘ Sandrine
3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…
-

Aus dem Reifen treten – Lyrik von Nathalie Schmid
5–7 MinutenAbstammung bedeutet nicht nurvon Männern über Männer zu Männern.Abstammung bedeutet auchmeine Gewaltgegen mich eine Hetze.Abstammung: Immer nochaus Sternenstaub gemacht. Immer nochsehr komplex. Immer nochauf die Spur kommend.Abstammung im Sinne von:Ring um den Hals eher auf Schulterhöheein loser Reifen. Ein Reifenden man fallen lassen kannaus ihm hinaustreten und sagen:Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit.Das…
-

BECKENENDLAGE – Kathrin Niemela
3–4 MinutenWenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken. Drekkingarhylur:…
-
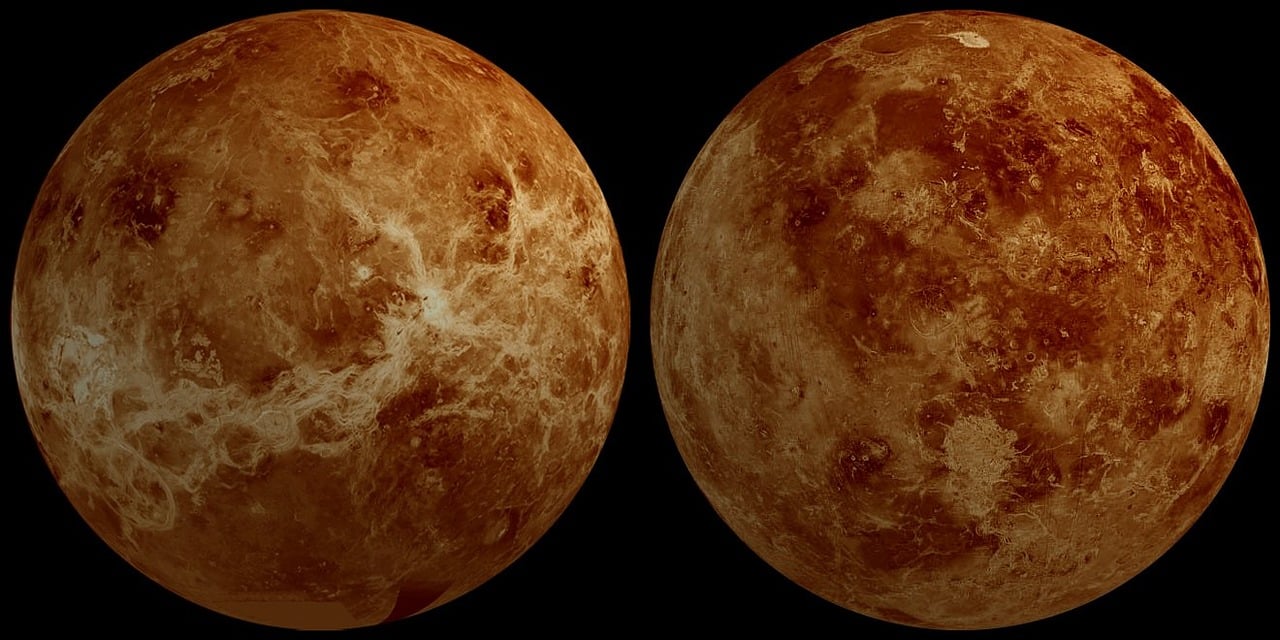
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Ille Chamier – Lied 76
2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…

