Wäre ich ein Gott, zu dem man betet,
ich käme in die größte Verlegenheit,
von einem Tonfall des Bittenden irgendwo gerührt zu werden.
Sobald das Bessere nur leise anklänge,
würde ich gleich Ja sagen,
«stärkend das Bessere mit einem Tropfen von meinem Tau».
Somit würde von mir ein Teilchen gewährt,
und immer wieder nur ein Teilchen,
denn ich weiß ja sehr wohl,
daß das Gute in erster Linie bestehen muß,
aber doch ohne das Böse nicht leben kann.
Ich würde also in jedem einzelnen
die Gewichtsverhältnisse der beiden Teile ordnen,
bis zu einem gewissen Grad der Erträglichkeit.
Revolution würde ich nicht dulden,
wohl aber zu ihrer Zeit selbst machen.
Daran sehe ich, dass ich noch kein Gott bin.
Ich wäre auch leicht, und mir dessen bewusst, zu überlisten.
Ich wäre rasch im Verleihen eines Ja, einem kurzen
Tone im Gebet gegönnt, welcher rührte.
Gleich darauf wär ich imstande,
sehr inkonsequent zu handeln,
und mich zu verwandeln
in das Ungeheuer Schauer,
welcher liegt auf solcher Lauer,
daß es dann gibt Trauer
in Familien, wo sein Gift
gerade trifft.
Viel historisches Theater wollte ich auch machen,
die Zeiten würden losgebunden von ihrem Alter,
das wäre ein Durcheinander zum Lachen.
Aber mancher wäre entzückt,
– hätt ich zum Beispiel je einen irrenden Ritter
draußen im Busch gefunden,
ich war beglückt! –.
Ein bisschen narren würd ich die Leutchen auch zuweilen
und gäbe ihnen in der Labung Ätzung,
in der Nahrung Zersetzung –
und Schmerz in der Paarung.
Ich stiftete einen Orden,
im Banner die lustig hüpfende Träne.
Aus: Paul Klee – Gedichte / Neue erweiterte Ausgabe 1980
Verlag der Arche – Zürich
ISBN: 3-7160-1650-0
Eine Annäherung an den Text
Paul Klees Gedicht „Wäre ich ein Gott, zu dem man betet…“ liest sich wie ein frecher, nachdenklicher Monolog – so als ob jemand, der mit aller Macht und Verantwortung ausgestattet wäre, plötzlich ganz menschliche Zweifel und Schwächen hätte. Es ist keine akademische Analyse, sondern ein Blick darauf, was das Gedicht uns heute sagt:
Ein Gott zwischen Anspruch und Verletzlichkeit
Das Gedicht beginnt mit der Vorstellung, dass selbst ein Gott in Bedrängnis gerät, wenn er von einem leisen, menschlichen Bitten „gerührt wird“. Diese Zeilen werfen Fragen nach der Erreichbarkeit und Menschlichkeit der Mächtigen auf. Auch wenn wir im Alltag oft über uns selbst und über Institutionen nachdenken, zeigt Klees Text, dass Macht immer auch Verantwortung und eine gewisse Überforderung mit sich bringt. Wer von uns hat nicht schon einmal gezögert oder sich überwältigt gefühlt, wenn die Erwartungen zu hoch waren?
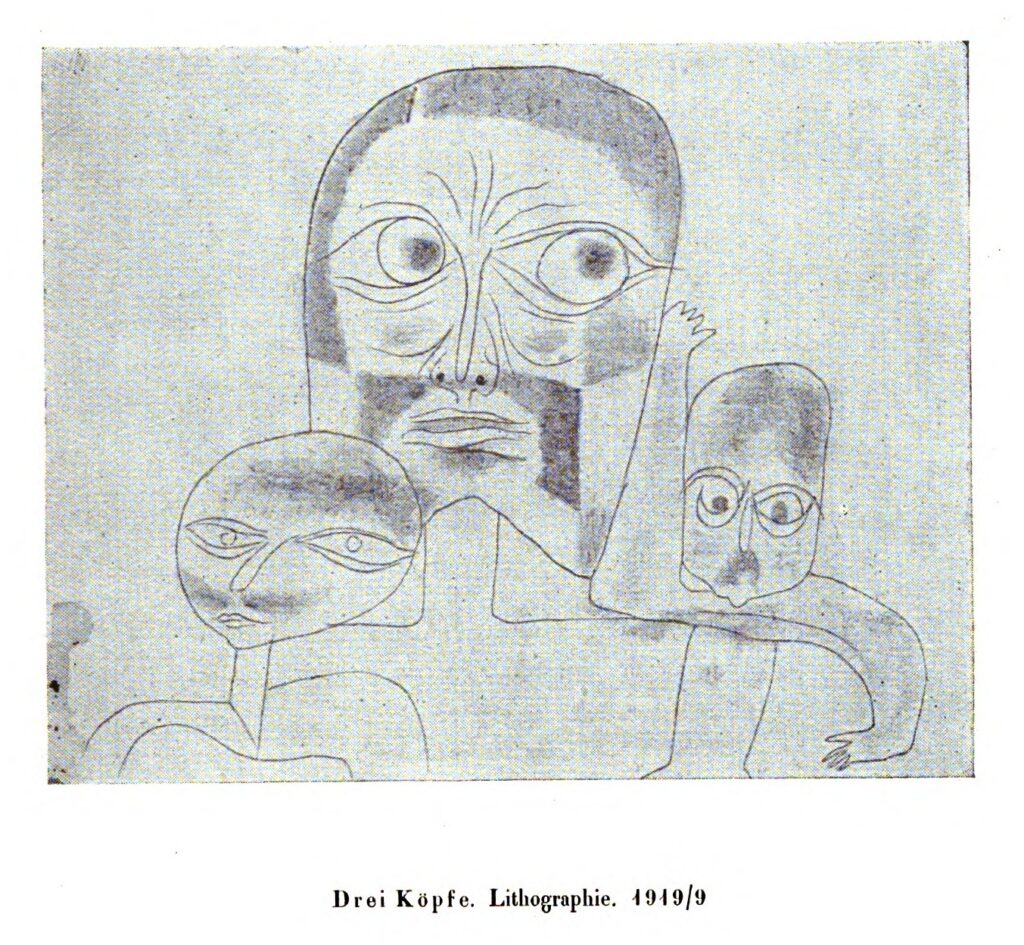
Das Spiel von Gut und Böse
Ein zentraler Gedanke ist die untrennbare Verbindung von Gut und Böse. Der Gott in Klees Versen gesteht, dass „das Gute in erster Linie bestehen muss, aber doch ohne das Böse nicht leben kann.“ Damit wird ein Grundsatz ausgedrückt, der uns an die alltäglichen kleinen und großen Paradoxien erinnert: Es gibt Licht und Schatten in jedem Leben, und die Erfahrung beider Seiten macht uns menschlich. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch in vielen gesellschaftlichen Debatten wider, etwa in der Frage, wie man mit „Negativem“ umgeht – sei es in der Politik, im sozialen Miteinander oder in persönlichen Beziehungen.
Verantwortlichkeit und Selbstzweifel
Ein weiterer Aspekt des Gedichts ist der Spagat zwischen dem Wunsch, positiv eingreifen zu wollen („stärkend das Bessere mit einem Tropfen von meinem Tau“) und der Sorge, zu schnell oder zu unbedacht zu handeln. Die Zeilen, in denen der Gott seine Bereitschaft zu revolutionären Eingriffen – aber eben „zu ihrer Zeit“ – betont, lassen sich heute auch als Kritik an überhasteten politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen lesen. Viele Menschen spüren den Zwiespalt zwischen dem Drang nach radikalem Wandel und der Furcht vor Chaos und unkontrollierten Umbrüchen.
Humorvolle Selbstironie und Zeitbezug
Klees Text ist nicht schwerfällig oder lehrbuchhaft, sondern steckt voller Ironie und selbstkritischem Humor. Der Gott, der sich selbst als „leicht zu überlisten“ bezeichnet und sogar Freude daran hat, „die Leutchen“ ein wenig zu narren, wirkt fast wie ein Spiegelbild der menschlichen Natur, die ebenso zu Fehlern und kleinen Scherzen fähig ist. Solche Passagen können auch an die ständige Suche nach Authentizität in unserer modernen Gesellschaft erinnern: Wir wünschen uns starke, klare Führung – doch auch unsere Führungspersönlichkeiten sind nur Menschen, mit all ihren Widersprüchen.
Historische und gegenwärtige Parallelen
Obwohl Paul Klee seine Texte in einer ganz bestimmten historischen Epoche schrieb – in einer Zeit, in der die Welt in Umbruch war und die politischen Systeme in Europa oft vor schwierigen Entscheidungen standen – wirkt sein Gedicht erstaunlich aktuell. Es thematisiert die Verantwortung und Zweifel, die auch heute in politischen Führungsrollen und in der alltäglichen Ethik spürbar sind. Die Zeile „Revolution würde ich nicht dulden, wohl aber zu ihrer Zeit selbst machen“ könnte man heute als Mahnung verstehen, dass auch radikale Veränderungen nur dann sinnvoll sind, wenn sie bedacht und zeitlich angemessen erfolgen. Dies erinnert an die politischen Umbrüche und Unruhen, die immer wieder Teil unserer Geschichte sind – von der industriellen Revolution über die turbulenten 1960er bis hin zu den aktuellen gesellschaftlichen Debatten.
Paul Klees Gedicht schildert eine Momentaufnahme von menschlicher Selbstzweifel und dem Streben nach moralischer Ordnung – immer im Spannungsfeld zwischen Pflicht und Freiheit. Es spricht von einem Gott, der zwar immense Kräfte hätte, sich aber letztlich der menschlichen Unvollkommenheit bewusst bleibt. Heute gelesen ist es eine Erinnerung daran, dass auch die Mächtigen nicht über den alltäglichen moralischen Konflikten stehen, sondern eben auch immer wieder Menschlichkeit zeigen – mit allem Witz, Ernst und der notwendigen Ironie.
Ich habe versucht, Paul Klees Gedanken auf das Heute zu übertragen und habe Gottes-Figur ausgetauscht:
Wäre ich ein Algorithmus, der eure Sehnsucht füttert…
Wäre ich ein Polit-Unternehmer, der die Welt regiert…
Alle aus diesem Gedicht entstandenen Beiträge finden Sie hier.

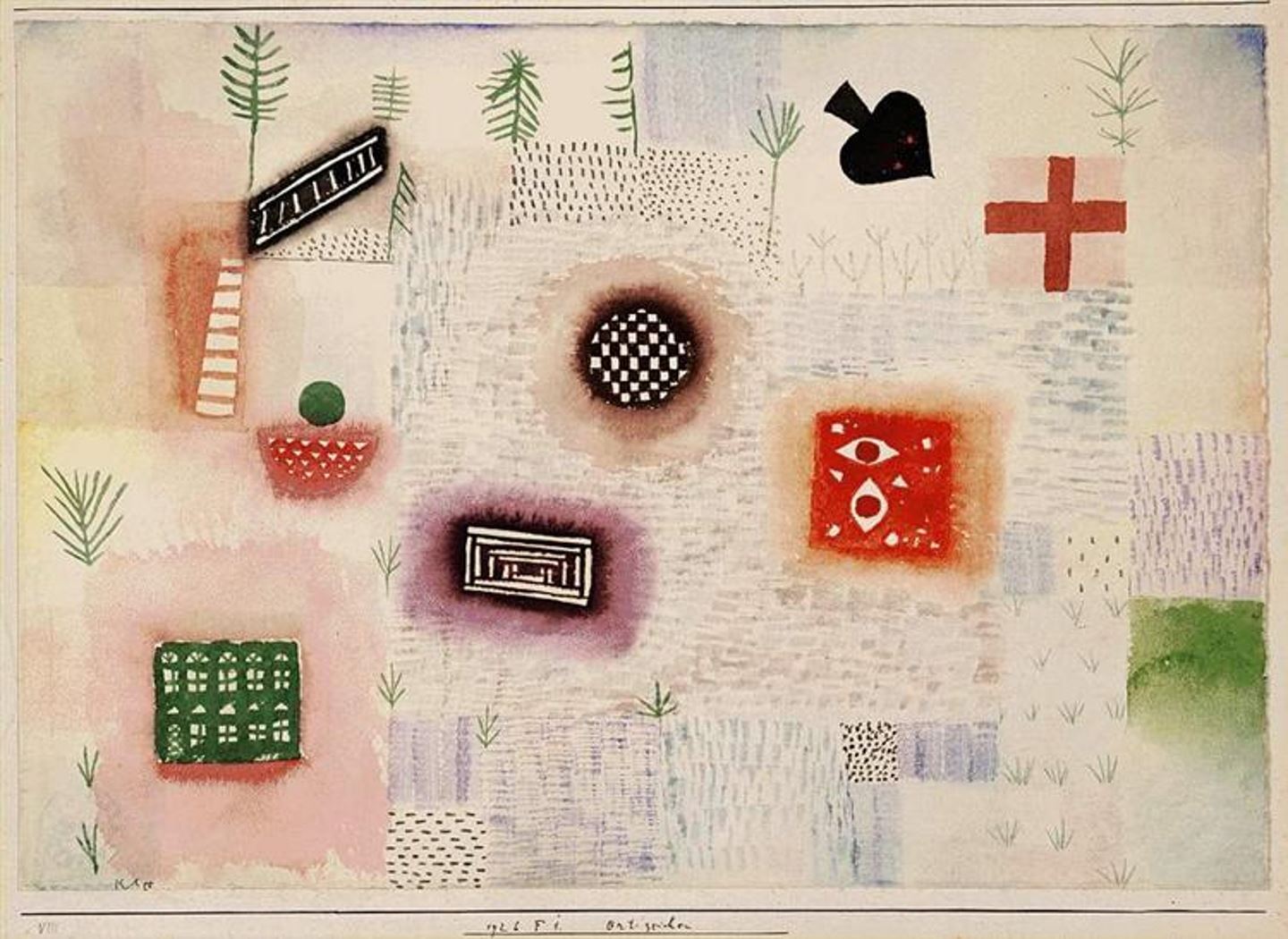
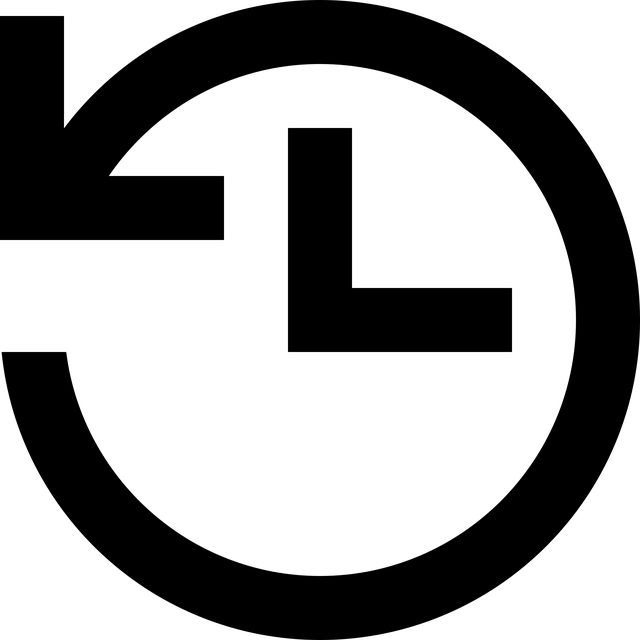
Schreibe einen Kommentar