Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch gerade in ihrer Banalität verdichten sie sich zu Metaphern für die unsichtbaren Übertragungen von Identität: die mütterliche Gabe, selbst in komplexen Beziehungen („wie meinem Vater“) das Verbindende zu bewahren, oder das väterliche Interesse an Zoologie als Brücke zur Welt des Lebendigen.
Dem gegenüber steht ein drängendes Bedürfnis nach Abgrenzung. Das nächtliche Verschließen der Ohren, um nur den eigenen Körper zu hören, und der spätere Auszug ins Selbstbestimmte werden nicht als Bruch, sondern als notwendige Prozedur des Werdens inszeniert. Selbst die Mutter reduziert sich in der Rückschau auf Fragmente – Beine unter der Wäscheleine –, als ob die Distanzierung auch ein Verlust der Ganzheitlichkeit bedeute.
Die Schlusszeile „und so bleibe am Ende / als Erbschaft nur ich“ fasst diesen Zwiespalt prägnant: Das Ich konstituiert sich zwar aus dem Erbe, doch im Akt der Selbstschöpfung wird dieses zugleich überschrieben. Die Melancholie liegt nicht im Fehlen der Elternspuren, sondern darin, dass ihre greifbaren Zeichen verblassen, sobald das Subjekt sich als eigenständige Summe begreift. Hagemann gelingt damit ein stilles Porträt der Reifung – als Balanceakt zwischen Annahme und Abschütteln, Erinnern und Entwachsen.
Gefunden habe ich das Gedicht im LiteraturMagazin WORTSCHAU. Ausgabe 31 – Menschen: Bilder – wortschau.com
Das Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ von Annette Hagemann aktiv gelesen:
-

Elisabeth Wesuls – Was ein Kind ist, um 1960
2–3 MinutenGegen das Kind als Postpaket | Beim Lesen eines kurzen Prosatextes über Kindheit „um 1960“ stellt sich ein unmittelbarer Impuls ein: Man möchte widersprechen. Nicht einer Meinung – sondern einem Bild. Der Text zählt auf, was einem Kind zugeschrieben wurde: dass man es „nichts fragen“ müsse, dass ihm „kein eigener Wille“ zugestanden wird, dass es…
-

Elisabeth Wesuls – Hohe Klinken
2–3 MinutenElisabeth Wesuls erzählt von einem Besuch, bei dem man nur eintreten darf, wenn man sich klein macht. Eine Annäherung: Das Eintreten ist kein Beginn, sondern bereits eine Prüfung. Die Tür muss geöffnet werden, nicht sie selbst tritt ein. Der Körper des Mannes entscheidet, wie viel Raum ihr zusteht. Sie passt nur hindurch, indem sie sich…
-

Nathalie Schmid: der geschmack von kartoffeln
3–4 MinutenNathalie Schmids Gedicht „der geschmack von kartoffeln“ porträtiert „einen schlag von frauen“ durch eine Collage körperlicher und alltäglicher Details, die auf den ersten Blick schlicht dokumentarisch wirken. Doch zwischen den Zeilen entfaltet sie eine Dichte, die mich bekümmert: ein Leben, das nur noch rückblickend Bedeutung hat. Verschlossene Innenwelten Die Frauen des Gedichts zeigen sich in…
-

Ein Zimmer für sich allein
3–5 MinutenEine Begegnung mit Virginia Woolf über Umwege – Ausgangspunkt: Eine Lithographie von Wolfgang Mattheuer Manchmal führen merkwürdige Wege zu einem Text. In meinem Fall begann es mit einer Lithographie des DDR-Künstlers Wolfgang Mattheuer in dem Band „Äußerungen“. Zu finden ist der Druck vor dem ersten Texteintrag, trägt den Titel „Abendliches Studium“ und stammt aus dem…
-

Den Mund über Wasser halten
6–9 MinutenEin Essay über männliche Verantwortung im Angesicht von Femiziden I. Das Gedicht als Warnsignal Kathrin Niemelas Gedicht „Beckenendlage“ beginnt mit einem medizinischen Begriff – einer riskanten Geburtslage – und endet im Ertränkungsbecken. Es verbindet die Hinrichtung verurteilter „Hexen“ im isländischen Drekkingarhylur mit Agnes Bernauer in der Donau und mit den ertrinkenden Frauen im Mittelmeer. Der…
-

Rachel Cusks „Outline“ – Die Kunst des Verschwindens
3–5 MinutenRachel Cusks „Outline“ (2014, dt. „Outline – Von der Freiheit, ich zu sagen“) markiert einen radikalen Neuanfang in ihrem Werk. Nach zwei autobiografischen Büchern über Scheidung und Mutterschaft, die ihr heftige Kritik einbrachten, entwickelt die britische Autorin (*1967) eine völlig neue Erzählform: Sie lässt ihre Ich-Erzählerin beinahe verschwinden. Eine Erzählerin ohne Geschichte Eine namenlose Schriftstellerin…
-

Gioconda Bellis Maurenlegende. Moderne Version
2–3 MinutenIch sehe von fern das Land, das ich verließ. Ich beweine als Frau, was ich als Mann nicht zu verteidigen wusste. Die historische Vorlage: Der Seufzer des Mauren Dieses kurze, aber kraftvolle Gedicht von Gioconda Belli nimmt Bezug auf eine der bekanntesten Erzählungen der spanischen Geschichte: die Legende vom „Seufzer des Mauren“ (el suspiro del…
-

Himbeeren – Valerie Zichy
4–6 MinutenHIMBEEREN das hier ist autofiktion. das ich hier ist autofiktion. das ich hinter diesem text isst gerne himbeeren. das ich hat oft ein schlechtes gewissen. und regelschmerzen. das ich trinkt heiße schokolade. das ich ist fiktiv. das ich ist ich und das ich ist nicht ich. das ich ist babysitterin. das ich zieht über-all die…
-

Linda Gundermann: „Bindungsstil“ – Wenn Psychologie auf Herzschmerz trifft
3–4 MinutenManchmal landet man durch Zufall bei einem Lied, das einen nicht mehr loslässt. Bei mir war es eine Recherche zu Grit Lemkes Kinder von Hoy, die mich über den Singeklub Hoyerswerda zu Gundi und schließlich zu ihrer Tochter Linda Gundermann führte. Ihr Lied „Bindungsstil“ ist mir dabei begegnet – und ich höre es seitdem immer…
-

Jane Wels‘ Sandrine
3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…
-

Aus dem Reifen treten – Lyrik von Nathalie Schmid
5–7 MinutenAbstammung bedeutet nicht nurvon Männern über Männer zu Männern.Abstammung bedeutet auchmeine Gewaltgegen mich eine Hetze.Abstammung: Immer nochaus Sternenstaub gemacht. Immer nochsehr komplex. Immer nochauf die Spur kommend.Abstammung im Sinne von:Ring um den Hals eher auf Schulterhöheein loser Reifen. Ein Reifenden man fallen lassen kannaus ihm hinaustreten und sagen:Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit.Das…
-

BECKENENDLAGE – Kathrin Niemela
3–4 MinutenWenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken. Drekkingarhylur:…
-
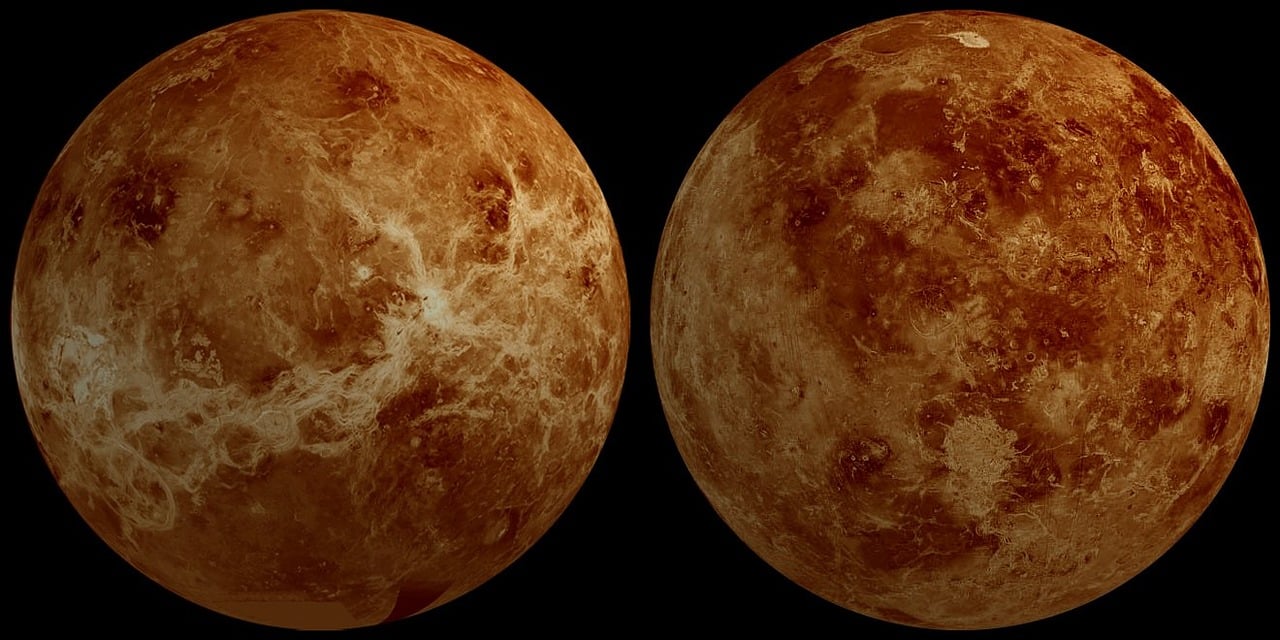
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Ille Chamier – Lied 76
2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…

