Ich zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte von Stimmen, die sich Gehör verschafften, als das literarische Feld noch weitgehend männlich dominiert war.
Dieser Text bietet einen historischen Überblick – von Ingeborg Bachmann bis Safiye Can. In den folgenden Beiträgen schaue ich mir einzelne Gedichte genauer an: Wie wird Gewalt gegen Frauen durch die Jahrhunderte tradiert? Was bedeutet es, zwischen Sprachen und Kulturen zu schreiben? Und warum beschäftige ich mich als Mann überhaupt mit feministischer Lyrik?
Ausgangspunkt war ein einziges Gedicht von Safiye Can – „Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung„. Darin die Zeile: „Die Welt muss lila werden.“
Wurzeln in der Nachkriegszeit
In den ersten Nachkriegsjahrzehnten war feministische Lyrik noch nicht als solche benannt, aber die Grundsteine wurden gelegt. Dichterinnen wie Ingeborg Bachmann prägten mit ihrer präzisen, oft schmerzhaften Sprache einen Ton, der später als spezifisch weiblich gelesen wurde. Bachmanns Zeilen aus „Anrufung des Großen Bären“ von 1956 – „Ich weiß keine bessere Welt“ – artikulierten eine Sehnsucht nach Veränderung, die über das Private hinausreichte.
Bachmann suchte nach einem Raum zum Schreiben, zum Denken – eine Suche, die Virginia Woolf bereits 1929 in ihrem Essay „A Room of One’s Own“ formuliert hatte. Wie ich auf Woolf stieß? Über eine Lithographie von Wolfgang Mattheuer in einem DDR-Kunstband. Ein merkwürdiger Umweg – nachzulesen hier: „Ein Zimmer für sich allein“.
Parallel dazu entwickelte sich in der DDR eine andere Tradition. Dichterinnen wie Sarah Kirsch oder Christa Wolf suchten in ihren Texten nach Möglichkeitsräumen jenseits der offiziellen Ideologie. Ihre Lyrik war zwar nicht explizit feministisch, schuf aber sprachliche Freiräume, die späteren Generationen den Weg bahnen sollten.
Die radikalen Siebziger: Sprache als Kampfmittel
Mit der Studentenbewegung von 1968 und der sich formierenden Neuen Frauenbewegung veränderte sich die literarische Landschaft grundlegend. Verena Stefans autobiografischer Roman „Häutungen“ (1975) wurde zum Manifest einer Generation, die das Private zum Politischen erklärte. Stefan schrieb: „Wir schrieben nicht für die Literaturgeschichte, sondern für die Frauen, die uns zuhörten.“
Diese Haltung prägte auch die Lyrik der Zeit. In Frauenzeitschriften wie „Courage“ oder „Emma“ erschienen kurze, agitatorische Gedichte, die als Flugblätter funktionierten. Die Texte waren oft rau, ungeschliffen – bewusst fernab literarischer Konventionen. Sie sollten nicht gefallen, sondern aufrütteln.
Eine Stimme, die aus dieser Zeit herausragt, ist die der 2021 verstorbenen Karin Kiwus. In ihrem Gedicht „Von beiden Seiten der Gegenwart“ (1976) schreibt sie:
„Ich sammle Gründe
warum eine Frau schreit
und merke
ich sammle mich“
Kiwus verdichtetet hier die Erfahrung einer ganzen Generation von Frauen, die begannen, ihre eigenen Stimmen zu finden. Ihre Lyrik bewegte sich zwischen Privatem und Politischem, ohne die Grenzen zu respektieren, die die Literaturkritik gerne gezogen hätte.
Differenz und Vielfalt in den Achtzigern
Die 1980er Jahre brachten neue Komplexität in die feministische Literatur. Der Differenzfeminismus betonte bewusst weibliche Räume und Erfahrungen. Gleichzeitig entstanden erste Texte, die Mehrfachzugehörigkeiten thematisierten – ein Vorgriff auf das, was später Intersektionalität genannt werden sollte.
Eine wegweisende Figur dieser Zeit war Elfriede Jelinek, die 1983 mit „Die Liebhaberinnen“ eine radikale Sprachkritik vorlegte. Ihre späteren lyrischen Texte zerlegten systematisch die Strukturen männlicher Sprache und Macht. Jelinek schrieb: „Die Sprache ist das Haus, in dem wir wohnen müssen, aber wir können es umbauen.“
Parallel dazu entwickelte sich in der feministischen Bewegung eine lebendige Subkultur mit eigenen Verlagen, Buchläden und Lesebühnen. Die Zeitschrift „Virginia“ (1976-1987) wurde zur wichtigsten Plattform für feministische Literatur im deutschsprachigen Raum. Hier publizierten etablierte Autorinnen neben Newcomerinnen, hier wurde experimentiert und diskutiert.
May Ayim: Pionierinnenarbeit in mehrfacher Hinsicht
Eine der bemerkenswertesten Stimmen der 1990er Jahre war May Ayim (1960-1996). Als eine der prominentesten Vertreterinnen der Schwarzen Community in Deutschland führten ihre Worte und Werke nicht nur zur Sichtbarmachung von Schwarzen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sondern auch zur Bekanntmachung einer längst verloren geglaubten Geschichte.
Ayims Gedichte verbanden feministische mit antirassistischen Perspektiven und schufen damit etwas in der deutschen Literatur bis dahin Unerhörtes. In ihrem Gedicht „deutschland im herbst“ schreibt sie:
„ich werde trotzdem
afrikanisch
sein
auch wenn ihr es
nicht sehen wollt“
Diese Zeilen markieren einen Wendepunkt in der deutschsprachigen Lyrik. Ayim beanspruchte nicht nur als Frau, sondern als Schwarze deutsche Frau ihren Platz in der Literatur und in der Gesellschaft. Ihre Texte wurden zur Inspiration für eine neue Generation von Autor*innen mit Migrationserfahrung.
Grenzgängerinnen: Sprache zwischen den Welten
Die 1990er Jahre brachten auch Stimmen hervor, die zwischen den Sprachen und Kulturen navigierten. Emine Sevgi Özdamar, geboren 1946 in Malatya/Türkei, heute in Berlin lebend, veröffentlicht seit 1982 Theaterstücke, Gedichte, Romane und Erzählungen und erhielt unter anderem 1991 den Ingeborg-Bachmann-Preis und 2004 den Kleist-Preis.
Özdamars lyrische Sprache changiert zwischen Deutsch und Türkisch, zwischen Bildern des Orients und der deutschen Realität. In ihren Gedichten wird Sprache zum Ort der Grenzüberschreitung. Sie schreibt: „Meine Sprache ist meine Heimat, und meine Heimat ist meine Sprache.“ Damit formuliert sie eine neue Form literarischer Identität jenseits nationaler Kategorien.
Jüngere Stimmen und digitale Räume
Die 2000er Jahre brachten neue Formen und Medien. Slam Poetry und Performance wurden zu wichtigen Ausdrucksformen feministischer Lyrik. Dichterinnen wie Julia Engelmann oder Nora Gomringer eroberten mit ihren Texten nicht nur die Bühnen, sondern auch das Internet. Die Grenzen zwischen Literatur und Aktivismus verschwammen zunehmend.
Safiye Can, eine Stimme der jüngeren Generation, schreibt in ihrem Gedicht „Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung“:
„Frauen, bildet eine Faust!
[…] Die Welt muss lila werden“
Sie knüpft – so scheint mir – bewusst an die Tradition der 1970er Jahre an, transportieren sie aber in die Gegenwart. Can nutzt die symbolische Kraft der Farbe Lila, die seit den 1970er Jahren für feministische Utopien steht, und verbindet sie mit einem neuen, selbstbewussten Tonfall.
Echo und Wirkung: Eine schwierige Bilanz
Die Wirkungsgeschichte feministischer Lyrik im deutschsprachigen Raum ist ambivalent. Einerseits haben die Texte Generationen von Frauen inspiriert und ermutigt. Andererseits blieb ihre Rezeption oft auf feministische Kreise beschränkt. Die großen Literaturgeschichten erwähnen viele der wichtigen Stimmen nur am Rande oder gar nicht.
Besonders deutlich wird dies bei den Autorinnen mit Migrationshintergrund. Während Emine Sevgi Özdamar mittlerweile als wichtige Stimme der deutschsprachigen Literatur anerkannt ist – 2022 erhielt sie den Georg-Büchner-Preis –, sind andere wie May Ayim noch immer weitgehend unbekannt. Ihre Texte werden in Anthologien zur „Migrationsliteratur“ abgelegt, anstatt als integraler Bestandteil der deutschen Literatur gewürdigt zu werden.
Neue Kämpfe, neue Formen
Die feministische Lyrik der Gegenwart kämpft mit anderen Herausforderungen. Die sozialen Medien haben die Verbreitungswege demokratisiert, gleichzeitig aber auch die Aufmerksamkeit fragmentiert. Hashtag-Poesie und Instagram-Lyrik erreichen Millionen, aber ihre Haltbarkeit ist fraglich.
Autorinnen wie Sina Ahadi, Sharon Dodua Otoo oder Mithu Sanyal erweitern das Spektrum feministischer Lyrik um neue Perspektiven. Sie schreiben über Rassismus und Klassismus, über Queerness und Körperlichkeit. Ihre Texte sind oft radikaler und differenzierter zugleich als die ihrer Vorgängerinnen.
Zwischen Kanonkritik und Kanonbildung
Die feministische Lyrik der letzten Jahrzehnte hat nicht nur neue Inhalte in die Literatur gebracht, sondern auch die Frage nach dem literarischen Kanon neu gestellt. Die Anthologie „Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache“ (2020), herausgegeben von Anna Bers, widmet sich in mehr als 500 Gedichten und auf beinahe 900 Seiten der Lyrik von und über Frauen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit weiblicher Dichtung.
Es ging weniger um Abgrenzung, sondern um Ergänzung. Feministische Lyrikerinnen wollten den Kanon nicht zerstören, sondern erweitern. Sie bestehen darauf, dass ihre Stimmen gehört werden – nicht als Nische, sondern als integraler Bestandteil der deutschsprachigen Literatur.
Unabgeschlossen
Die Geschichte der feministischen Lyrik im deutschsprachigen Raum ist noch nicht zu Ende erzählt. Jede Generation bringt neue Stimmen hervor, die auf ihre Weise die Grenzen des Sagbaren erweitern. Von Ingeborg Bachmanns verhaltenen Zweifeln über die lauten Parolen der 1970er Jahre bis hin zu den vielstimmigen Texten der Gegenwart – immer ging es um dasselbe: um die Behauptung des eigenen Rechts zu sprechen.
Diese Lyrik war nie nur Literatur. Sie war immer auch politisches Handeln, Identitätsarbeit, Gemeinschaftsbildung. Sie schuf Räume, in denen andere Geschichten erzählt werden konnten als die, die in den etablierten Verlagen und Feuilletons zu hören waren. Manchmal leise, manchmal laut, aber immer mit dem Anspruch, gehört zu werden.
Die feministische Lyrik der letzten Jahrzehnte hat bewiesen: Literatur kann Welten verändern – eine Zeile nach der anderen, ein Gedicht nach dem anderen, eine Stimme nach der anderen. Sie ist Teil eines größeren Projekts, das noch lange nicht abgeschlossen ist: der Demokratisierung des literarischen Feldes und der Anerkennung der Vielfalt menschlicher Erfahrung in der Kunst.
Anstoß für diese kleine Recherche war das Gedicht von Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
-
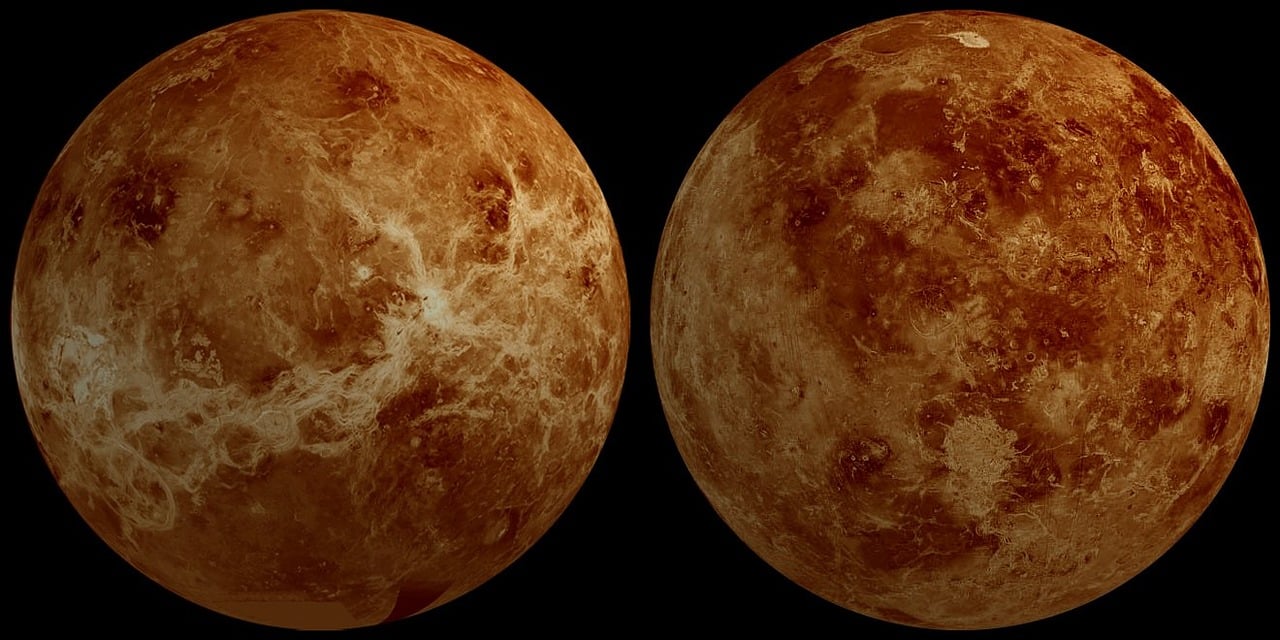
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Ille Chamier – Lied 76
2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
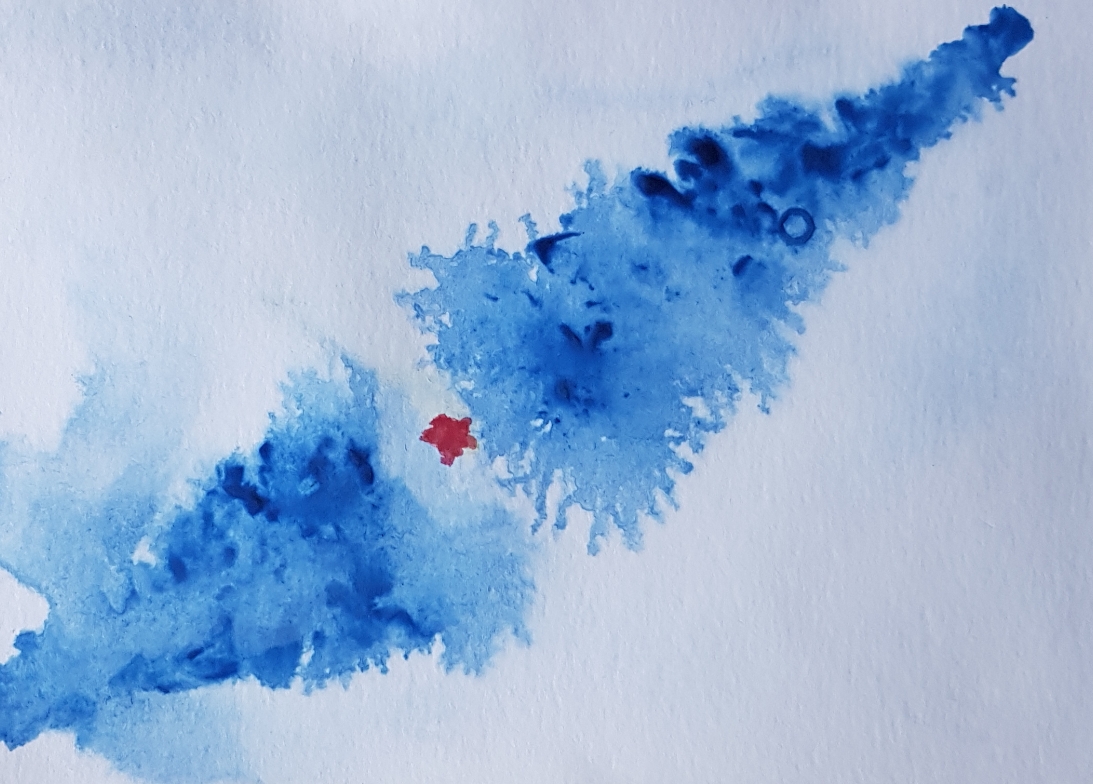
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Körper als Archiv
2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…
-

Annette Hagemann – MEINE ERBSCHAFT IST DIESE
Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
-

David Szalays „Was ein Mann ist“
2–3 MinutenDavid Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär…

