Claude Debussy privat
Claude Debussy war mit den bescheidensten Mitteln ein großer Lebenskünstler. In seinem Arbeitszimmer mussten Sommer wie Winter Blumen stehen. Er konnte in jener Zeit, da er in der Avenue du Bois de Bologne wohnte, nur unter Blumen arbeiten: ihre Farben und Düfte regten ihn an, er brauchte den Zusammenklang dieser Reize, und der Vers von Baudelaire „Les sons et les parfums tournent dans L’air du soir“ war für ihn kein bloßer Spruch. Nicht grundlos schrieb er ihn unter eines seiner Préludes.
In Geldsachen und damit zusammenhängenden materiellen Fragen zeitlebens ein Kind, fehlte ihm die Fähigkeit, praktische Erfahrungen zu machen, und Dinge dieser Art glitten an ihm unerlebt vorbei. Ein schlagendes Beispiel dafür bildet seine einzige Zusammenkunft mit Richard Strauß, von der Durand erzählt. Strauß hatte Durand besucht und nach dem Muster der französischen “Gema“ 1898 die „Genossenschaft deutscher Tonsetzer“ (mit Rösch und Sommer) gegründet. Strauß schrieb nun eines Tages an Debussy, er komme demnächst nach Paris, um einige Konzerte zu dirigieren, und habe den lebhaften Wunsch, bei dieser Gelegenheit Debussy kennenzulernen. Durand übernahm die Vermittlung, und obwohl Debussy damals neue Bekanntschaften eher mied als suchte, sagte er dennoch zu, mit dem Komponisten der „Salome“ zusammenzutreffen. Es kam zu einem intimen Abendessen im Hause Durands, und Strauß, der die erwähnte Genossenschaft eben gegründet hatte und davon noch ganz erfüllt war, sprach darüber mit einem gewissen Stolz zu Debussy. Aber Debussy, dem sogar die Funktionen der französischen Autorengesellschaft ziemlich fremd waren, hörte nur mit halbem Ohr zu und schwieg, während Strauß sprach, und Durand meint, die Zusammenkunft dürfte nicht ganz seinen Erwartungen entsprochen haben.
Debussy war nur Musiker, nichts als Musiker, und das bezeugt auch seine Schrift. Diese herrlich-schön geführte Handschrift, deren Buchstaben eingezeichnet ins Papier sind wie verkappte Noten: immer glaubt man durch die sauberen Zeilen die fünf Linien durchschimmern, immer Noten in Buchstabenform zu sehen.
Wenn er eine Arbeit glücklich beendet hatte, sagte er: “Je crois que c’est assez soi-soi…“, wobei der Ausdruck „soi-soi“ der Kindersprache entlehnt war und so viel bedeutete wie „soigne“, soigniert, sorgfältig gemacht. Oder er sagte, wenn er jemanden tadeln wollte: „Mas is est fou“ statt: „mais i lest fou“. Er zog das I ins a hinein, wodurch der Ausdruck mehr Energie bekam und der Satz so viel bedeutete wie: „Er ist ein ganzer Narr.“ Er sagte dies auch in Gegenwart der so bezeichneten Person, blickte dabei zum Himmel auf, als wollte er ihn zum Zeugen anrufen. „Nichts amüsanter“, erzählt sein Freund René Peter, „als diesen immer soignierten und tiefen Künstler solche Kinderhaftigkeiten aussprechen zu hören, die seinen Lippen manchmal mit einem diabolischen Nebenklang entfielen.“ Er entspannte sich aber damit nach ungeheuren Anspannungen, und war er imstande, eine Partitur mit dem Selbstlob: „soi-soi“ … wegzulegen, so verbarg sih hinter dem „bav-bav!“ (statt brav, brav) eine echte, kindhafte Schamhaftigkeit.
Er liebte auch Kinderbücher über alles. So unter anderem Andersens Märchen, die sein Gehirn wieder „reinfegten“. Er liebte von französischen Dichtern, außer Baudelaire und Verlaine, vor allem Balzac. Seine Herzensneigung gehörte Dickens. Er wurde nicht müde, Charles Dickens zu lesen, der ihm als unfehlbares Gegengift gegen alle Gifte des Lebens galt. Er schwärmte für Herrn Pickwick, für Sam Weller, Herrn Micawber, für Bell, Dora, Agnes, für den kleinen David Copperfield, er stellte Dickens hoch über Thackeray und ärgerte sich über gewisse Engländer, die nicht gleich ihm von ihrem nationalen Dichter entzückt waren. Er verkannte dabei nicht gewisse Schwächen seines Lieblingsautors, darunter die flutende Breite, die ins Zusammenhanglose führte, das „Dècousu“ der Komposition: aber es hinderte ihn nicht, den Roman „Der Antiquitätenladen“ für ein Meisterwerk zu halten. Die Szene, wo der vom Spiel ruinierte alte Händler mit seiner Enkelin Nelly nach dem Dorf zieht, in dem Nelly geboren war, wie sie ankommen und Nelly fühlt, dass sie hier sterben wird und glücklich ist -, das schien ihm eine wunderbare Umkehrung des „Ödipus auf Kolonos“ zu sein. Dieser Dickens-Verehrung entsprang wohl auch seine Humoreske „Hommage a S. Pickwick“ in den Präludien. Die feinen literarischen Welturteile aber, die er überhaupt abgibt und die man vielfach in Peters Erinnerungen findet, lassen die geistige Aufschwungkraft desselben Mannes abschätzen, der im Anfang seiner Laufbahn, mit zwanzig Jahren, noch nicht einmal orthographisch schreiben konnte. Und nun entsteht die Frage: Was ist von Claude Debussy geblieben?
Wir wollen ohne Umschweife antworten und bekennen: So ziemlich alles. Sein Leben war nicht umsonst gelebt, sein Leiden nicht umsonst gelitten. Von Gelegenheitswerken abgesehen, lebt sein Werk sowohl unter dem Namen Debussy wie unter anderen Namen weiter. Und darauf kommt es an: dass eine künstlerische Tat ein fließendes Kulturelement werde, dass seine Spur nicht in Aeonen untergehe.
Bei aller Unverbundenheit und Abgetrenntheit wurde dieser unagilatorische Künstler die Kraftquelle, die die ganze Turbine der modernen Musik speist. Ohne seinen Leugnermut, ohne den Freiheitswillen, mit dem er die alte harmonische Kette abschüttelte, gäbe es keinen Ravel, keinen Florent Schmitt, nicht die Komponistengruppe der „Six“, und obwohl seine Tongebärde keine angreifende Linie besitzt, vielmehr ihren Duktus der Arabeske entnimmt und zuletzt mit einer gewissen Menschenscheu in die eigene Höhle zurück flüchtet, hat Debussys Wesen doch ganz andersgeartete Künstler wie Giacomo Puccini und Richard Strauß befruchtet: der eine gewann aus Debussys Schatzhöhle die dreisten Dreiklangsfolgen und unverbundenen Nonakkordreihen, der andere die Ganztonleiter, und selbst ein Meister wie Max Reger, bachisch dem Ursprung nach, wird in der „Böcklin-Suite“ debussystisch. Die Verführung durch den Impressionismus ergriff auch die Wiener Schule, und ein großer Teil der Jungwiener Komponisten wurde auf dem Weg über Joseph Marx und Franz Schrecker zu Debussysten. Er wirkte, ohne wirken zu wollen. Und man kann sagen: er glich dem heiligen Sebastian, der zum neuen Glauben überredete nicht durch Predigten, sondern bloß durch den Pfeil, den er gegen Himmel schoss, und der nicht wiederkehrte…“
Zwei Sammlungen von Debussy suche ich noch:
- „Monsieur Croche – Antidilettante“: Eine Sammlung von Essays, Kritiken und Gedanken über Musik, die Debussy unter dem Pseudonym Monsieur Croche verfasste. Hier zeigt sich seine oft scharfzüngige und eigenwillige Sicht auf die Musikwelt.
- Seine Briefe: Es gibt verschiedene Sammlungen von Briefen, in denen er sich über seine Musik, sein Leben und seine Zeitgenossen äußert. Eine der bekanntesten ist „Claude Debussy: Correspondance 1872–1918“, herausgegeben von François Lesure und Denis Herlin.


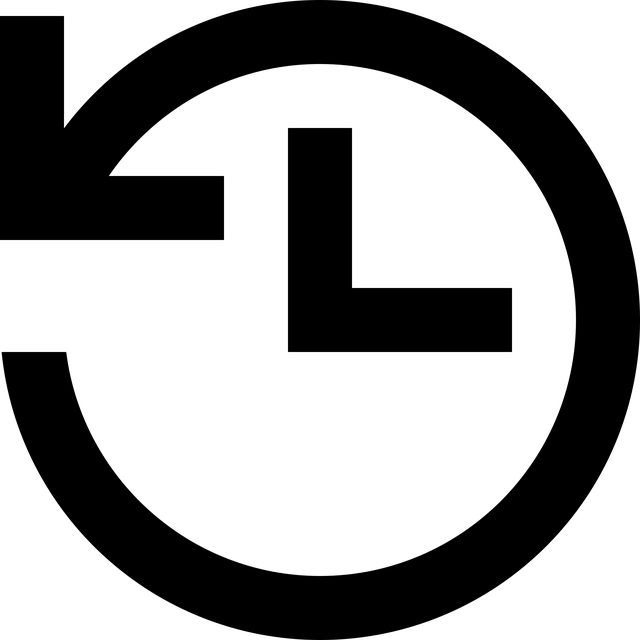
Schreibe einen Kommentar