Bei der Lektüre von John Bergers und Jean Mohrs Eine andere Art zu erzählen stellte sich mir eine Frage: Gibt es Literatur, die überwiegend aus Fotografien besteht – ähnlich wie Comics oder Graphic Novels ihre Geschichten in Bildern erzählen? (Damit meine ich nicht die Foto-Love-Story aus der Bravo die ich in meiner Jugend nicht las.)
Die Antwort: Ja, und zwar in einer bemerkenswerten Vielfalt von Formen und Traditionen, die von Kitsch bis Hochkunst reichen.
Der Fotoroman: Populäre Bilderzählungen
Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Format: dem Fotoroman oder der Photo Novel. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien als „fotoromanzo“ entstanden, eroberte diese Form in den 1950er bis 1970er Jahren ganz Europa und Lateinamerika. Ähnlich wie Comics präsentieren Fotoromane ihre Geschichten in Panels mit Sprechblasen und Texteinschüben. Meist erzählten sie melodramatische Liebesgeschichten und galten später als trivial – doch ihre kulturelle Bedeutung war immens. Sie machten visuelle Narrationen für ein breites Publikum zugänglich.
In Lateinamerika entwickelte sich daraus die Fotonovela, die oft sozialkritische oder didaktische Themen aufgriff und sogar für Aufklärungskampagnen zu Gesundheit und Politik eingesetzt wurde. Hier zeigte sich bereits, was Fotos von Zeichnungen fundamental unterscheidet: ihre dokumentarische Kraft, ihr Anspruch „das war wirklich da“.
Das narrative Fotobuch als Kunstform
Ganz anders verhält es sich mit dem künstlerischen Fotobuch, in dem die Abfolge der Bilder selbst zur Erzählung wird – oft mit minimalem oder ganz ohne begleitenden Text. Robert Franks The Americans von 1958 gilt hier als Meilenstein: Seine Reise durch die USA wird allein durch die Sequenz der Fotografien zur Erzählung über ein Land und seine Menschen.
W. Eugene Smiths Minamata (1975) dokumentiert die tragische Geschichte einer Quecksilbervergiftung in Japan und zeigt, wie Fotografie gleichzeitig bezeugen und anklagen kann. Duane Michals entwickelte kurze Fotosequenzen von sechs bis zwölf Bildern, die wie visuelle Kurzgeschichten funktionieren, manchmal ergänzt durch handgeschriebene Textfragmente.
Zwischen Autobiografie und Politik
Heute arbeiten Künstlerinnen und Künstler wie Sophie Calle an der Schnittstelle von Fotografie und Autobiografie, untersuchen Intimität und Überwachung. Taryn Simon schafft narrative Fotoserien zu politischen Themen. Jim Goldbergs Raised by Wolves (1995) kombiniert seine Aufnahmen obdachloser Jugendlicher mit deren eigenen Notizen und Zeichnungen – ein vielstimmiges visuelles Dokument.
Besonders bemerkenswert ist Chris Markers La Jetée (1962): Technisch ein Film, besteht er fast vollständig aus Standbildern und erzählt eine Science-Fiction-Geschichte von betörender Intensität. Gerade die Unbeweglichkeit der Bilder erzeugt hier die narrative Spannung.
Neue Wege, alte Fragen
Nach Jahren der Vernachlässigung findet das Erzählen mit Fotos wieder neue Formen. Zines und Independent-Publishing-Projekte experimentieren mit fotografischen Erzählweisen. Social Media hat Möglichkeiten sequenzieller Bildgeschichten geschaffen, die vor zwanzig Jahren undenkbar waren. Die Grenzen zwischen Dokumentation und Inszenierung, zwischen Realität und Fiktion verschwimmen zunehmend – durch digitale Manipulation, durch konzeptuelle Ansätze, durch KI.
Künstler wie Ed Ruscha zeigten schon früh, wie radikal minimalistisch solche Narrationen sein können: Sein Twentysix Gasoline Stations (1963) präsentiert einfach 26 Fotos von Tankstellen – und erzählt gerade dadurch von Amerikas Straßenkultur und Konsumgesellschaft.
Der entscheidende Unterschied
Was Foto-Literatur von Graphic Novels oder Comics grundsätzlich unterscheidet, ist die fotografische Evidenz: Ein Foto behauptet immer „das war wirklich da“, während eine Zeichnung reine Imagination sein kann. Diese veränderte Lesart prägt unser Verhältnis zur Geschichte – wir glauben Fotografien anders als Zeichnungen, auch wenn wir heute wissen, dass auch Fotos inszeniert, manipuliert und konstruiert sein können.
Für Fans von Berger und Mohr
Wer sich von John Bergers und Jean Mohrs Arbeit inspirieren lässt, findet verwandte Ansätze bei Nan Goldin, deren The Ballad of Sexual Dependency (1986) ein zutiefst persönliches, autobiografisches Fotobuch ist – narrativ, emotional, schonungslos. Oder bei Gilles Peress‘ Telex Iran (1984), das die iranische Revolution wie ein visuelles Tagebuch dokumentiert.
Diese Werke zeigen: Fotografie kann Literatur sein, kann erzählen, bezeugen, erfinden. Die Geschichte der Foto-Literatur ist die Geschichte unseres Verhältnisses zur Wirklichkeit selbst – und zur Frage, wie wir sie in Bildern festhalten und weitergeben können.
Selbst beginnen?
Mich beschäftigt der Gedanke, ob man so etwas nicht auch selbst versuchen könnte. Nicht als professionelles Projekt, sondern als Experiment: Was würde passieren, wenn ich eine Woche lang täglich drei Fotos machte, die zusammen eine Geschichte ergeben? Welche Geschichte würde sich zeigen – eine, die ich plane, oder eine, die sich erst im Prozess offenbart?
Oder anders: Müsste man überhaupt selbst fotografieren? Ed Ruscha hat gefundene, banale Tankstellen-Fotos zur Kunst erklärt. Könnte man nicht auch mit dem eigenen Fotoarchiv arbeiten, es neu ordnen, neu lesen? Welche unerwarteten Narrative schlummern in den hunderten Handyfotos, die wir alle unbewusst ansammeln?
Und die Frage nach dem Text: Braucht es Worte, oder würde Text die Bilder einschränken? Duane Michals hat manchmal handgeschriebene Sätze hinzugefügt – aber wann unterstützt Text, wann stört er? Vielleicht liegt gerade in dieser Unsicherheit der Reiz: auszuprobieren, wo die Grenze zwischen zu viel und zu wenig verläuft.
Was mich am meisten interessiert: Verändert sich der eigene Blick, wenn man anfängt, in Sequenzen zu denken statt in Einzelbildern? Sieht man die Welt anders, wenn man nach dem nächsten Bild einer Geschichte sucht, die noch nicht zu Ende erzählt ist?
-

Am Zweig
1–2 MinutenAm Zweig die Feder, klein, wiegt sich. Wildschweinschwärze aus dem Erdreich, beißt in die Nase. Mein weißer Hund im Schnee – fast weg. Foto: Oliver Simon
-

Wenn das Licht den Raum gibt
3–5 MinutenAm frühen Morgen sah ich im Garten eine vertrocknete Stockrose stehen, unbewegt, unbeirrt. Ein Zimmerlicht fiel schräg von außen auf ihr verblasstes Kleid, und plötzlich wirkte sie nicht mehr ausgebrannt, sondern strahlend. Dieses Strahlen entstand nicht aus der Pflanze selbst, sondern im Zusammenspiel von Körper, Licht und Blick: ein Raum wurde ihr gegeben, und sie…
-

Eine andere Art zu erzählen – John Berger und Jean Mohr
3–4 MinutenEs gibt Bücher, die man liest, und es gibt Bücher, mit denen man arbeitet. „Eine andere Art zu erzählen“ gehört zur zweiten Kategorie. John Berger, der britische Schriftsteller und Kunstkritiker, und Jean Mohr, der Schweizer Fotograf, haben 1982 etwas geschaffen, das sich zwischen Essay, Bildband und Experiment bewegt – ein Buch, das die Frage stellt:…
-

Literatur aus Fotografien
3–5 MinutenBei der Lektüre von John Bergers und Jean Mohrs Eine andere Art zu erzählen stellte sich mir eine Frage: Gibt es Literatur, die überwiegend aus Fotografien besteht – ähnlich wie Comics oder Graphic Novels ihre Geschichten in Bildern erzählen? (Damit meine ich nicht die Foto-Love-Story aus der Bravo die ich in meiner Jugend nicht las.)Die…
-
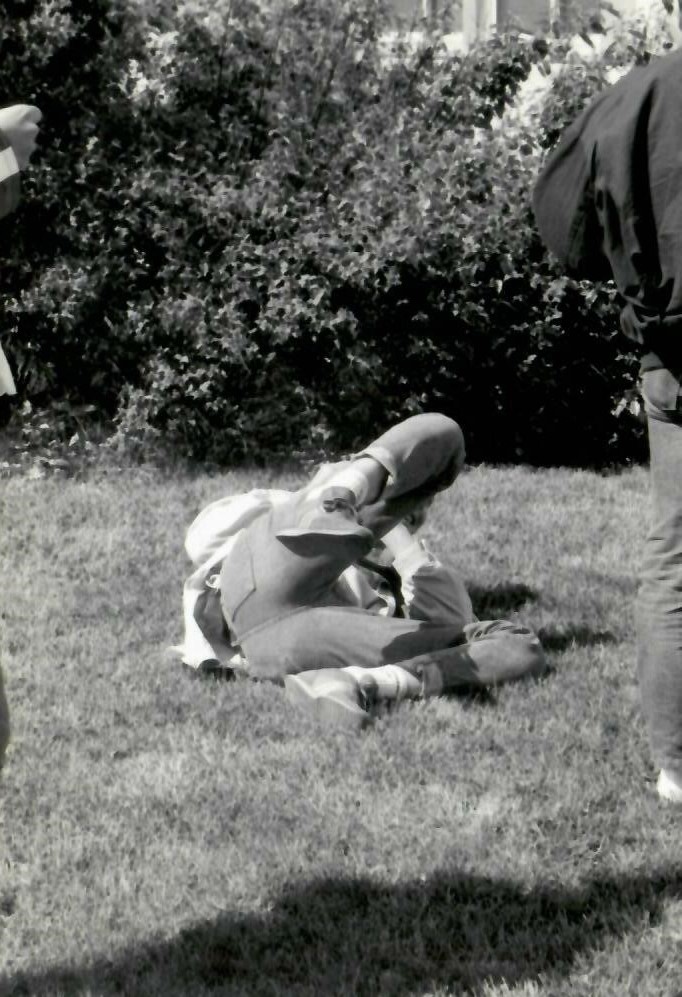
Katia Tangians Barsik
2–3 MinutenKatia Tangians Cover für diese Ausgabe zeigt ein Foto aus den Achtzigern: ein Mann, der grimassiert, im Hintergrund Teile einer Stereoanlage. Ein Schnappschuss, wie es ihn tausendfach gibt. Der Text, der das Bild umfließt, erzählt von Barsik – einem Kater, der in der Nachbarschaft als bösartiges Mistvieh galt und ständig mit den anderen Katern auf…
