Loulou Omers Gedicht „EINS UND NOCH EINS“ aus dem Band Was es bedeuten soll. Neue hebräische Gedichte in Deutschland (parasitenpresse 2019, S.100) verbindet introspektive Reflexion mit metaphorischer Sprache, um zentrale Themen wie Identität, menschliche Verbindungen und die Suche nach Authentizität zu erkunden. Formal bricht das Gedicht mit Konventionen: Auf den mathematisch-nüchternen Titel, der Wiederholung oder die Addition von Erfahrungsfragmenten symbolisieren könnte, folgen reimlose, fragmentarische Sätze und abrupte Gedankensprünge. Diese Form spiegelt möglicherweise die Zerbrechlichkeit oder Zersplitterung von Identität wider.
Die vielschichtige Bildsprache vermischt scheinbar Gegensätzliches: Ein Teddybär und ein Herz stehen neben mathematischen Gleichungen. Diese Kontrastierung von Kindlich-Emotionalem mit Rational-Abstraktem verweist auf Schutzmechanismen und die Spannung zwischen emotionalem Bedürfnis und rationaler Distanz. Thematisch steht die Identität im Vordergrund, insbesondere die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdwahrnehmung. Die Zeile „mein Name kommt, zweifellos, ohne mich voran“ deutet an, dass die Identität der Sprecherin von äußeren Zuschreibungen losgelöst existiert – vielleicht sogar als „etwas woran niemand rüttelt – eine Art Wahrheit“. Dies lässt sich als Kommentar zu gesellschaftlichen Projektionen lesen, etwa zur Wahrnehmung jüdischer Identität in Deutschland als scheinbar unantastbare Kategorie.
Damit eng verknüpft ist das Thema Kontakt und Isolation. Das „Knüpfen von Kontakten“ erscheint als erlernte, fast mechanische „Selbstverständlichkeit“, was auf Oberflächlichkeit oder das Gefühl hinweist, Beziehungen performen zu müssen. Gleichzeitig schützt sich die Sprecherin durch das „Ausblenden der Anderen“ und die Umarmung des Teddys – Symbole für kindliche Sicherheit und emotionale Abgrenzung. Dieser Konflikt zwischen Wahrheit und Schutzmechanismen wird auch in den mathematischen Formeln („zwei und noch mal zwei sind fast vier“) deutlich. Sie stehen für rationale Klarheit, wirken jedoch „ohne Umarmung“ kalt und unvollständig. Die angestrebte „Wahrheit, die für sich steht“ könnte eine schmerzhafte, illusionslose Realität bedeuten.
Der biografische und historische Kontext von Loulou Omer als jüdischer Autorin in Deutschland ist für dieses Gedicht bedeutsam. Es lässt sich als Auseinandersetzung mit diasporischer Identität lesen: Der Name, der „sich verbreitet“ und „niemanden stört“, könnte auf die Sichtbarkeit von Jüd:innen in Deutschland verweisen, die oft als „Symboltragende“ wahrgenommen werden, während ihr individuelles Selbst komplexer ist. Die Ambivalenz zwischen Kontaktsuche („Teil interessiert sich für mich“) und Rückzug spiegelt den Spagat zwischen Integration und Selbstschutz in einer Gesellschaft mit antisemitischen Untertönen. Der Teddybär als Trostobjekt könnte zudem auf generationenübergreifende Traumata anspielen – eine kindliche Unschuld, die von historischer Last überschattet wird.
Insgesamt handelt das Gedicht von existenzieller Selbstbehauptung. Die fast mantrahaft wirkenden Zeilen „gar nicht so üble Existenz / sogar mehr als das, echt“ wirken wie ein Versuch, das eigene Dasein gegen äußere Abwertung oder innere Zweifel zu validieren. Das Bekenntnis „Schöpferisch bin“ deutet auf künstlerisches Schaffen als Mittel des Widerstands, besonders aus einer marginalisierten Position. Die durchgängige Spannung zwischen Rationalität (Mathematik, gesellschaftliche Erwartungen) und emotionaler Vulnerabilität (Teddy, Umarmung) unterstreicht die Suche nach einem authentischen Selbst im Spannungsfeld äußerer Zuschreibungen und inneren Erlebens. Omers Gedicht oszilliert so beständig zwischen Verletzlichkeit und analytischer Distanz. Der Teddybär steht dabei symbolisch für notwendigen Trost und Schutzräume, während die mathematischen Metaphern die Sehnsucht nach Eindeutigkeit in einer komplexen, oft widersprüchlichen Welt ausdrücken.
-

Volkmar Mühleis – VON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN
1–2 MinutenVON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN hunderte von Seiten lang durch die Pariser Vorstädte zurück in Büchners Zeit über Gedichte hinter dem Eisernen Vorhang mitten durch ein Ideen-Gewimmel aus Reiselust einen Blick auf Rom werfen, um wieder bei einer Tasse Tee den Vögeln zu lauschen, Nachbarn in ihrem Kommen und Gehen, auf dem Sofa, das…
-

Von einem Buch zum andern übersetzen
1–2 MinutenEin Dank an Volkmar Mühleis für die Inspiration – Gelesen habe ich sein Gedicht „Von einem Buch zum andern wandern“ in Ausgabe 44 der WORTSCHAU. Es beschreibt Lesen als müheloses Bewegen durch Welten, als Genuss auf dem Sofa, das einem die Welt bedeutet. Ich habe ein anderes Lesen gelernt – eines, das nicht wandert, sondern…
-

Sirius / Hundstage
1–2 Minuten1 069 000 Sonnenweiten entferntstrahlt er, der hellste Sternim Sternbild des großen Hundes.16,9 Jahre braucht sein Lichtbis hierher. Vierzehn Sonnenließen sich aus seiner Masse formen. Die Ägypter warteten auf ihn,ungeduldig, denn sein Erscheinenin der Morgendämmerung bedeutete:der Nil wird steigen, der Segen kommt. In Griechenland bezeichnetesein Wiederauftauchen am Osthimmeldie Opora – Obst und Wein reiften,doch Hippokrates…
-

Wisława Szymborska – Die Gedichte
1–2 Minuten„… Um die Dichter steht es schlechter. Ihre Arbeit ist hoffnungslos unfotogen. Da sitzt jemand am Tisch oder liegt auf dem Sofa, starrt unablässig an die Wand oder die Decke, schreibt von Zeit zu Zeit sieben Zeilen, von denen er nach einer Viertelstunde eine streicht, und wieder vergeht eine Stunde, und es geschieht nichts… Welcher…
-

Jane Wels – Lilith
3–4 MinutenEin Gedicht von Jane Wels – auf Instagram von ihr geteilt – fragt nach einem Raum, in dem Sprache nicht mit Worten angefüllt ist. Das ist keine rhetorische Frage. Es ist eine, die Widerstand leistet gegen schnelle Antworten. Eine Annäherung. Die naheliegende Versuchung wäre, das Gedicht inhaltlich aufzulösen – aber bei Jane Wels funktioniert der…
-

Am Zweig
1–2 MinutenAm Zweig die Feder, klein, wiegt sich. Wildschweinschwärze aus dem Erdreich, beißt in die Nase. Mein weißer Hund im Schnee – fast weg. Foto: Oliver Simon
-
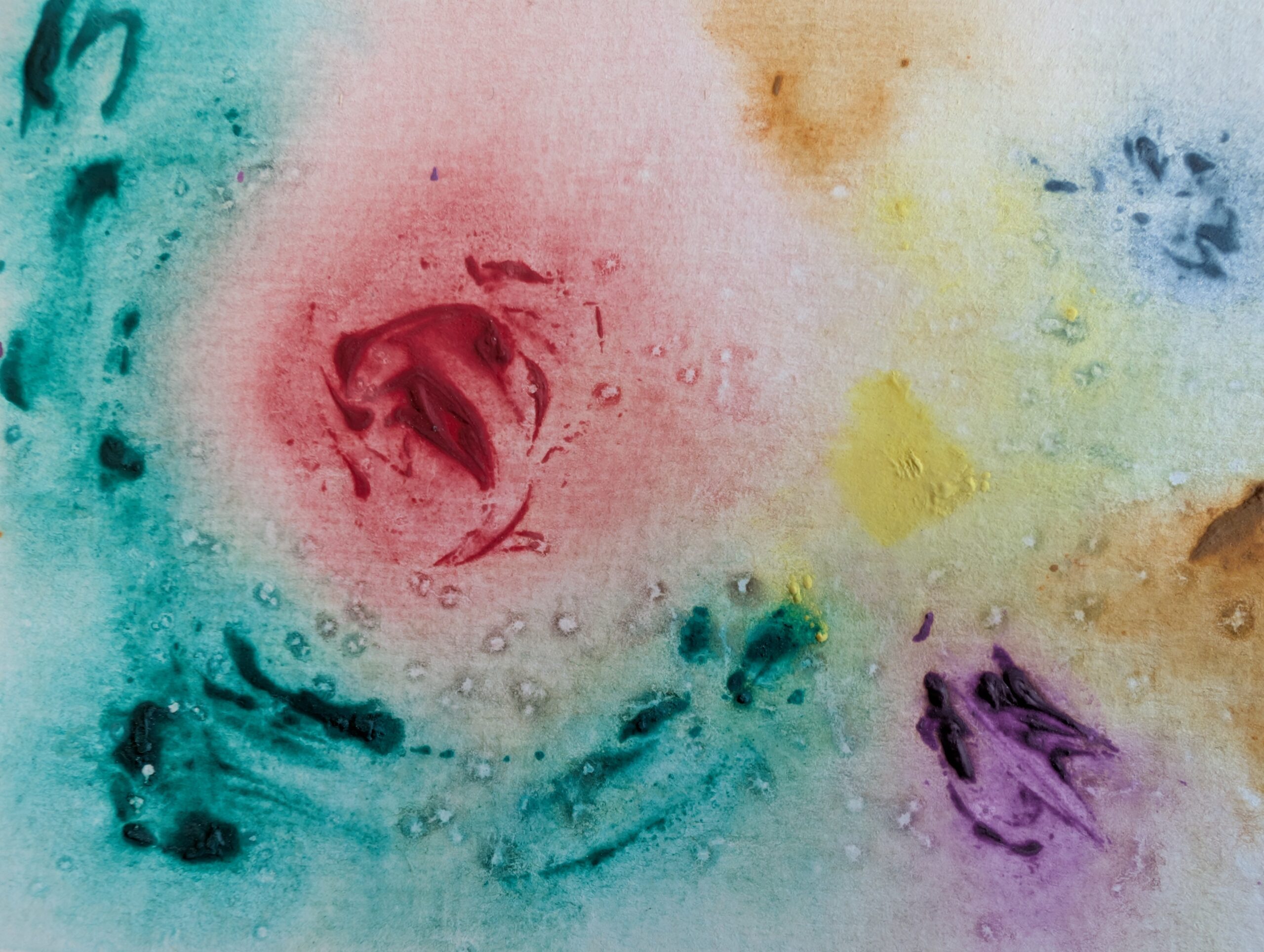
Udo Degener – Miklós Radnóti (1909–1944)
2–3 MinutenWer war Miklós Radnóti. Miklós Radnóti wurde 1909 in Budapest geboren, jüdischer Herkunft, ungarischer Dichter. Er schrieb früh, studierte Literatur, bewegte sich bewusst in der ungarischen Sprach- und Formtradition. In den 1930er Jahren wurde sein Leben zunehmend durch antisemitische Gesetze bestimmt. Er durfte nicht mehr regulär publizieren, wurde zu sogenannten Arbeitsdiensten eingezogen, also Zwangsarbeit ohne…
-

Udo Degener – Meine Gedichte sind
1–2 MinutenDer Text setzt mit einer Wiederholung ein. Jede Zeile beginnt gleich, und doch verschiebt sich der Gegenstand fortlaufend. „Meine Gedichte sind“ markiert keinen festen Besitz, sondern einen Ort, an dem immer wieder neu angesetzt wird. Die Gedichte werden nicht erklärt, sondern in Umlauf gebracht. Zunächst tauchen sie als Material auf: Schreibmaschinenpapier, eine genaue Sorte, versehen…
-

Nathalie Schmid: der geschmack von kartoffeln
3–4 MinutenNathalie Schmids Gedicht „der geschmack von kartoffeln“ porträtiert „einen schlag von frauen“ durch eine Collage körperlicher und alltäglicher Details, die auf den ersten Blick schlicht dokumentarisch wirken. Doch zwischen den Zeilen entfaltet sie eine Dichte, die mich bekümmert: ein Leben, das nur noch rückblickend Bedeutung hat. Verschlossene Innenwelten Die Frauen des Gedichts zeigen sich in…
-

Jane Wels – Bitte versuchen sie, …
3–5 MinutenAnnähernd gelesen | Zwischen Sprache, Ordnung und AuflösungJane Wels‘ Gedicht „Bitte versuchen Sie,“ ist ein Text über die Unmöglichkeit, gefasst zu werden – und zugleich ein Text, der sich selbst beim Versuch des Fassens beobachtet. Es spielt mit der Spannung zwischen Sprache und Identität, zwischen Ordnung und Auflösung, und ist dabei zugleich selbstreflexiv, ironisch und…
-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee
3–4 MinutenAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…
-

Martin Maurach – Fünf Fragmente, fünf Türen
2–4 MinutenMartin Maurach: Leben auf Geistes Schneide | Annähernd gelesen Fünf Zeilen die nicht als Gedicht nebeneinander stehen, sondern als ausgewählte Fragmente aus einer größeren Sammlung. Martin Maurach hat mir dankenswerterweise zur Entstehung geschrieben: Die Redaktion der „Konzepte“ hat aus seinen Prosafragmenten diese fünf ausgewählt und montiert. Der Text ist damit weniger als geschlossene Einheit zu…
-

Wenn Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein
4–6 MinutenÜber Kathrin Niemelas „pont des arts“ | Kathrin Niemelas Gedicht „pont des arts“ erschien in der Literaturzeitschrift Wortschau in einer Paris-Ausgabe. Es ist ein Text, der sich beim ersten Lesen entzieht – nicht weil er hermetisch wäre, sondern weil er so verdichtet ist, dass man ihn kaum greifen kann. Die Sprache ist präzise, die Klänge…
-

Maria Arimany – In den Wald muss man gehen, wenn es noch dunkel ist
in Lyrik3–5 MinutenMaria Arimanys Gedicht trägt einen vielversprechenden Titel: „In den Wald muss man gehen, wenn es noch dunkel ist“. Diese Idee birgt etwas Spannendes, fast Initiatisches – der Gang in die Dunkelheit als bewusste Entscheidung, als Schwelle zu einer anderen Wahrnehmung. Das Gedicht | Das Werk besteht aus zwei Spalten mit teils verrückten Zeilenumbrüchen. Die Autorin…
-

Annette Hagemann: ARTIST
3–5 MinutenDer Künstler als Versuchsanordnung und Schaustück? Auf den ersten Blick scheint Annette Hagemanns Gedicht ARTIST ein feines, fast ehrfürchtiges Porträt eines schöpferischen Menschen zu sein – eines, der sich einen Raum erbittet, um seine Arbeit zu tun: „Du hattest um den Geheimnisraum gebeten, das Innere des Turms ein leuchtender Lichthof …“ Ein Bild der Sammlung,…
-

Linda Gundermann: „Bindungsstil“ – Wenn Psychologie auf Herzschmerz trifft
3–4 MinutenManchmal landet man durch Zufall bei einem Lied, das einen nicht mehr loslässt. Bei mir war es eine Recherche zu Grit Lemkes Kinder von Hoy, die mich über den Singeklub Hoyerswerda zu Gundi und schließlich zu ihrer Tochter Linda Gundermann führte. Ihr Lied „Bindungsstil“ ist mir dabei begegnet – und ich höre es seitdem immer…
-
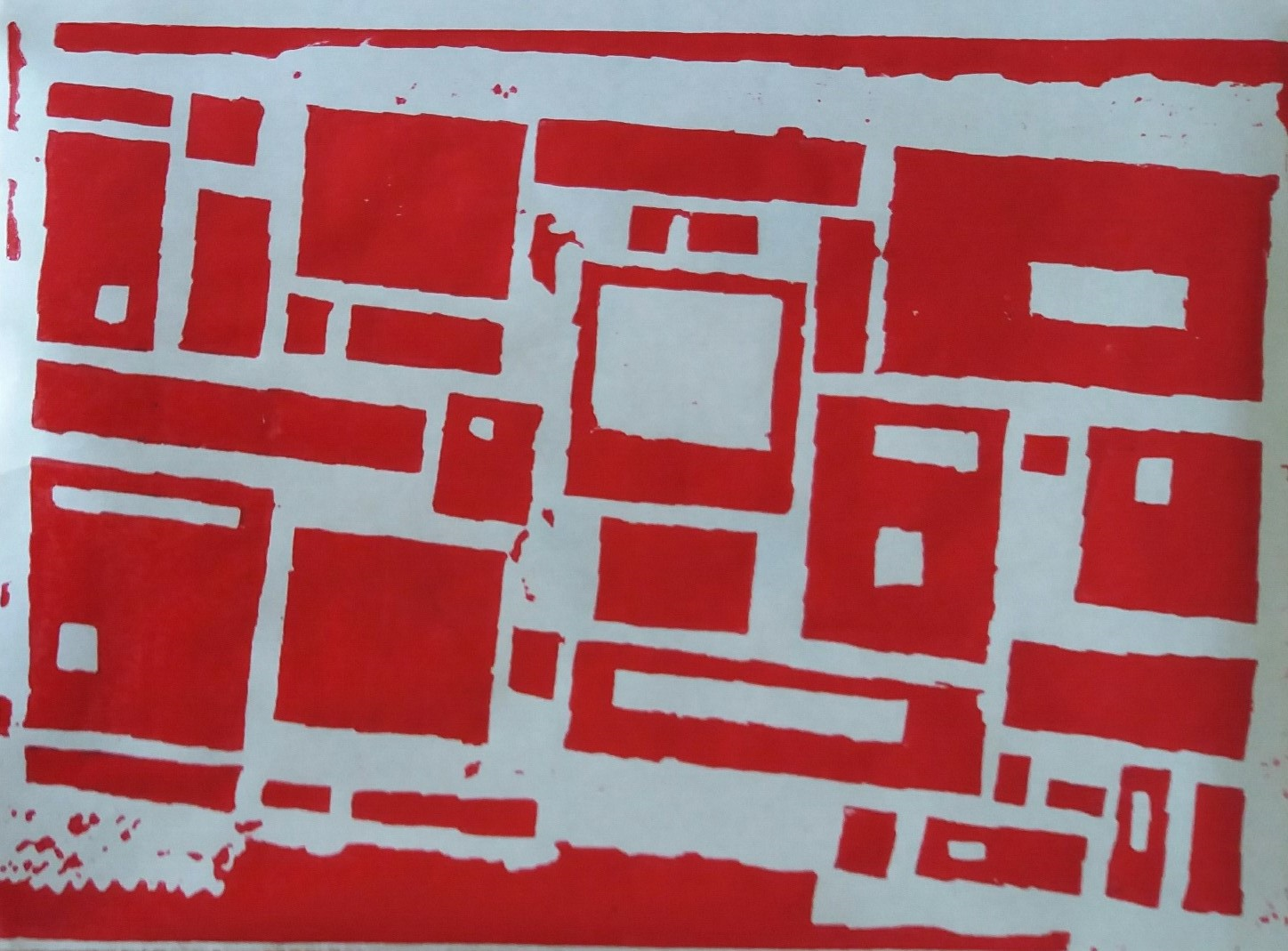
Die Gedanken sind frei
3–5 MinutenDie Gedanken sind frei – ein Lied, das zu oft als Beruhigungspille missbraucht wurde. Während Diktaturen Menschen einsperrten, sangen diese von ihrer inneren Freiheit, statt die äußeren Ketten zu sprengen. Diese Ambivalenz macht das Lied gefährlich und kraftvoll zugleich. Die Unzerstörbarkeit als Problem | Das Lied verkörpert eine jahrhundertealte Idee: die Unzerstörbarkeit der Gedanken- und…
-

