Vor der Lektüre | Das Buch besteht aus sechs Kurzgeschichten, die verschiedene Aspekte des Verschwindens umkreisen. Laut Klappentext sammelt Sandig darin Geschichten von Menschen, deren Erzählungen verloren zu gehen drohen. Es geht um Erinnerung, um Migration, Flucht, Verlust. Die Texte arbeiten mit verschiedenen Formen – Lyrik, Prosa, dokumentarische Passagen – und folgen keiner durchgehenden Erzählung.
Ein Satz aus dem Buch hat mich dabei besonders aufhorchen lassen: „Es gibt Dinge von so unwahrscheinlicher Natur, dass die Leute sie einfach nicht glauben. Das stimmt nicht, sagen sie dann, als wären sie dabei gewesen. Aber sie waren nicht dabei und können es nicht wissen. Schreibt man diese unwahrscheinlichen Dinge aber auf und nennt sie eine Geschichte, dann glauben die Leute alles.“
Ulrike Almut Sandig, geboren 1979 in Großenhain, ist Lyrikerin und Klangkünstlerin. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert und ist bekannt für ihre experimentelle Arbeit mit Sprache. Das ist mein erstes Buch von ihr.
Was mich reizt: Was genau soll hier nicht verschwinden? Und wie schreibt man dagegen an? Die Frage, wie man Geschichten bewahrt, wenn sie keinen selbstverständlichen Platz mehr haben. Und wie sich sechs unterschiedliche Annäherungen an das Thema Verschwinden lesen werden.
Annähernd gelesen
„am elften Dezember 2117 zieht die Venus wieder als blinder Fleck vor der Sonne vorüber, so haben es Forscher berechnet.“
Mit diesem Satz eröffnet Ulrike Almut Sandig den titellosen Text, der ihrem Erzählband ‚Buch gegen das Verschwinden‘ vorangestellt wurde.
Diese wissenschaftliche Tatsache wird mit persönlicher Zeit verknüpft. Die Erzählerin denkt voraus: Weder sie selbst, noch ihr Gegenüber, noch das ungeborene Kind werden dann noch leben. Die dreifache Verneinung – „du nicht mehr da“, „ich auch nicht mehr da“, „das Kind […] auch gar nicht mehr da“ – ist unausweichlich in ihrer Klarheit. So entsteht eine still abgewogene Perspektive auf Vergänglichkeit, die das Ende individueller Existenz im Kontrast zur berechenbaren Wiederkehr eines Naturereignisses zeigt.
Doch dem Verschwinden des Persönlichen steht ein anonymes „man“ gegenüber: „man wird im Freien stehen“, „man wird […] entgegensehen“. Während die konkreten Personen vergehen, bleibt die Menschheit als Kontinuum – nicht als Trost, sondern als nüchterne Einsicht. Es wird jemand da sein, der schaut, der staunt, der erkennt. Das ist die stille Hoffnung des Textes: nicht persönliches Überdauern, sondern die Fortdauer des menschlichen Blicks selbst.
Gleichzeitig verweist das Wort Sonnabend auf sprachlichen Wandel. Vielleicht, so heißt es, werde man dieses Wort bis dahin gar nicht mehr benutzen. Damit weitet sich das Thema des Verschwindens von der körperlichen auf die sprachliche Ebene – Erinnerung, Ausdrucksformen, Benennungen verändern sich oder gehen verloren.
Formal unterstützt die konsequente Kleinschreibung nach Punkten diese Kontinuität: Es gibt keine hierarchischen Neuanfänge, keine Unterbrechung. Die Sätze schließen sich nicht ab, sondern fließen ineinander – wie die Zeit selbst, die nicht neu beginnt, nur weitergeht. Die Orthografie ist ansonsten eingehalten, was die Geste umso präziser macht: ein gezielter, asketischer Eingriff an genau der Stelle, wo traditionell Autorität und Neuordnung sitzen.
Am Ende öffnet der Doppelpunkt den Text auf das Wesentliche hin: „einen fast unsichtbaren, pechschwarzen Punkt.“ Er ist eine Geste des Zeigens, des Weitens. Nach all dem Verschwinden bleibt das Bild des Venustransits – ein Zeichen dafür, dass etwas verschwindet und zugleich sichtbar bleibt. Als Eingangstext steht das Gedicht programmatisch für das Buch: Es richtet sich gegen das Vergessen, indem es benennt, was einmal war und was künftig fehlen wird.
Fortsetzung folgt…
Bibliografische Angaben:
Ulrike Almut Sandig – Buch gegen das Verschwinden
Schöffling & Co., Frankfurt am Main – 2015
168 Seiten
ISBN 978-3-89561-464-8
-

Volkmar Mühleis – VON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN
1–2 MinutenVON EINEM BUCH ZUM ANDERN WANDERN hunderte von Seiten lang durch die Pariser Vorstädte zurück in Büchners Zeit über Gedichte hinter dem Eisernen Vorhang mitten durch ein Ideen-Gewimmel aus Reiselust einen Blick auf Rom werfen, um wieder bei einer Tasse Tee den Vögeln zu lauschen, Nachbarn in ihrem Kommen und Gehen, auf dem Sofa, das…
-

Von einem Buch zum andern übersetzen
in Lyrik1–2 MinutenEin Dank an Volkmar Mühleis für die Inspiration – Gelesen habe ich sein Gedicht „Von einem Buch zum andern wandern“ in Ausgabe 44 der WORTSCHAU. Es beschreibt Lesen als müheloses Bewegen durch Welten, als Genuss auf dem Sofa, das einem die Welt bedeutet. Ich habe ein anderes Lesen gelernt – eines, das nicht wandert, sondern…
-

Sirius / Hundstage
1–2 Minuten1 069 000 Sonnenweiten entferntstrahlt er, der hellste Sternim Sternbild des großen Hundes.16,9 Jahre braucht sein Lichtbis hierher. Vierzehn Sonnenließen sich aus seiner Masse formen. Die Ägypter warteten auf ihn,ungeduldig, denn sein Erscheinenin der Morgendämmerung bedeutete:der Nil wird steigen, der Segen kommt. In Griechenland bezeichnetesein Wiederauftauchen am Osthimmeldie Opora – Obst und Wein reiften,doch Hippokrates…
-

Wisława Szymborska – Die Gedichte
1–2 Minuten„… Um die Dichter steht es schlechter. Ihre Arbeit ist hoffnungslos unfotogen. Da sitzt jemand am Tisch oder liegt auf dem Sofa, starrt unablässig an die Wand oder die Decke, schreibt von Zeit zu Zeit sieben Zeilen, von denen er nach einer Viertelstunde eine streicht, und wieder vergeht eine Stunde, und es geschieht nichts… Welcher…
-

Jane Wels – Lilith
3–4 MinutenEin Gedicht von Jane Wels – auf Instagram von ihr geteilt – fragt nach einem Raum, in dem Sprache nicht mit Worten angefüllt ist. Das ist keine rhetorische Frage. Es ist eine, die Widerstand leistet gegen schnelle Antworten. Eine Annäherung. Die naheliegende Versuchung wäre, das Gedicht inhaltlich aufzulösen – aber bei Jane Wels funktioniert der…
-

Am Zweig
1–2 MinutenAm Zweig die Feder, klein, wiegt sich. Wildschweinschwärze aus dem Erdreich, beißt in die Nase. Mein weißer Hund im Schnee – fast weg. Foto: Oliver Simon
-
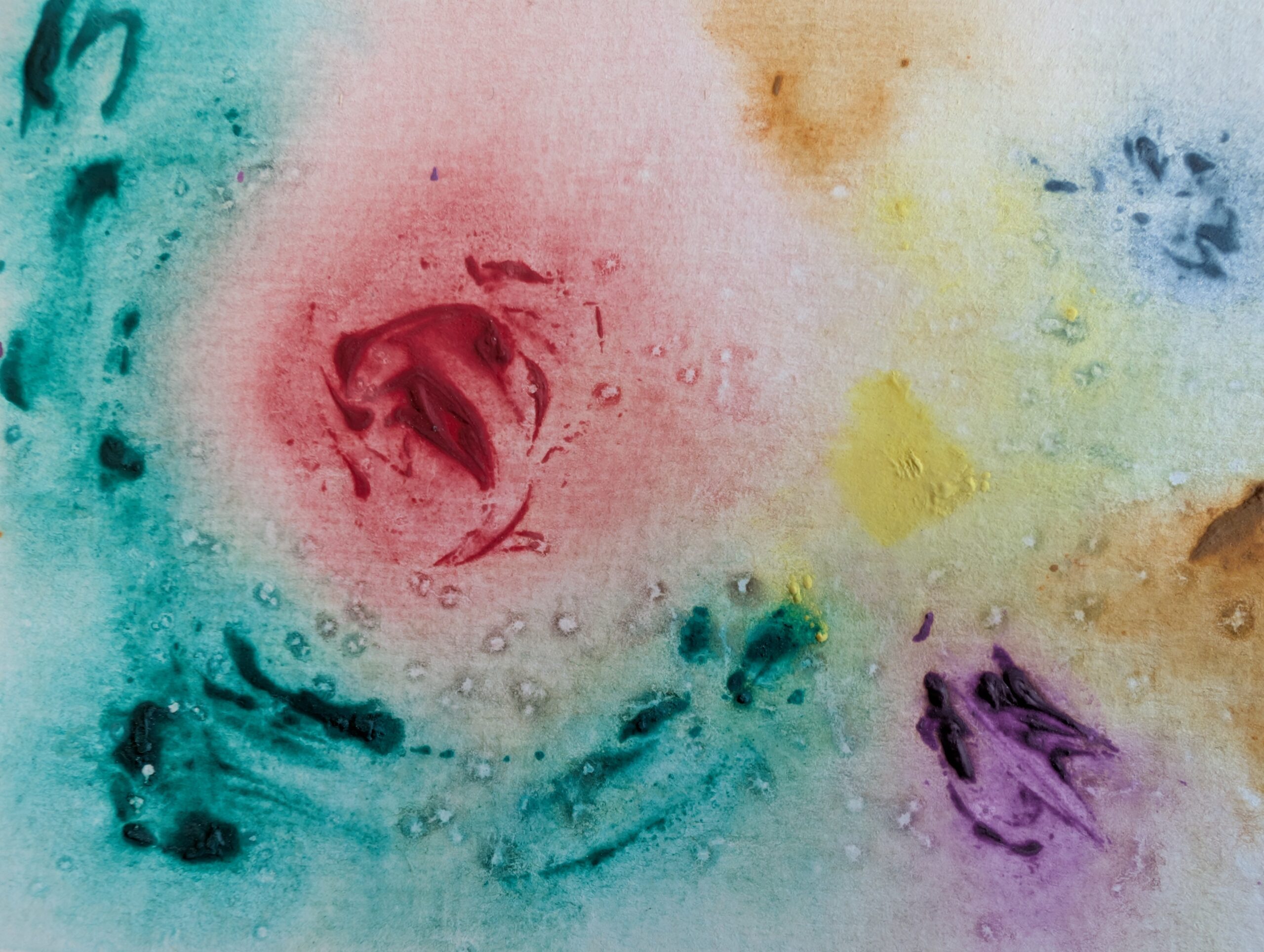
Udo Degener – Miklós Radnóti (1909–1944)
2–3 MinutenWer war Miklós Radnóti. Miklós Radnóti wurde 1909 in Budapest geboren, jüdischer Herkunft, ungarischer Dichter. Er schrieb früh, studierte Literatur, bewegte sich bewusst in der ungarischen Sprach- und Formtradition. In den 1930er Jahren wurde sein Leben zunehmend durch antisemitische Gesetze bestimmt. Er durfte nicht mehr regulär publizieren, wurde zu sogenannten Arbeitsdiensten eingezogen, also Zwangsarbeit ohne…
-

Udo Degener – Meine Gedichte sind
1–2 MinutenDer Text setzt mit einer Wiederholung ein. Jede Zeile beginnt gleich, und doch verschiebt sich der Gegenstand fortlaufend. „Meine Gedichte sind“ markiert keinen festen Besitz, sondern einen Ort, an dem immer wieder neu angesetzt wird. Die Gedichte werden nicht erklärt, sondern in Umlauf gebracht. Zunächst tauchen sie als Material auf: Schreibmaschinenpapier, eine genaue Sorte, versehen…
-

Elisabeth Wesuls – Was ein Kind ist, um 1960
2–3 MinutenGegen das Kind als Postpaket | Beim Lesen eines kurzen Prosatextes über Kindheit „um 1960“ stellt sich ein unmittelbarer Impuls ein: Man möchte widersprechen. Nicht einer Meinung – sondern einem Bild. Der Text zählt auf, was einem Kind zugeschrieben wurde: dass man es „nichts fragen“ müsse, dass ihm „kein eigener Wille“ zugestanden wird, dass es…
-

Elisabeth Wesuls – Hohe Klinken
2–3 MinutenElisabeth Wesuls erzählt von einem Besuch, bei dem man nur eintreten darf, wenn man sich klein macht. Eine Annäherung: Das Eintreten ist kein Beginn, sondern bereits eine Prüfung. Die Tür muss geöffnet werden, nicht sie selbst tritt ein. Der Körper des Mannes entscheidet, wie viel Raum ihr zusteht. Sie passt nur hindurch, indem sie sich…
-

Nathalie Schmid: der geschmack von kartoffeln
3–4 MinutenNathalie Schmids Gedicht „der geschmack von kartoffeln“ porträtiert „einen schlag von frauen“ durch eine Collage körperlicher und alltäglicher Details, die auf den ersten Blick schlicht dokumentarisch wirken. Doch zwischen den Zeilen entfaltet sie eine Dichte, die mich bekümmert: ein Leben, das nur noch rückblickend Bedeutung hat. Verschlossene Innenwelten Die Frauen des Gedichts zeigen sich in…
-

Jane Wels – Bitte versuchen sie, …
3–5 MinutenAnnähernd gelesen | Zwischen Sprache, Ordnung und AuflösungJane Wels‘ Gedicht „Bitte versuchen Sie,“ ist ein Text über die Unmöglichkeit, gefasst zu werden – und zugleich ein Text, der sich selbst beim Versuch des Fassens beobachtet. Es spielt mit der Spannung zwischen Sprache und Identität, zwischen Ordnung und Auflösung, und ist dabei zugleich selbstreflexiv, ironisch und…
