Über Kathrin Niemelas „pont des arts“ | Kathrin Niemelas Gedicht „pont des arts“ erschien in der Literaturzeitschrift Wortschau in einer Paris-Ausgabe. Es ist ein Text, der sich beim ersten Lesen entzieht – nicht weil er hermetisch wäre, sondern weil er so verdichtet ist, dass man ihn kaum greifen kann. Die Sprache ist präzise, die Klänge sind sorgfältig gesetzt, und doch bleibt etwas Abstraktes, Verkopftes zurück. Ein Text, der mich beeindruckt, aber nicht unbedingt berührt.
Der Ort und seine Last
Die Pont des Arts in Paris ist mehr als eine Brücke. Sie wurde zu einem Touristenritual, einem Ort des Kitschs: Liebespaare brachten dort jahrelang Vorhängeschlösser an, gravierten ihre Initialen ein und warfen den Schlüssel in die Seine – als Symbol ewiger Verbundenheit. 2014 brach ein Teil des Geländers unter der Last von 45 Tonnen Metall zusammen. 2015 entfernte die Stadt alle Schlösser. Die Brücke war buchstäblich zu schwer geworden von zu viel Liebe.
Niemela nimmt diesen Ort und macht daraus etwas anderes. Sie beschreibt nicht, sie erzählt nicht. Sie löst das Greifbare auf.
Kann man das zeichnen?
Das Gedicht arbeitet mit Bildern, die man sich vorstellen könnte: eine sich biegende Brücke, ein splitternder Himmel, ein „lichtzitterbild“. Aber es gibt einem keine Zeit, diese Bilder entstehen zu lassen. Der Text ist eine einzige Zeile, nur durch Schrägstriche gegliedert, ohne Interpunktion. Alles fließt, alles stockt, alles drängt weiter.
Als ich das Gedicht zum ersten Mal las, kam mir sofort der Gedanke: Könnte man das zeichnen? Könnte man diese sich biegende Brücke, diesen splitternden Himmel, die ertrinkenden Schlüssel visualisieren?
Die Antwort ist: Ja und nein. Man könnte einzelne Momente isolieren und festhalten – eine Brücke, die sich unter der Last biegt, Schlüssel, die ins Wasser fallen. Aber genau das würde zerstören, was das Gedicht ausmacht: die Bewegung, das Ineinanderfließen, die Atemlosigkeit. Das Gedicht will nicht, dass wir die Bilder festhalten. Es will die Bewegung des Splitters, des Fließens, des Ertrinkens – nicht das gefrorene Bild davon.
Niemela benutzt Wörter, die visuell sind – „splittert“, „glitzern“, „silberglieder“ – aber sie bewegt sich zwischen dem, was man sehen kann, und dem, was sich entzieht. Die Bilder sind da, aber man kann sie nicht greifen.
Vom Ort zur Sprache
Die Pont des Arts ist ein konkreter, greifbarer Ort. Man kann ihn besuchen, man kann darauf stehen, man kann die Seine unter sich fließen sehen. Niemela nimmt diesen Ort und macht daraus Sprache – nicht beschreibend, nicht abbildend, sondern durch Klangketten und Wortfetzen.
Die Schlösser werden zu „silberglieder“, „riegel“, „bügel“, „gitter“. Alles wird zu Bewegung, zu Zustand, zu Klang. Die physische Last der Liebesschlösser wird zur Last der Liebe selbst: „zu viel liebe wiegt, bricht sich in silberglieder“.
Die Frage ist: Ist der Ort nach der Lektüre noch erkennbar? Oder hat sich die Sprache vom Ort gelöst?
Ich denke, beides. Der Ort ist noch da – man spürt die Brücke, die Schlösser, das Wasser. Aber er ist nicht mehr greifbar. Er ist zu etwas Sprachlichem geworden, zu einer Klanglandschaft, die man nicht mehr anfassen kann.
Klang statt Bedeutung?
Niemelas Gedicht ist stark über den Klang gebaut. Die Konsonanten sind hart und abrupt: „klicken“, „splittert“, „zirzt“. Besonders eindrucksvoll ist die Stelle gegen Ende: „zirzt, ziert sich, resigniert“ – drei Wörter, die fast gleich klingen, aber deren Bedeutungen sich verschieben. Vom Bezirzen (jemandem den Kopf verdrehen, verführen) über das kokette Sich-Zieren bis zum Aufgeben.
Diese Klangarbeit ist beeindruckend. Aber sie wirft auch eine Frage auf: Hört man das Gedicht mehr als Klang oder mehr als Bedeutung? Trägt die Sprache den Inhalt oder wird sie selbst zum Inhalt?
Ich habe keine Antwort darauf. Aber die Frage drängt sich beim Lesen auf.
Das Problem der Verdichtung
Das Gedicht ist extrem komprimiert: eine Zeile, keine Pausen außer den Schrägstrichen, kein Atem. Was passiert, wenn ein Gedicht so verdichtet wird?
Für mich entsteht das Gefühl von Atemlosigkeit, von zu viel auf einmal. Es ist, als würde die Sprache unter ihrer eigenen Last zusammenbrechen – wie die Brücke unter den Schlössern.
Aber gleichzeitig entsteht auch eine Distanz. Die Verdichtung macht den Text schwer zugänglich. Er beeindruckt handwerklich, aber er dockt nicht an. Es ist ein Text, den man bewundern kann, aber nicht unbedingt fühlen.
Was bleibt?
Am Ende des Gedichts stehen die Biber. Sie wirken fremd, fast irritierend – ein natürliches Element in einem Gedicht über menschliche Rituale und deren Scheitern. Die Biber leben einfach am Fluss, ohne dieses ganze menschliche Bezirzen und Sich-Zieren. Das Natürliche fließt weiter, während die inszenierte, ritualisierte Liebe sich selbst erdrosselt.
Niemelas Gedicht nimmt einen touristischen Ort, ein kitschiges Ritual, und macht daraus etwas, das weder kitschig noch eindeutig ist. Es erzeugt Bilder, aber will nicht, dass wir sie festhalten. Es arbeitet mit Klang, aber nicht nur mit Klang. Es ist präzise und abstrakt zugleich.
Vielleicht ist das die größte Stärke dieses Gedichts: dass es sich nicht festlegen lässt. Dass es zwischen dem, was man sehen kann, und dem, was sich entzieht, hin und her bewegt. Dass es Fragen aufwirft, ohne sie zu beantworten.
Kathrin Niemela, geboren 1973 in Regensburg, ist eine vielreisende Lyrikerin. 2021 erschien ihr Debütband „wenn ich asche bin, lerne ich kanji“ bei der parasitenpresse. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jurypreis des Irseer Pegasus. Ihre Gedichte sind bekannt für ihre „unerhörten Wortschöpfungen“ und ihr „Gespür für Rhythmik, Klang und visuelle Kraft“.
Gelesen habe ich das Gedicht in WORTSCHAU #35 – Thema Paris
Titelfoto: edmondlafoto via pixabay
-

Exkurs: Weiterarbeiten mit „pont des art“
2–4 MinutenFünf Ansätze für aktives Lesen | Nach der Lektüre von Niemelas „pont des arts“ stellte sich mir die Frage: Gibt es einen sinnvollen Ansatzpunkt, mit dem man nach dem Lesen weiterarbeiten kann? Im Sinne des aktiven Lesens – nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen, selbst ausprobieren? Hier sind fünf Möglichkeiten, die sich für mich aus dem…
-

Wenn Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein
4–6 MinutenÜber Kathrin Niemelas „pont des arts“ | Kathrin Niemelas Gedicht „pont des arts“ erschien in der Literaturzeitschrift Wortschau in einer Paris-Ausgabe. Es ist ein Text, der sich beim ersten Lesen entzieht – nicht weil er hermetisch wäre, sondern weil er so verdichtet ist, dass man ihn kaum greifen kann. Die Sprache ist präzise, die Klänge…
-

Den Mund über Wasser halten
6–9 MinutenEin Essay über männliche Verantwortung im Angesicht von Femiziden I. Das Gedicht als Warnsignal Kathrin Niemelas Gedicht „Beckenendlage“ beginnt mit einem medizinischen Begriff – einer riskanten Geburtslage – und endet im Ertränkungsbecken. Es verbindet die Hinrichtung verurteilter „Hexen“ im isländischen Drekkingarhylur mit Agnes Bernauer in der Donau und mit den ertrinkenden Frauen im Mittelmeer. Der…
-
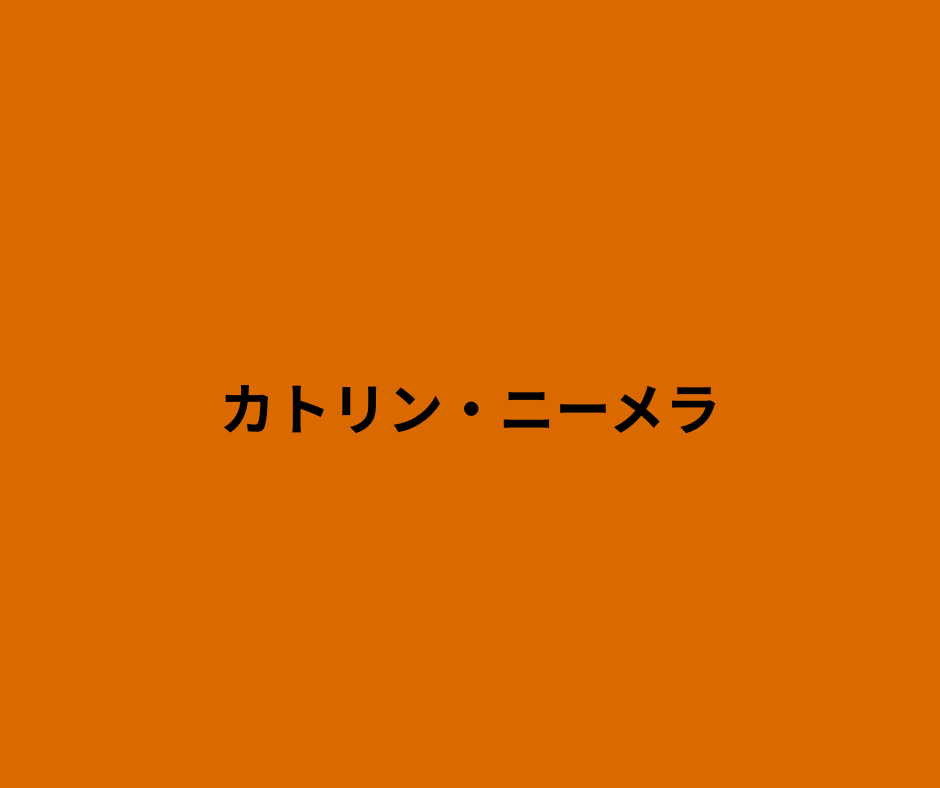
Kathrin Niemela
3–4 Minuten„kriegen kinder von / fremden Gedichten“ – dieser Satz aus einem Gedichtzyklus ‚die süße unterm marmeladenschimmel‘ in wenn ich asche bin,lerne ich kanji hat sich mir eingebrannt. Er wurde zum Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit ihren Texten. Kathrin Niemela wurde 1973 in Regensburg geboren. Nach Studien in Romanistik, Politologie und Jura absolvierte sie ein betriebswirtschaftliches Studium…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
