Eberhard Binder, auch unter dem Namen Eberhard Binder-Staßfurt bekannt, wurde am 2. Mai 1924 in Staßfurt geboren und prägte als Grafiker und Illustrator über fünf Jahrzehnte die Kunstlandschaft der DDR und darüber hinaus. Nach ersten künstlerischen Schritten an der Meisterschule des Deutschen Handwerks (Werkkunstschule) in Hildesheim (1941–1942) absolvierte er von 1949 bis 1952 ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Magdeburg, das seine Verbundenheit mit der Stadt begründete, die fortan sein Lebens- und Schaffensmittelpunkt wurde. Zunächst arbeitete er als Werbegrafiker, bevor er sich ab 1955 ganz der Buchillustration und -gestaltung widmete. In seiner über 40-jährigen Karriere schuf er ein monumentales Werk von 800 illustrierten und gestalteten Büchern, darunter viele in Zusammenarbeit mit seiner Frau Elfriede Binder, die ebenfalls als Grafikerin tätig war.
Binder arbeitete vorrangig mit Linolschnitt und Holzschnitt, Techniken, die er durch ihre klaren Kontraste und handwerkliche Präzision schätzte. Sein Stil war „reduziert-expressiv“ – er vereinfachte Formen, ohne die narrative Tiefe der Motive zu opfern. Statt realistischer Darstellung setzte er auf symbolhafte Verdichtung, etwa durch markante Schwarz-Weiß-Kontraste oder rhythmische Linienführungen. Ein prägnantes Zitat Binders unterstreicht seine Philosophie:
„Der Linolschnitt verzeiht keine Nachlässigkeit. Jeder Schnitt ist eine endgültige Entscheidung.“
Diese Haltung spiegelt sich in seinen präzisen Kompositionen wider, die trotz ihrer Schlichtheit emotionale Kraft entfalten.
Buchillustrationen
Binders Schaffen umfasste ein breites Spektrum – von Kinderbüchern über klassische Literatur bis zu zeitgenössischen Texten. Sein Debüt als Buchillustrator gab er 1954 mit Federzeichnungen für Mark Twains „Tom Sawyers Abenteuer“ (Verlag Neues Leben), die bereits sein Gespür für dynamische Szenen und humorvolle Charakterzeichnung zeigten. Wie er später betonte, lag ihm bei Kinder- und Jugendbüchern besonders die „Vielfalt der Handlungsmomente und die Bildhaftigkeit der Vorlage“ am Herzen. Er strebte stets die „emotionale Übereinstimmung von Text und Bild“ an, wobei er sowohl realistische als auch fantastische Stoffe meisterhaft umsetzte.
Konkrete Highlights seines Œuvres:
- „Till Eulenspiegel“ (Altberliner Verlag, 1955): Binder begleitete die Schelmengeschichten mit dynamischen Linolschnitten, die Eulenspiegels anarchischen Humor durch verspielte Details und kantige Figuren einfingen.
- „Deutsche Volksmärchen“ der Brüder Grimm (1960er-Jahre): Seine Holzschnitte zu „Hänsel und Gretel“ oder „Der Wolf und die sieben Geißlein“ betonten das Düstere der Märchen, etwa durch schroffe Schattenwürfe oder archaisch wirkende Landschaften.
- „Reineke Fuchs“ von Johann Wolfgang von Goethe (1974): In dieser Serie nutzte er tierische Karikaturen, um die Satire auf menschliche Laster zu unterstreichen – ein Beispiel für sein Talent, literarische Ironie ins Bild zu übersetzen.
- „Münchhausen“-Illustrationen (1970er-Jahre): Hier kombinierte er surreal übersteigerte Figuren mit fein geschrafften Hintergründen, um die Lügengeschichten visuell zu pointieren.
Charakteristisch für Binders Illustrationsstil waren „bewegte, vielfigurige Szenen in meist heiterer Grundstimmung“, wie Kunstkritiker hervorhoben. Seine Bildkompositionen wirkten lebendig, ohne überladen zu sein, und fanden stets eine Balance zwischen Detailreichtum und klarer Lesbarkeit. Die Wahl der Technik – ob Federzeichnung, Aquarell oder Druckgrafik – traf er stets nach „Gehalt und Stimmung des Werkes“, wie er selbst erklärte.
Öffentliche Kunst
Neben Büchern gestaltete Binder großformatige Wandbilder und öffentliche Arbeiten in Magdeburg, darunter:
- „Magdeburger Reiter“ (1970er-Jahre): Eine Linolschnitt-Serie, die das berühmte Reiterstandbild aus dem 13. Jahrhundert abstrahierte und damit historisches Erbe in moderne Formensprache übertrug.
- Wandgestaltungen im Rathaus Magdeburg und in Kulturhäusern der Region, die oft Szenen aus der Arbeitswelt oder lokalen Sagen zeigten.
Eberhard Binder-Staßfurt verstarb nach schwerer Krankheit am 9. März 1998 in Magdeburg. Sein Werk, darunter zahlreiche Kooperationen mit seiner Frau Elfriede, ist heute Teil von Sammlungen wie dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg oder der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Eine Retrospektive 2014 in seiner Geburtsstadt Staßfurt würdigte sein Schaffen als Brücke zwischen handwerklicher Tradition und zeitgenössischer Expressivität. Bis heute gelten seine Illustrationen als Meilensteine der DDR-Grafikkunst, die Generationen von Lesern literarische Klassiker neu entdecken ließen.
Seine Devise, „ein gutes Buchbild muss den Leser neugierig machen, ohne ihm alles vorwegzunehmen“, prägte nicht nur seine eigenen Arbeiten, sondern inspirierte auch nachfolgende Künstlergenerationen. Eberhard Binder-Staßfurt bleibt als virtuoser Erzähler in Bildern in Erinnerung – ein Meister der Reduktion, der mit Schere, Feder und Druckstock ganze Welten schuf.
In meinem Bestand
Götz R. Richter | Jonas oder Der Untergang der Marie-Henriette
Der Kinderbuchverlag Berlin 1959

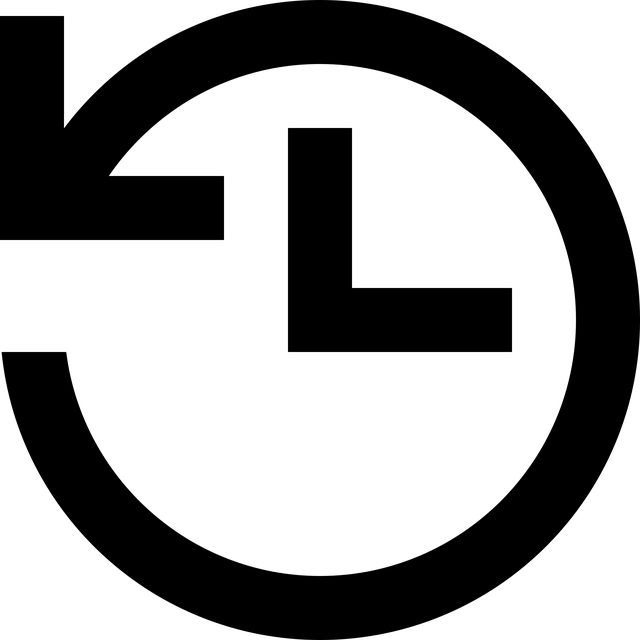
Schreibe einen Kommentar