Das Gedicht „A Life-Exam“ präsentiert eine surreale, satirische Prüfung des Lebens, die Absurdität, existenzielle Ängste, kulturelle Erwartungen und menschliche Zerbrechlichkeit vermischt. Die 71 Fragen parodieren akademische Tests, religiöse Gebote, medizinische Anweisungen und bürokratische Formulare, während sie Themen wie Liebe, Tod, Identität, Technologie, Spiritualität und gesellschaftliche Normen aufgreifen. Die Aufgaben reichen von trivial („Koch Mittagessen“, Frage 32) bis existenziell („Stirb“, Frage 35), von humorvoll-banal („Nenne neue Tiernamen für die Bioingenieurwissenschaft“, Frage 24) bis zutiefst verstörend („Berechne die Viskosität eines toten Elternauges“, Frage 20). Das Gedicht hinterfragt Leistungsdruck, Sinnsuche und die Unmöglichkeit, „Leben“ als lineares Projekt zu kontrollieren.
Struktur
- Form: Fragmentarisch, assoziativ, ohne narrative Abfolge. Die Fragen folgen keiner logischen Ordnung, spiegeln aber Chaos und Überforderung wider.
- Sprache: Klinisch-sachlich („Füllen Sie diese Flasche mit Urin, Tränen oder Sperma“, Frage 15) trifft auf poetisch-metaphorisch („Denke über Wasser nach“, Frage 60). Imperative dominieren, verstärken den Prüfungscharakter.
- Intertextualität: Anspielungen auf religiöse Texte (Bibel, Koran), Literatur (T.S. Eliot, Kipling), Popkultur (Greta Garbo) und Wissenschaft (Mendelejew, Phrenologie).
- Themencluster:
- Körper & Tod (Fragen 4, 14, 35, 36)
- Liebe & Beziehung (Fragen 11, 16, 58)
- Kultur & Macht (Fragen 23, 46, 47)
- Selbstreflexion & Identität (Fragen 55, 56, 68)
- Absurdität & Scheitern (Fragen 18, ma25, 40)
Das Gedicht habe ich in der Ausgabe 228 des Magazins die horen gefunden. Titel Eine Lebensprüfung. Deutsch: Mirko Bonné. Hier das Poem im Original: London Review of Books – Vol. 18 No. 11
LektüreNotizen
Das Leben als absurdes Prüfungssystem
Der Text karikiert die menschliche Obsession, Existenz in kontrollierbare Aufgaben zu zergliedern. Die Fragen spiegeln, wie wir versuchen, Chaos (Liebe, Tod, Identität) durch Systeme (Religion, Wissenschaft, Bürokratie) zu bändigen – und dabei scheitern.
- Paradox: Je absurder die Aufgabe („Stirb“, „Berechne die Viskosität eines toten Elternauges“), desto deutlicher wird, dass „Antworten“ auf Lebensfragen oft willkürliche Konstrukte sind.
- Verbindung zu Camus’ Absurdismus: Der Mensch als Prüfling, der verzweifelt Sinn sucht, wo keiner ist – und dennoch weiterantwortet.
Die Illusion von Autonomie
Die Fragen fordern „Wahrheit aus dem Herzen“ (Titel), verlangen aber gleichzeitig Anpassung an Normen („Schreibe Kipling neu“, „Analysiere dich nach Thatcher“).
- Frage 70/71: Das Gebet wird zur Multiple-Choice-Übung, Spiritualität zur Formsache.
- Ironie: Selbst die Aufforderung „Entspann“ (Frage 9) ist ein Imperativ – Entspannung als Pflicht.
Der Körper als Schlachtfeld
Wiederkehrend wird der Körper zum Objekt gemacht:
- Gewalt: Geburtsmethoden (Frage 4), chirurgische Eingriffe (Frage 14), Menstruation (Frage 36).
- Kontrolle: Körperflüssigkeiten sammeln (Frage 15), Gliedmaßen zählen (Frage 5) – als obsessiver Versuch, das Vergängliche zu messen.
- Verknüpfung zum Biopolitik-Konzept (Foucault): Machtstrukturen dringen bis in intimste Körperakte ein.
Zeit & Vergänglichkeit
Das Gedicht zwingt zur Konfrontation mit Linearität („Wo siehst du dich in 50 Jahren?“, Frage 59) und ihrem Scheitern:
- Vergangenheit: Kindheitstechnologien als „Schrott“ (Frage 25), ungelebte Alternativen (Frage 16).
- Zukunft: „Stirb“ (Frage 35) als einzige sichere Antwort.
- Gegenwart: Wird überlagert von Pflichten („Koche Mittagessen“, Frage 32) – ein Hamsterrad aus Produktivität.
Liebe als letzte Utopie
Trotz aller Zynik kehrt die Liebe immer wieder als unlösbare, aber zentrale Frage:
- Frage 58: „Fasse die Geschichte deiner größten Liebe in zehn Wörtern zusammen“ – ein Versuch, das Unbeschreibliche zu kodifizieren.
- Frage 11: Die unmögliche Liebe zur*m Geflüchteten wird zur Metapher für Sehnsucht nach Verbindung in einer fragmentierten Welt.
- Frage 6: „Liebe besiegt alles in …“ – das offene Ende verweigert die Antwort, aber nicht die Hoffnung.
Sprache als Falle & Rettung
- Absurditäten wie Frage 1 („The Waste Land“ in Einsilbern) entlarven, wie Sprache Bedeutung vorgaukelt, aber nie vollständig erfasst.
- Fragen 61–65: Können Silben, Kleidung, Blicke jemals Wesen erfassen?
- Schlussfrage 71: Das Recht, eigene Fragen zu stellen – ein Hauch von Freiheit im Regelwerk.
Meine Lesart:
Das Gedicht stellt nicht die Antworten in Frage, sondern das Prinzip der Prüfung selbst – das Leben als multiple-choice-Quiz, bei dem alle Optionen falsch sind, aber das Schreiben trotzdem weitergeht.
Wie wäre es, genau diese Geste des Weitermachens feiern: das Scheitern als einzige ehrliche Antwort. Übrigens: Der Text ist trotz aller Dunkelheit amüsant.


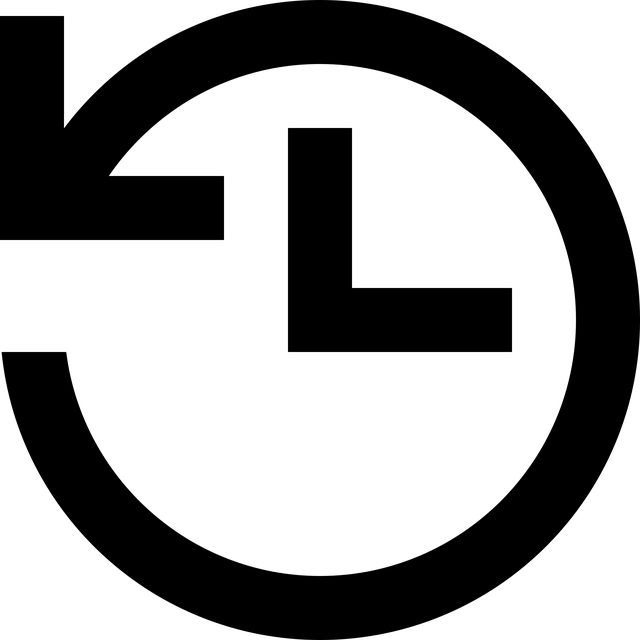
Schreibe einen Kommentar