Warum müssen Tiere immer für uns herhalten? Michael Krüger hat in die horen #299 ein neues Gedicht veröffentlicht (datiert/betitelt 2. Mai 2025), und ich hab mich beim Lesen gefragt: Schwalben, Kuckuck, Gras, Wiese – sind das wieder Metaphern für Menschliches? Müssen die wirklich immer für was herhalten, womit sie nichts zu tun haben?
Krüger, Jahrgang 1943, war lange Lektor und Verleger bei Hanser, hat selbst Dutzende Gedichtbände veröffentlicht und gehört zu denen, die ohne viel Getöse präzise beobachten. Seine Lyrik ist sparsam, lakonisch, oft bitter – aber nie laut. Er schreibt, als würde er nebenbei notieren, was ohnehin alle wissen, aber keiner ausspricht.
Ja und nein. Die sind hier ziemlich eindeutig Stellvertreter für Menschliches. Aber nicht im Sinne von „Tier = Mensch“, sondern als Kontrastfläche. Und genau da steckt schon eine Antwort auf die Frage.
Was passiert im Gedicht?
„Kaum sind die Schwalben zurück …“ Das Gedicht ist auf den 2. Mai datiert – mitten im Frühling, ein neuer Zyklus. Die Schwalben sind gerade erst angekommen, die Natur startet durch, legt die Grundlage für Wachstum und Ernte. Klassischer Neuanfang. Und kaum ist dieser Neuanfang da, kaum beginnt der Zyklus, geht beim Menschen sofort das alte Gezänk los: Wahrheit, Wirklichkeit, alte Rechnungen, alte Leute („alte Schachteln“ ist böse, aber bewusst böse). Die Natur macht neu. Wir Menschen schaffen es nicht.
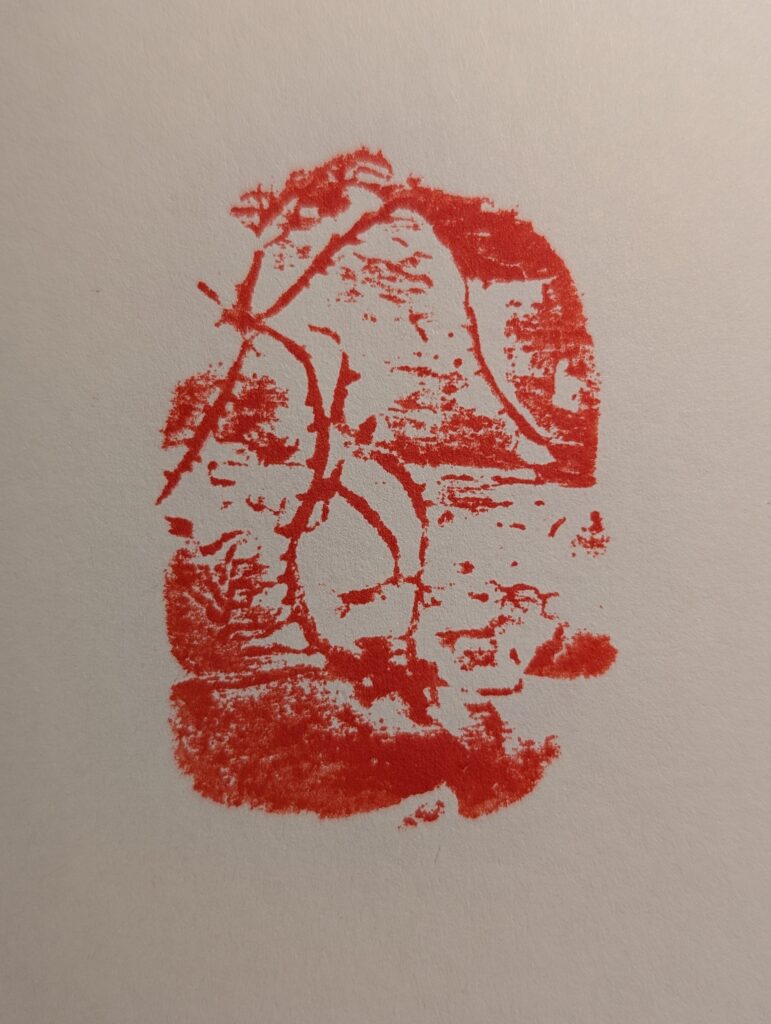
„Gezeter … Austausch von guten Gründen“ Das klingt wie eine politische Talkshow nach dem dritten Glas Wein. Alle reden von Vernunft, aber es ist Lärm. Argumente werden gehandelt wie Münzen, nicht gelebt.
„Noch fehlt der Kuckuck.“ Der Kuckuck ist der Störer, der Fremde, der seine Eier in fremde Nester legt. Er kommt noch. Heißt: Das Schlimmste steht noch aus. Oder: Der eigentliche Wahnsinn ist noch nicht mal da, obwohl es schon unerträglich laut ist.
„Ob das Gras sich ekelt …“ Jetzt wird es bitter. Gras als unschuldiger Zeuge. Es wächst einfach, egal wo. Aber hier ist der Boden verseucht durch Geschichte. Das Gras hat kein moralisches Bewusstsein, keine Wahl, kein „Ekel“. Der Mensch schon.
„Der Todesmarsch ging über diese Wiese“ – das meint vermutlich die historischen Todesmärsche 1945, aber es schwingt beides mit: die konkrete Gewalt damals und die Last, die bis heute auf diesem Ort liegt. Kein Symbol mehr, blanke Geschichte. Die Natur wächst weiter, aber sie weiß nichts davon. Der Mensch weiß es und lebt trotzdem weiter. Genau das ist der Schmerzpunkt.
„Ein Mensch kann ein Wesen sein, das sich erinnert“ Das ist weder Lob noch Vorwurf. Das ist Ausstattung. Der Mensch kann sich erinnern – ob er will oder nicht. Erinnern heißt hier: mit etwas leben müssen, das sich nicht auflöst, nicht aufgeht, nicht verschwindet. Erinnerung als Last, nicht als Tugend.“
Warum also immer Tier und Natur?
Weil sie das nicht können, was wir können: nicht erinnern, nicht verdrängen, nicht lügen, nicht diskutieren, nicht rechtfertigen.
Natur ist unschuldig. Und gerade deshalb eignet sie sich perfekt, um menschliche Schuld sichtbar zu machen. Nicht weil sie „für etwas herhalten soll“, sondern weil sie nicht mitmacht. Sie widerspricht nicht. Sie klagt nicht. Sie wächst einfach weiter. Und genau das ist unerträglich.
Krüger benutzt die Tiere nicht, um sie zu vermenschlichen, sondern um den Menschen bloßzustellen. Neben Schwalben, Gras und Kuckuck wirkt das menschliche Gerede klein, laut und unerquicklich.
Wenn man es ganz unromantisch sagen will: Die Natur ist hier kein Symbol. Sie ist der Maßstab. Und wir fallen durch.
Wie würde dieses Gedicht aus Sicht der Natur klingen?
Ich hab mich das gefragt beim Lesen. Wie sähe dieses Gedicht aus, wenn Flora und Fauna es erzählen würden? Wahrscheinlich so nüchtern, dass der Mensch irritiert wäre über die eigene Banalität. Auch im Bösen.
Denn für die Natur vollzieht sich ständig etwas. Nur eben nichts Symbolisches.
Das Gras bricht, knickt um, wenn man drauftritt, wächst nach. Die Schwalben kommen, richten sich ein, paaren sich, schaffen neues Leben. Der Marsch über die Wiese: Verdichtung, Abrieb, dann Regen, dann Wiederaufwuchs. Spuren existieren, aber zeitlich begrenzt.
Aus Sicht der Natur wäre die Perspektive nicht leer, sondern voll – nur anders gefüllt:
- kein Erzählen, sondern Abläufe
- kein Erinnern, sondern Wiederholungen
- kein „miteinander reden“, sondern ein „ineinander greifen“
Aber: Das ist schon wieder menschlich gedacht. Um diese Perspektive wirklich einzunehmen, müssten wir den menschlichen Sprachraum verlassen. Nicht als Nutzer der Natur, sondern als Teil davon – bestrebt zu lernen, Teil des ineinander Greifens zu sein. Nicht, dass wir das nicht eh sind. Aber wir verleugnen es immer und immer wieder. Aus Eigennutz.
Ich weiß also nicht, wie dieses Gedicht aus der Perspektive der Natur klingen würde. Der Versuch es festzuhalten kann nur eine Annäherung sein. Und vielleicht ist genau das der Punkt: Dass Krügers Gedicht uns in diese Falle laufen lässt. Wir wollen die Perspektive der Natur einnehmen, wir wollen verstehen, wie es ist, einfach zu wachsen, zu kommen, zu sein – aber wir können nicht. Wir bleiben im Gezeter stecken.
Und genau da wird das Gedicht so scharf: Es zeigt das menschliche Gezeter über Wahrheit und Wirklichkeit neben einer Welt, in der Wahrheit gar nicht verhandelt wird, weil alles unmittelbar geschieht.
Der eigentliche Schmerz: Der Mensch könnte Teil dieses Zyklus sein, entscheidet sich aber immer wieder dafür, Beobachter, Kommentator, Streithansel zu sein. Und wirkt oft genug als Zerstörer.
Die Natur macht weiter. Nicht menschelnd. Verbindlich.
Mir bleibt die nüchterne Feststellung: Der Mensch ist das einzige Wesen, das weiß, was war, und trotzdem so tut, als könne man es wegreden.
Michael Krüger: Neue Gedichte | 2. Mai 2025
Erschienen in der Ausgabe #299 die horen Über Gewohnheiten wie diese
Krüger, Jahrgang 1943, war lange Lektor und Verleger bei Hanser, hat selbst Dutzende Gedichtbände veröffentlicht und gehört zu denen, die ohne viel Getöse und präzise beobachten. Seine Lyrik ist sparsam, lakonisch, oft bitter – aber nie laut. Er schreibt, als würde er nebenbei notieren, was ohnehin alle wissen, aber keiner ausspricht.
