Ein merkwürdiges Wort: aufgegeben. Es trägt in sich die ganze Ambivalenz unseres Umgangs mit Literatur, mit Autoren, mit dem, was geschrieben wurde und nun in der Welt ist – oder eben nicht mehr ist, nicht mehr wahrgenommen wird, aus dem Sichtfeld geraten ist.
Frank Witzels Titel legt eine Fährte, die zunächst in die Irre führt: Wer gibt hier eigentlich auf? Der Autor selbst, der die Feder niederlegt? Der Verlag, der nicht mehr druckt? Die Leserschaft, die wegschaut? Oder gibt es eine übergeordnete Instanz – den Literaturbetrieb, die Zeit selbst, das kollektive Gedächtnis –, die einen Autor aufgibt wie man ein Territorium aufgibt, ein Gebäude, einen Posten?
Die doppelte Bewegung des Aufgebens
Im Deutschen öffnet sich hier ein semantischer Abgrund. Aufgeben meint zweierlei: das Verlassen, das Preisgeben – aber auch das Aufgeben einer Sendung, eines Gepäckstücks, das zur Beförderung übergeben wird. Ein Text, der geschrieben ist, wird aufgegeben: an die Welt, an die Zukunft, an unbekannte Leser. Er verlässt die Hand des Autors wie ein Brief ohne Adressat, wie eine Flaschenpost. Darin liegt bereits ein Verzicht, eine ursprüngliche Form des Aufgebens – der Autor gibt seinen Text auf, im Sinne von: her, fort, weg von sich.
Aber was geschieht, wenn niemand dieses Aufgegebene annimmt? Wenn die Sendung nicht zugestellt wird, weil der Empfänger verzogen ist – oder nie existiert hat? Dann kippt die Geste des Übergebens um in die des Preisgebens. Dann wird aus dem produktiven Akt des Loslassens die Verlassenheit, das Aufgegebensein.
Die Wertigkeit als Beziehungsgeschehen
Sie sprechen von Wertigkeit – und das ist der Kern. Denn Literatur entsteht nicht allein im Schreiben, sondern in der Beziehung zwischen Text und Leser, zwischen Autor und Zeit, zwischen Geschriebenem und Erinnern. Ein Text ohne Leser ist wie ein nicht schwingender Resonanzkörper: vorhanden, aber stumm. Seine Wertigkeit konstituiert sich erst im Widerhall.
Diese Wertigkeit ist keine objektive Eigenschaft, kein Goldgehalt, der dem Text innewohnt. Sie ist eine Zuschreibung, eine Geste der Anerkennung, ein Akt des Würdigens. Der Autor schafft die Möglichkeit zur Wertigkeit – durch Sorgfalt, durch Präzision, durch das Ringen um Ausdruck. Aber die Wertigkeit selbst entsteht erst, wenn jemand liest, wenn jemand erkennt, wenn jemand antwortet.
Hier liegt die Verantwortung, von der Sie sprechen: auf beiden Seiten. Der Autor trägt die Verantwortung für die Qualität, für die Ernsthaftigkeit seines Unternehmens. Er kann nicht erzwingen, dass sein Text gelesen wird – aber er kann einen Text schaffen, der des Lesens würdig ist. Der Leser wiederum trägt die Verantwortung des Wahrnehmens, des Suchens, des Würdigens. Nicht jeder Text verdient diese Zuwendung – aber manche Texte verdienen sie, ohne sie je zu erhalten.
Die Ökonomie der Aufmerksamkeit und das Vergessen
In unserer Zeit, in der täglich mehr geschrieben wird als je zuvor in der Geschichte, potenziert sich das Problem. Das Vergessen wird nicht mehr zur Ausnahme, sondern zur Regel. Die meisten Texte werden bereits im Moment ihrer Veröffentlichung aufgegeben – nicht aus Böswilligkeit, sondern aus schierem Mangel an Zeit, an Aufmerksamkeit, an Raum im kollektiven Gedächtnis.
Witzel spricht von hundert Autoren: vergessen, verkannt, verschollen. Hinter jedem dieser Worte steht eine andere Form des Aufgegebenseins. Vergessen ist das sanfte Verschwinden, das allmähliche Verblassen. Verkannt ist die tragischere Variante: Man hat gesehen, aber nicht verstanden, hat gelesen, aber nicht erkannt. Verschollen schließlich meint die vollständige Tilgung aus dem Archiv, die spurlose Auflösung.
Und doch: Wer von diesen Autoren spricht, holt sie bereits zurück. Wer sie auflistet, hebt sie wieder auf – im dreifachen Hegelschen Sinne: bewahren, emporheben, annullieren. Die Liste selbst wird zur Rettungsgeste, zur Rehabilitation, zur Wiederaneignung.
Das Gedächtnis als ethische Praxis
Vielleicht besteht die Würde der Literatur gerade darin, dass sie aufgegeben werden kann – und muss. Dass sie nicht gesichert ist, nicht garantiert, nicht unsterblich. Dass jede Generation neu entscheiden muss, was sie liest, was sie bewahrt, welche Stimmen sie hören will. Diese Ungesichertheit ist keine Schwäche, sondern die Bedingung ihrer Lebendigkeit.
Das Erinnern wird damit zu einer ethischen Praxis. Nicht im Sinne einer moralischen Pflicht, jeden vergessenen Autor zu rehabilitieren – das wäre unmöglich und auch sinnlos. Sondern im Sinne einer Wachsamkeit: zu wissen, dass hinter jedem gegenwärtigen Kanon unzählige aufgegebene Autoren stehen, deren Texte vielleicht gerade heute, gerade für uns, von Bedeutung sein könnten.
Die Wertigkeit eines Essays wie des von Witzel geplanten liegt dann genau darin: Er macht das Aufgegebensein sichtbar. Er erinnert uns daran, dass Literaturgeschichte nicht nur das ist, was überlebt hat, sondern auch das, was verloren ging. Und er lädt uns ein, das Verhältnis von Schreiben und Lesen, von Schaffen und Würdigen, von Verantwortung und Zuwendung neu zu bedenken.
Coda: Die Zukunft des Aufgegebenen
Am Ende bleibt die Frage: Was tun wir mit den aufgegebenen Autoren? Müssen wir sie alle retten? Können wir das überhaupt? Oder geht es vielmehr darum, die Bedingungen zu verstehen, unter denen Texte aufgegeben werden – und unsere eigene Rolle in diesem Prozess zu erkennen?
Vielleicht ist das Aufgegebensein die eigentliche Existenzform von Literatur. Jeder Text, einmal geschrieben, ist der Zeit übergeben, der Nachwelt aufgegeben – ohne Garantie, ohne Sicherheit. In dieser Verletzlichkeit liegt seine Würde. Und in unserem Lesen, unserem Erinnern, unserem Würdigen liegt unsere Antwort darauf.
Die hundert Namen, die Witzel aufruft, sind Stellvertreter für Tausende, für Zehntausende. Sie sind die stillen Begleiter jeder Literaturgeschichte, die Schatten hinter dem Kanon. Ihre Aufgegebenheit zu benennen, heißt nicht, sie zurückzuholen. Es heißt, ihre Abwesenheit zu würdigen – und die Frage nach der Wertigkeit von Literatur überhaupt neu zu stellen.
Jetzt freue ich mich auf die Lektüre von Frank Witzels Beitrag und auf sein Verständnis des Aufgegebenen.
Das Titelfoto: Bild von ddzphoto auf Pixabay
-

WORTSCHAU Nr. 43
2–3 MinutenGedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in…
-

WORTSCHAU 43 – Es hört nie auf
1–2 MinutenDiese Ausgabe des Literaturmagazins WORTSCHAU präsentiert sich als besonders lyrik-fokussierte Publikation mit Thomas Kunst als Hauptautor. Feridun Zaimoglu charakterisierte Kunst in seiner Kleist-Preis-Begründung als den „sprachbesessensten und herzverrücktesten deutschen Dichter unserer Zeit“ – eine durchaus plakative Zuschreibung, die der Leser selbst überprüfen kann. Kleine Einblicke in Thomas Kunsts Gedankenwelt | Der beigefügte Fragebogen gibt Einblicke…
-

Rolf Borzik
7–11 MinutenBei der Rechcherche zum Fotografen des Umschlagbildes von Tagtexte habe ich dieses Zitat von ihm auf der Seite von Pina Bausch Foundation gefunden: „Ich glaube, man muß sehr bescheiden sein in der Wahl eines Stoffes, weil man sich zu einem intimen Freund bekennt, der sich nicht wehren kann. Diese Konfrontation hat die besten Chancen, wenn…
-
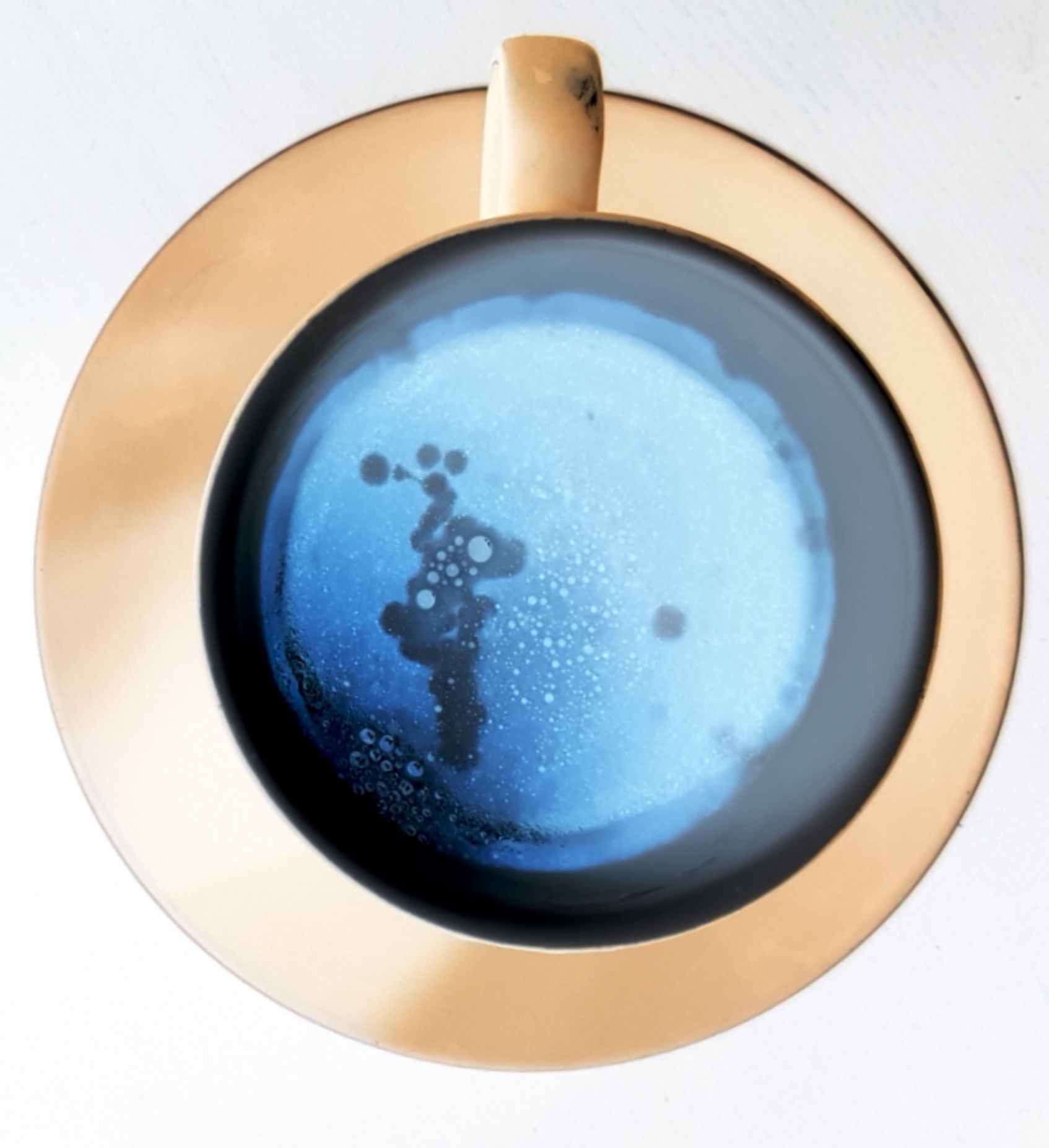
Das Espressoskop
1–2 MinutenViele Jahre habe ich Fotos von Espressoschaum gemacht und gesammelt. Irgendwann ist es dann in Vergessenheit geraten; ich trinke inzwischen hauptsächlich Tee. Beim Lesen des Gedichts Espresso von Sarah Kirsch, kam die Erinnerung wieder; es geht dort u.a. um den Verlust von Orientierung am Alltag, im vermeintlich Vertrauten (Meine Lesart) – und das brachte mich…
-

Espresso – Sarah Kirsch
2–3 MinutenSarah Kirschs Gedicht Espresso entfaltet in knapper, verdichteter Sprache ein Szenario der Rückkehr und des Erstaunens: Das lyrische Ich kommt nach längerer Abwesenheit an einen vertrauten Ort zurück – möglicherweise ein Zuhause – und stellt mit wachsender Irritation fest, dass scheinbar nichts vorbereitet ist. Alltägliche Dinge wie Zucker und Milch fehlen, was zunächst wie eine…
-

Waldinmitten – Mit der Kamera auf Loerkes Waldspuren
1–2 MinutenFotografische Skizzen: Hier folgen meine Fotografien, die ich mit Oskar Loerkes Gedicht „Im Silberdistelwald“ verbinde. (Die Galerie passe ich fortlaufend an.)
-

Wald: Schutzraum und Ort der Vergänglichkeit
3–4 MinutenEinen besonderen Blick habe ich auf die ambivalente Darstellung des Waldes bei Oskar Loerke geworfen: – zugleich Schutzraum und Ort der Vergänglichkeit. Er scheint mir die poetische Mehrdeutigkeit des Textes zu unterstreichen. Zudem möchte ich eine Einladung aussprechen – auch an mich selbst, daher das du – aufmerksam(er) durch die Wälder zu streifen (siehe: Beobachtungsideen…
-

Augenhöhe gesucht
3–4 MinutenIch halte mich für einen durchaus gefühlvollen Menschen; es würde mir allerdings niemals in den Sinn kommen, mich derart zu äußern. Allerdings: wie würde ich es denn, basierend auf diesem Gedicht von Eduard Assadow? Wenn man das Gedicht aus einer nüchternen, weniger überwältigten Perspektive betrachtet, könnte die Darstellung der Gefühle anders aussehen – sachlicher, reflektierter,…
-

Angeregte Dialoge
2–3 MinutenLiteratur ist für mich weit mehr als reine Information und Unterhaltung – sie ist ein Quell der Inspiration und Anlass für lebendige Gespräche, sowohl innere als auch äußere. Anstatt in der stillen Rezeption zu verharren, nutze ich die Kraft der Texte, um mein eigenes Denken anzustoßen und neue Perspektiven zu gewinnen. In dieser Rubrik versammle…
