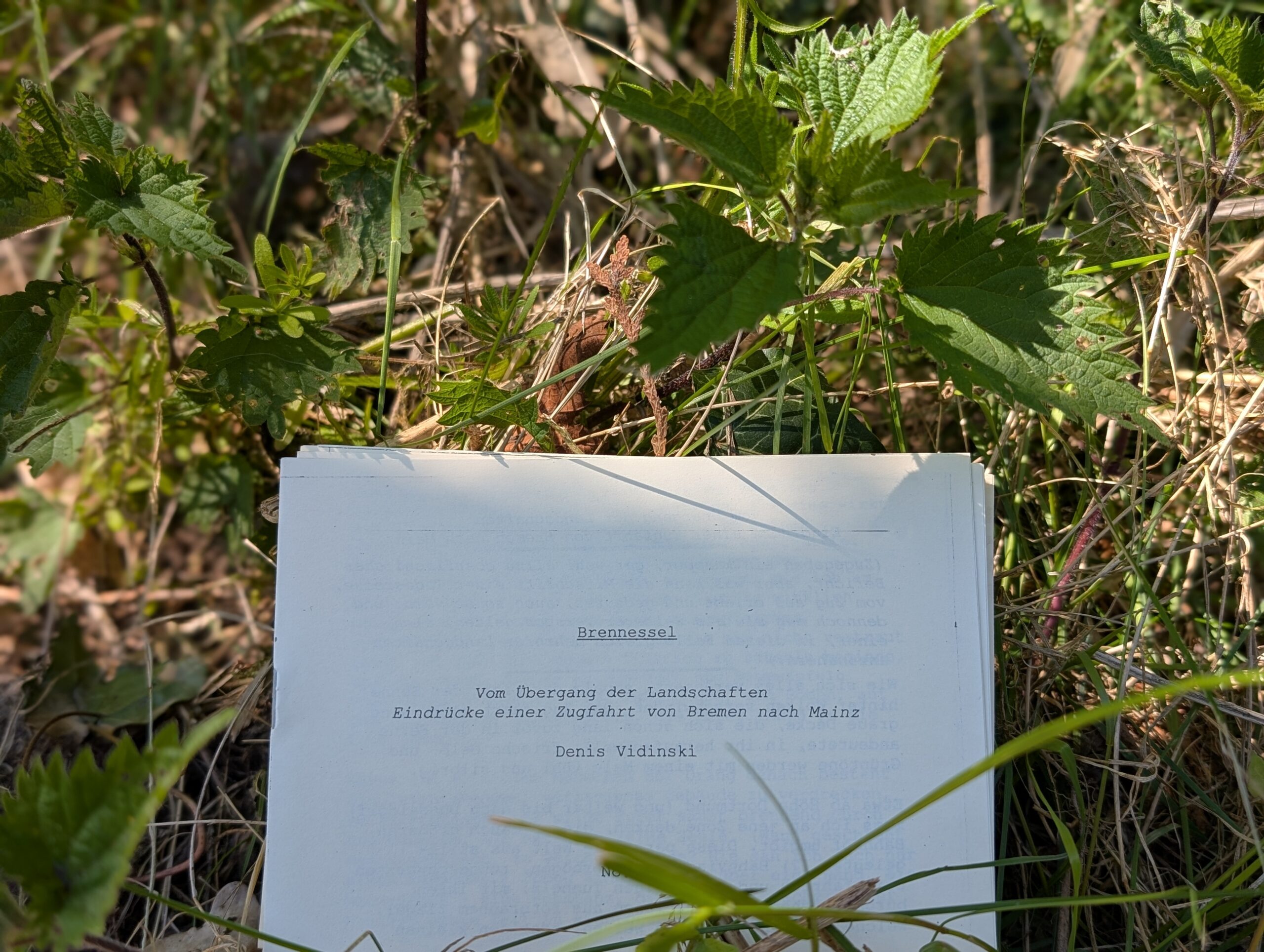Heinrich Carl von Schimmelmann war als Unternehmer, Sklavenhalter und dänischer Staatsfunktionär einer der vermögendsten Männer seiner Zeit in Europa. Er verband wirtschaftliche Interessen mit politischem Einfluss und spielte eine zentrale Rolle in der Finanzpolitik Dänemarks sowie im atlantischen Dreieckshandel.
Heinrich Carl von Schimmelmann wurde 1762 vom dänischen König zum Ritter des Danebrogordens und 1773 zum Ritter des Elefantenordens erhoben. Seine ökonomischen und politischen Aktivitäten führten auch zu sozialer Anerkennung. 1762 erhob ihn der dänische König zum Baron, 1779 zum Lehnsgrafen. Es gelang Schimmelmann darüber hinaus, seine gesellschaftliche Stellung durch Verheiratung seiner Kinder mit Angehörigen des deutschen Adelskreises im dänischen Gesamtstaat zu festigen.
Heinrich Carl von Schimmelmann stammte aus einer bürgerlichen Familie in Demmin (Pommern), wo sein Vater als Ratsherr und Kaufmann tätig war. Statt wie vorgesehen dessen Handelsgeschäft zu übernehmen, gründete er eine Spedition, die Waren zwischen Hamburg und Lübeck transportierte. Nach dem baldigen Konkurs zog er nach Dresden, erhielt dort 1745 als Kaufmann das Bürgerrecht und handelte mit Kolonialwaren wie Zucker, Kaffee und Tee. 1747 heiratete er Caroline Tugendreich von Friedeborn, aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. 1754 pachtete er zusammen mit einem Kompagnon die Generalkonsumptionsakzise auf Kaffee, Tabak, Wein und Branntwein in Kursachsen.
Randbemerkung: Heinrich Carl von Schimmelmann begann eine Kaufmannslehre bei einem Seidenwarenhändler in Stettin, die er jedoch abbrach.
Zu Beginn des Zweiten Schlesischen Kriegs 1745 und erneut im Siebenjährigen Krieg 1756 war Schimmelmann preußischer Heereslieferant. 1758 zog er nach Hamburg, wo er den Grundstock für sein späteres Vermögen durch den Verkauf von Meissner Porzellan legte, das Friedrich II. von Preußen im Krieg konfisziert und ihm für seine Dienste zu einem günstigen Preis überlassen hatte. Zudem betätigte er sich gewinnbringend im Handel mit Münzsilber und kaufte ein Stadtpalais mit Kontor in der Nähe der Hauptkirche St. Michaelis.
1759 erwarb Schimmelmann das Adlige Gut Ahrensburg, wo er aufklärerische Reformen einführte, den Park anlegte und das Dorf Woldenhorn abreißen und neu erbauen ließ. Er betrieb dort eine Kornbrennerei, eine Stärkefabrik, eine Brauerei, eine Korn- und eine Sägemühle. Außerdem kaufte er die Güter Lindenborg im dänischen Nordjütland (1761) und Wandsbek (1762), wo er 1776 ein Waisenhaus mit Kattunfabrik gründete. Dort ließ er zudem ein neues Herrenhaus mit Park errichten, erweiterte den bereits bestehenden Fabrikort und gründete die Zeitung Wandsbeker Bothe, deren Redaktion Matthias Claudius übernahm.
Ab 1761 verlagerte Schimmelmann auf Anregung des dänischen Außenministers Hartwig Ernst von Bernstorff den Mittelpunkt seiner geschäftlichen Aktivitäten nach Kopenhagen und beriet Friedrich V. von Dänemark in finanziellen Angelegenheiten. Er sanierte die Staatsfinanzen durch Kredite, Zwangsanleihen, die Einführung einer Kopfsteuer und den Verkauf der Domänen. Zudem setzte er sich erfolgreich für Agrarreformen sowie den Bau des Eiderkanals (1776-1784) als Verbindung zwischen Nord- und Ostsee ein. Er vermittelte den Gottorfer Vergleich (1768), in dem Dänemark nach jahrhundertelangen Auseinandersetzungen Hamburg gegen hohe Zahlungen als freie Reichsstadt anerkannte. Im selben Jahr ernannte ihn der dänische König zum Schatzmeister.
Schimmelmann vergrößerte sein Vermögen erheblich durch die Verbindung privater und staatlicher Interessen. Neben dem Amt als Schatzmeister und der Mitgliedschaft in zahlreichen wirtschafts- und finanzpolitischen Kommissionen agierte er weiterhin als Großunternehmer, Großaktionär und Direktor der staatlich privilegierten Handelsgesellschaften.
Beim Verkauf der Domänen sicherte er sich 1763 die vier königlichen Zuckerrohrplantagen samt Sklavenarbeitern auf den Karibikinseln St. Croix, St. Thomas und St. Jan in der Kolonie Dänisch-Westindien. Zudem kaufte er die größte Zuckerraffinerie Nordeuropas in Kopenhagen. 1768 übernahm er eine Gewehrfabrik in Hellebek.
Mit Waffen, Branntwein und Stoffen aus seinen Fabriken kaufte er in Westafrika Sklaven, die anschließend auf seinen Zuckerrohrplantagen in Dänisch-Westindien eingesetzt wurden, während seine Schiffe den Rohzucker nach Kopenhagen transportierten. Zu Schimmelmanns geschlossenem Wirtschaftssystem gehörte auch die Nahrungsmittelproduktion auf seinen Gütern für die Versorgung seiner Fabrikarbeiter sowie der rund 1000 Sklaven in der Karibik.
Schimmelmann profitierte zusätzlich als Großaktionär weiterer dänischer Überseehandelskompanien und als deren Handelspartner vom atlantischen Dreieckshandel, etwa in der Dänisch-Guineischen Kompanie und als einer der Direktoren und Aktionäre der halbstaatlichen Westindischen Handelsgesellschaft, die im Sklavenhandel aktiv waren.
Die Erträge des Dreieckshandels samt Sklavenhandel und -arbeit finanzierten in erheblichem Maß die künstlerische und intellektuelle Adelskultur, die Schimmelmanns Töchter Julia von Reventlow und Caroline von Baudissin auf den Gütern Emkendorf und Knoop seit den 1770er-Jahren entfalteten.
Im Zeichen von Aufklärung und pietistischer Religiosität kam es nach Schimmelmanns Tod unter den Erben zu moralischen und ökonomischen Diskussionen über den Besitz von Sklaven, die schließlich zu Ernst von Schimmelmanns Initiative für das 1792 erlassene Verbot des dänischen Sklavenhandels beitrugen. Allerdings wurde in einer Übergangsphase bis 1803 die Zahl der Sklaven in den Schimmelmann’schen Plantagen noch so weit erhöht, dass die Fortsetzung des Zuckerrohranbaus durch eine Steigerung der Geburtenrate gewährleistet blieb.
Eine 2006 in Wandsbek öffentlich aufgestellte Schimmelmann-Büste wurde nach Protesten und Debatten über den zeitgemäßen Umgang mit dem kolonialen Erbe zwei Jahre später entfernt.