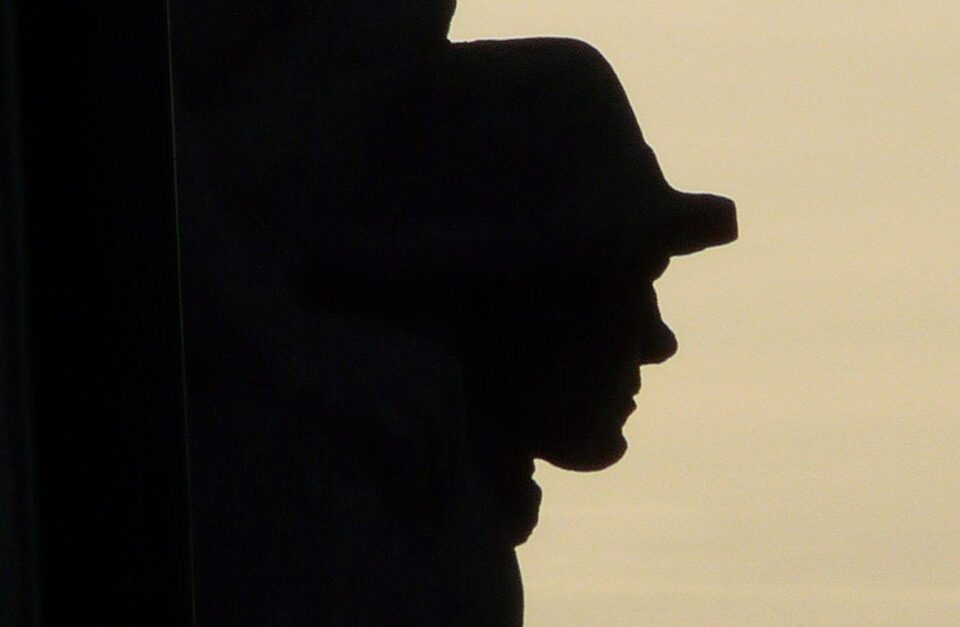Abstammung bedeutet nicht nur
von Männern über Männer zu Männern.
Abstammung bedeutet auch
meine Gewalt
gegen mich eine Hetze.
Abstammung: Immer noch
aus Sternenstaub gemacht. Immer noch
sehr komplex. Immer noch
auf die Spur kommend.
Abstammung im Sinne von:
Ring um den Hals eher auf Schulterhöhe
ein loser Reifen. Ein Reifen
den man fallen lassen kann
aus ihm hinaustreten und sagen:
Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit.
Das ist mein Alltag. So spreche ich.
© Nathalie Schmid – Aus:Ein anderes Wort für einverstanden
Eine Annäherung in zwei Anläufen
1
Das Gedicht beginnt mit einem Widerhall – „Abstammung bedeutet nicht nur“ – und reißt eine Tür auf: Nicht nur Männerlinien, nicht nur Blut. Es klingt, als wolle es eine Ader freilegen, die tiefer liegt als Gene, eine Art Erbe, das schmerzt. „Meine Gewalt / gegen mich eine Hetze“ – hier vibriert etwas Zerrendes. Ist das die Stimme einer Generation, die in den Krallen patriarchaler Erzählungen steckt und gleichzeitig gegen sie anschreit? Die Hetze, der innere Lärm, der sagt: Du bist, was aus dir gemacht wurde – und doch…
Dann der Sprung ins Kosmische: „Immer noch / aus Sternenstaub gemacht.“ Ein Hauch von Carl Sagan, ein Trost im Universellen. Wir sind alle nur Staub, aber dieser Staub funkelt. Hier schimmert eine paradoxe Schönheit: Abstammung als Gefängnis und als Sternenmysterium. Die Zeilen atmen Widerspruch – „sehr komplex“, „auf die Spur kommend“ – als würde das Ich sich selbst wie ein fremder Planet kartografieren.
Der Bruch: Ein „Ring um den Hals“, locker, fast dekorativ. Keine Fessel, die würgt, sondern ein Reifen, den man fallen lassen kann. Wie eine Schlange, die ihre Haut abstreift. Das Bild ist voller sanfter Revolte: Aussteigen aus dem Kreis, der vielleicht Tradition, Erwartung oder Sprache hieß. Und dann der befreiende Akt – „Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit.“ Hier kippt das Gedicht ins Manifestartige. Es ist, als hole das Ich Luft nach Jahrhunderten des Schweigens und spreche sich selbst frei.
Was sagt mir der Text?
Er fühlt sich an wie ein Ritual. Zuerst das Benennen der Wunde (Abstammung als Gewalt), dann das Erinnern an die eigene Magie (Sternenstaub), schließlich die Geste des Abstreifens. Der „lose Reifen“ könnte alles sein: Geschlecht, Herkunft, Sprache – Dinge, die formen, aber nicht besitzen dürfen. Das Gedicht wirft Fragen auf, ohne Antworten zu geben: Wie viel von mir ist Erbe, wie viel Eigenes? Und wann wird der Reifen zur Last, statt zum Schmuck?
Die letzten Zeilen lesen sich wie ein Zauber – eine Selbstermächtigung, die nicht laut poltert, sondern leise, aber entschlossen, den eigenen Raum markiert. Vielleicht ist Abstammung am Ende kein Schicksal, sondern ein Material, das man umschmelzen kann. Aus Sternenstaub und alten Ketten baut das Ich etwas Neues: einen Satz, einen Blick, einen Alltag. Und das klingt nach Freiheit.
Was mich besonders anspricht, ist die Einladung, die eigene Identität als etwas Lebendiges und ständig Im-Werden zu begreifen. Es geht nicht um das starre Festhalten an einem unveränderlichen Erbe, sondern um das ständige Neuaushandeln der eigenen Geschichte und Rolle in der Welt. In einer Welt, in der Tradition und Moderne oft in Widerspruch stehen, schlägt das Gedicht vor, dass es – ähnlich wie der Mensch – immer in Bewegung ist, sich wandelt und dabei immer wieder über sich hinauswächst.
Insgesamt wirkt der Text erfrischend unkonventionell und lässt Raum für persönliche Assoziationen. Er erinnert daran, dass Abstammung und Identität nicht als vorgegebene Schicksalslinie betrachtet werden müssen, sondern als etwas, das man aktiv und selbstbestimmt gestaltet. Diese Leichtigkeit im Umgang mit schwerwiegenden Themen ist es, was mir an diesem Gedicht so sympathisch und befreiend erscheint.
2
Im ersten Durchgang hatte ich – muss ich gestehen, nicht darauf geachtet, wer dieses Gedicht geschrieben hat. ALs ich dann nach Informationen zur Urheberschaft suchte, realisierte ich, dass es sich um die Autorin Nathalie Schmid handelt. Im zweiten Durchgang habe ich versucht, das Gedicht aus der Perspektive Mann-Frau zu lesen. Macht es einen Unterschied in der Leasart, wenn ich weiß, dass das Gedicht aus feministischer, weiblicher Perspektive geschrieben wurde? Und wenn ja, in welcher Form?
Ja, auf eine Weise, die den Text nicht verengt, sondern ihn weiter öffnet.
Der Autorin-Hintergrund wirkt wie ein zusätzliches Fenster, durch das man schaut. Hier einige Gedankenfäden:
Die Körperlichkeit der Abstammung
Wenn eine Frau über „Abstammung von Männern“ schreibt, klingt das nach einer existenziellen Spannung: Blutlinien, die oft über männliche Namen weitergegeben werden, Geburtsurkunden, die Väter als erste Zeugen nennen. Die Zeile „von Männern über Männer zu Männern“ wird dann zur konkreten Anklage gegen ein System, das mütterliche Linien unsichtbar macht. Die „Hetze“ könnte hier auch den gesellschaftlichen Druck meinen, sich in diese Linie einzufügen – oder aus ihr auszubrechen.
Der Ring als Symbol weiblicher Zugehörigkeit?
Der „Ring um den Hals“ – lose, aber präsent – könnte Assoziationen wecken: das Halsband der Ehe, das Korsett der Rollenerwartungen, sogar den Reif der Venus. Wenn eine Frau ihn ablegt, bekommt das Geste des Abstreifens historisches Gewicht: Jahrhunderte, in denen Frauen „Schmuck“ trugen, der zugleich Fessel war. Der Satz „So spreche ich“ klingt dann wie ein Echo von Autorinnen, die lange um ihre Stimme kämpfen mussten.
Sternenstaub vs. Patriarchale Schwerkraft
Das kosmische Bild („Sternenstaub“) steht im Kontrast zur irdischen „Abstammung“. Wenn die Autorin eine Frau ist, könnte dieser Gegensatz auch den Zwiespalt zwischen biologischer Bestimmung („Abstammung als Schicksal“) und dem Wunsch nach Entgrenzung spiegeln. Der Sternenstaub – universell, geschlechtslos – wird zur Gegenwehr gegen die Enge genealogischer Zuschreibungen.
Die Gewalt als internalisierte Macht
„Meine Gewalt / gegen mich eine Hetze“: Wenn die Sprecherin weiblich gelesen wird, könnte dies auf internalisierte Misogynie verweisen – die Selbstkritik, die entsteht, wenn man in Strukturen aufwächst, die Weiblichkeit abwerten. Die „Hetze“ wäre dann der innere Lärm einer Kultur, die Frauen lehrt, sich selbst zu misstrauen.
All das sind Möglichkeiten – keine Fakten. Das Gedicht bleibt vieldeutig. Wichtig ist: Die Autorin als Frau zu kennen, verleiht bestimmten Bildern historische Resonanz, aber es sollte den Text nicht auf eine „weibliche Erfahrung“ reduzieren. Vielleicht geht es hier gar nicht primär um Geschlecht, sondern um Machtstrukturen generell – die Autorin bringt nur eine spezifische Perspektive ein.
Letztlich verändert es die Lesart insoweit, als es den Kampf um Selbstdefinition konkreter macht. Wenn eine Frau sagt: „Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit“, klingt das nach einem Bruch mit jahrhundertealten Schweigegeboten. Der „lose Reifen“ wird dann zum Symbol für alles, was Frauen angelegt wurde – und der Mut, ihn abzustreifen, ohne zu wissen, was darunter liegt.
Doch das Gedicht atmet auch universelle Sehnsucht: Wer bin ich jenseits dessen, was mir auferlegt wurde? Die Antwort liegt vielleicht im Sternenstaub – und im Mut, den eigenen Alltag zu benennen.
Buchinformationen
Nathalie Schmid
Ein anderes Wort für einverstanden
Lyrik
Gans Verlag, Berlin – (externer Link zum Verlag)
ET: 5. März 2025
Hardcover, Fadenbindung
128 Seiten | 18 x 13 cm
22,00 Euro [D] | 22,70 Euro [A]
ISBN: 978-3-946392-56-9
Die Website der Autorin: https://naschmid.ch/
Noch nicht im Bestand. Gefunden habe ich das Gedicht auf der Website von Birgit Böllinger (Büro für Text und Literatur).