In Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den Körper zunächst als Träger biologischer Information ausweist. Doch diese Beobachtung allein greift zu kurz. Denn die Röte der Wangen ist nicht nur ein genetischer Code, sondern potenziell auch ein soziales Signal, aufgeladen mit erlernten Bedeutungen und kulturellen Interpretationen von Emotionen wie Scham oder Verlegenheit. So verschränkt sich das biologische Erbe unmerklich mit der sozialen Prägung.
Ein weiterer Zugang zur Bedeutung des Körpers als Speicher des Erbes findet sich in der bewussten sensorischen Abgrenzung des lyrischen Ichs. Das nächtliche Verschließen der Ohren, um sich auf die „eigenen Körpergeräusche“ zu konzentrieren, ist ein aktiver Akt der Autonomiesuche. Durch die Reduktion äußerer Sinnesreize schafft das Ich einen inneren Raum, der frei von den potenziellen Einflüssen der Familie ist. Dieser Wunsch nach sensorischer Selbstbestimmung steht in einem bemerkenswerten Kontrast zur fragmentierten Erinnerung an die Mutter, deren Präsenz auf die „Beine unter den hellgilben Laken“ reduziert erscheint. Während das Ich aktiv seine Wahrnehmung gestaltet, wird die Mutter in einer distanzierten, fast körperlosen Weise erinnert, was die emotionale Distanz und die unterschiedlichen Modi der Selbstwahrnehmung zwischen den Generationen andeutet.
Lyrische Tradition
Diese Auseinandersetzung mit dem Körper als Träger und als Grenze des Erbes findet Resonanz in der lyrischen Tradition. Denken wir an Sylvia Plaths intensive Körpermetaphorik, in der das Physische oft zum Schauplatz innerer Zerrissenheit und gesellschaftlicher Zwänge wird. Obwohl Hagemanns Ton leiser ist, teilt sie mit Plath das Interesse daran, wie sich Erfahrungen und Prägungen im Körper einschreiben. Auch Durs Grünbeins anatomische Lyrik, die wissenschaftliche Präzision mit existentiellen Fragen verbindet, mag hier anklingen. Beide Dichter betrachten den Körper nicht nur als biologische Gegebenheit, sondern auch als ein Archiv der Geschichte und individuellen Erfahrung.
Über die rein physischen Merkmale hinaus erweitert Hagemanns Gedicht das Konzept des „körperlichen“ Erbes subtil. Das vom Vater geerbte „Interesse an Zoologie“ und die „Bereitschaft, selbst in Tieren (wie meinem Vater) das Gute zu sehen“, verweisen auf die Weitergabe von Wahrnehmungsweisen und Verhaltensmustern, die durch Interaktion und Vorbild internalisiert werden. Selbst die ungewöhnlichen „Erbschaften“ wie die „verformte Jazzschallplatte“ und der „farblose, fast unsichtbare Koi-Fisch“ tragen auf ihre Weise zur Formung des lyrischen Ichs bei und sind über sinnliche Erfahrungen (Hören, Sehen) mit der elterlichen Welt verbunden.
Am Ende bleibt das lyrische Ich als die eigentliche „Erbschaft“ zurück – ein Individuum, geformt durch genetische Anlagen, soziale Prägungen und bewusste Abgrenzungsversuche. Der Körper wird so zum zentralen Medium, durch das sich das Erbe manifestiert, transformiert und letztendlich in der Einzigartigkeit des Einzelnen neu konstituiert. Hagemanns Gedicht lädt dazu ein, die oft unbemerkten Wege zu erkunden, auf denen körperliche Merkmale und Sinneswahrnehmungen unsere Identität prägen und uns mit unserer Herkunft verbinden.


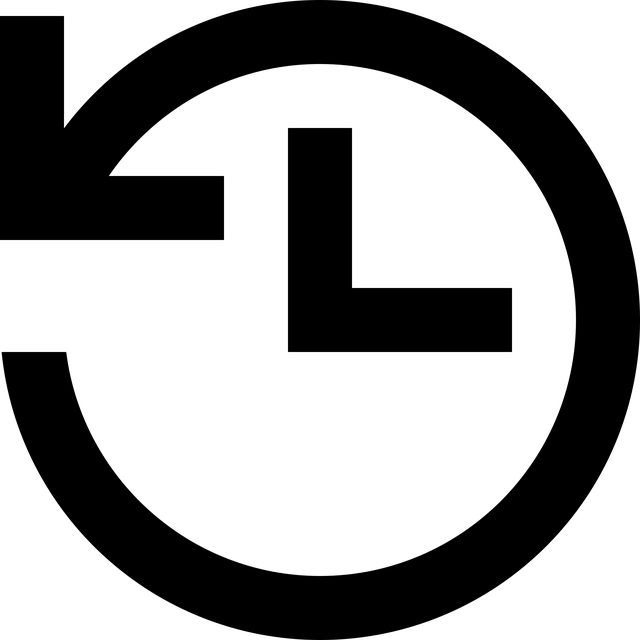
Schreibe einen Kommentar