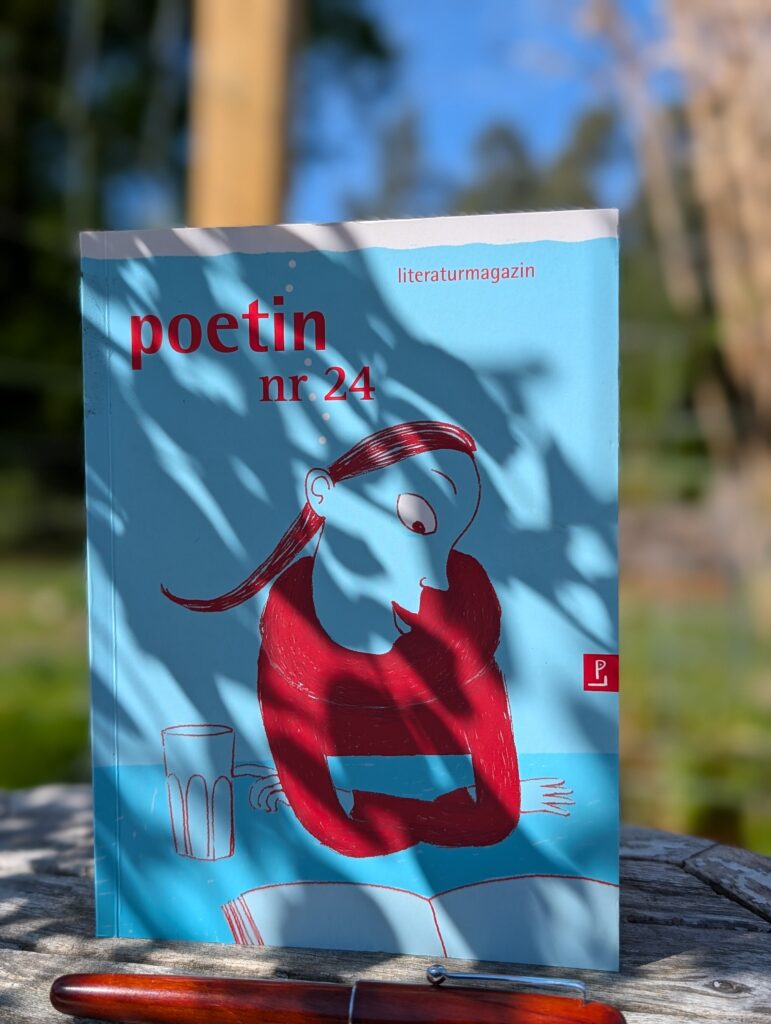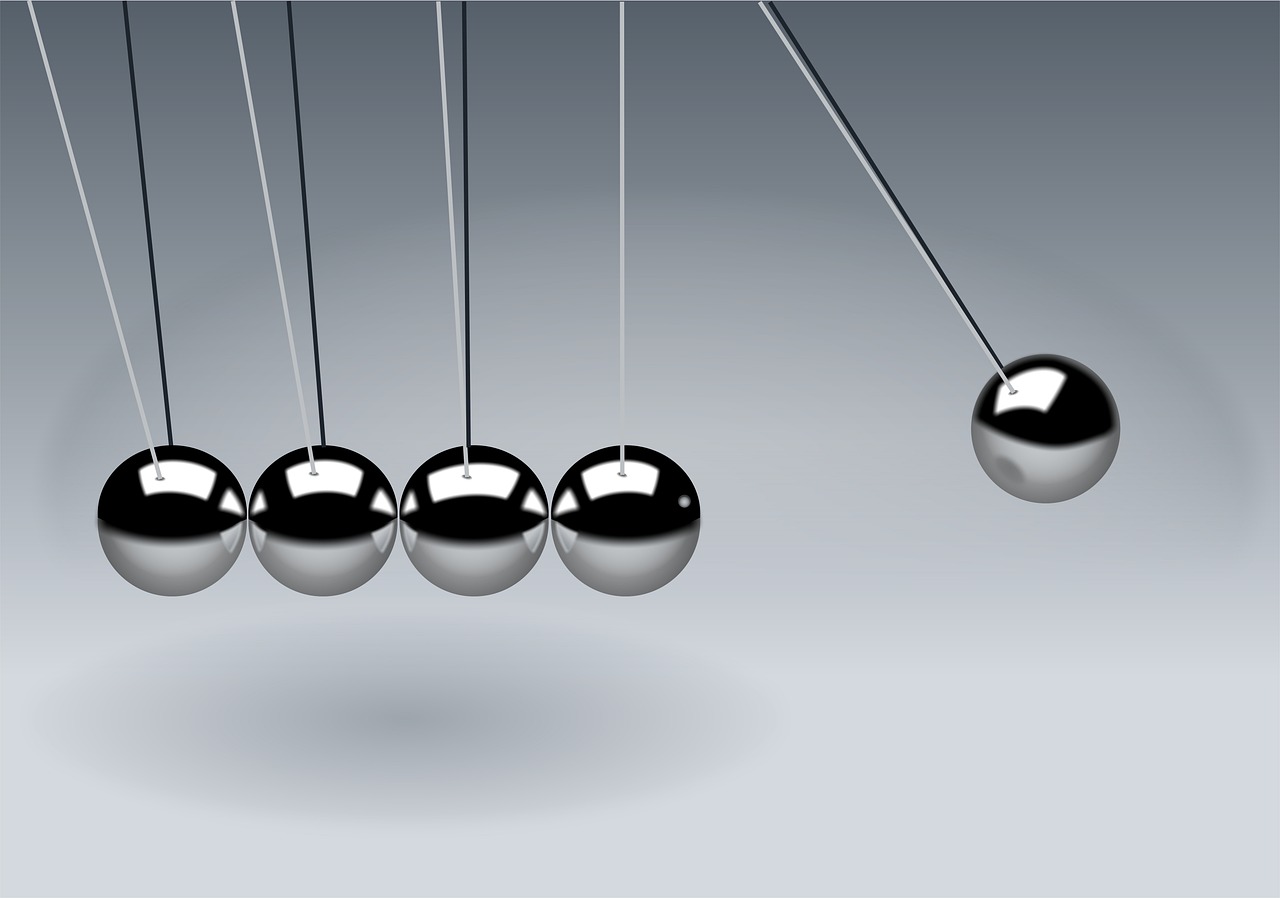In Peter Bichsels Kurzgeschichte „Die Geschichte von den drei Steinen“ steht die Bedeutung sprachlicher Benennung im Zentrum. Ein Mann findet drei gewöhnliche Steine, hebt sie auf und gibt ihnen Namen: „Ich nannte den einen Herrn Babel, den zweiten Herrn Bohm und den dritten Herrn Buht.“ Durch die Namensgebung unterscheidet er sie voneinander und verleiht ihnen Individualität. Die Steine verlieren für ihn ihren ursprünglichen, bloßen Objektcharakter. Sie werden durch Sprache zu etwas Besonderem.
Der Erzähler berichtet, dass er mit den Steinen spricht, über sie nachdenkt und sich sogar über sie freut. „Ich dachte oft an die drei Steine, und ich hatte sie gerne.“ Ich verstehe es so: die Benennung stiftet eine Beziehung zwischen dem Mann und den Steinen. Sprache dient hier nicht nur der Beschreibung, sondern schafft Bedeutung. Die Steine werden durch die Namen zu Trägern von Eigenschaften, über die man nachdenken kann – etwa wenn er sagt: „Ich stellte mir vor, Herr Babel sei dick, Herr Bohm ein wenig dumm, Herr Buht traurig.“
Auch ein Kind wird in diese Welt eingeführt. Der Erzähler zeigt ihm die Steine und bringt ihm bei, wie sie heißen. Das Kind akzeptiert die Namen und übernimmt die Perspektive des Mannes. Es spricht ebenfalls von Herrn Babel, Herrn Bohm und Herrn Buht, ohne zu hinterfragen, warum drei Steine plötzlich als Personen betrachtet werden. So entsteht zwischen den beiden eine geteilte Wirklichkeit, die auf sprachlicher Übereinkunft basiert. Die Steine sind für beide mehr als bloße Gegenstände – sie sind bedeutungsvoll, weil ihnen Bedeutung gegeben wurde.
Diese geteilte Sichtweise wird jedoch durch einen dritten Erwachsenen gestört, der ebenfalls die Steine betrachtet, aber ihre Bedeutung nicht erkennt. „Er lachte und sagte: Das sind ja nur drei Steine!“ Der Mann weist den Einwand zurück und betont erneut, wie sie heißen. Doch der andere bleibt bei seiner objektiven Sichtweise und zerstört letztlich die Beziehung zu den Steinen, indem er sie fortwirft: „Er nahm sie und warf sie weit fort.“ Damit endet die Geschichte.
Die Handlung zeigt exemplarisch, wie Sprache als Mittel der Welterschließung wirkt. Die drei Steine erhalten durch Namen Identität, über sie lässt sich nachdenken und sprechen. Dieses Sprachspiel wird von einem Kind mitgetragen, scheitert jedoch an einem Erwachsenen, der die zugrunde liegende sprachliche Konstruktion nicht akzeptiert. Die Geschichte verdeutlicht, wie Realität durch Sprache und Übereinkunft entsteht, aber auch, wie fragil diese Konstruktion ist, wenn sie nicht geteilt wird.
Aktiv gelesen
Eigentlich eine Kindergeschichte, hat mich ein Aspekt besonders interessiert: eingefahrene Sprach- und Wahrnehmungsmuster bewusst zu unterlaufen und zu hinterfragen. Die Handlung verweist – für mich – auf ein verlorengegangenes Potenzial der Sprache zur Welterschließung, das bei Erwachsenen oft durch Routine, Funktionalität und Konvention verdrängt wird.
Hier einige Ideen:
Alltagsdeutung neu denken: „Ich nenne das anders“
Wähle im Alltag 5–10 Dinge aus, die ich jeden Tag verwende (z. B. Handy, Zahnbürste, Kaffeetasse) und überlege mir für jedes einen neuen Namen, der nicht funktional, sondern emotional, poetisch oder assoziativ ist (z. B. „Herzfunke“ für das Handy, „Mundtänzerin“ für die Zahnbürste).
Eine kleine Reflexion: Wie verändert sich mein Blick auf dieses Objekt?
→ Ziel: Verlangsamung der Wahrnehmung und Neuerschließung durch Sprache.
Gespräch ohne Automatismen
In Paaren oder Gruppen werden Gespräche über scheinbar banale Dinge geführt – aber ohne vorgefertigte Begriffe. Beispiel: Sprich über deinen Arbeitsplatz, aber du darfst das Wort „Arbeit“, „Kollege“, „Chef“ oder „Meeting“ nicht verwenden.
→ Das zwingt zu einer neuen sprachlichen Annäherung an die Realität, die kreativer und bewusster ist.
Worttagebuch: Bedeutungen bewusst umformen
Über einen Zeitraum von 5–7 Tagen wähle ich täglich ein „verbraucht wirkendes“ Wort (z. B. „Zeit“, „Stress“, „Erfolg“) und halte fest: Wie würde ich es umschreiben, wenn ich es neu erfinden müsste? Was bedeutet es für mich heute? Wie hat sich meine Beziehung zu diesem Wort verändert?
→ Dies fördert eine aktive Auseinandersetzung mit Sprache als kulturellem Filter.
Sprachfasten / Wortvermeidung
Ich wähle für einen Tag 1–2 Wörter, die ich ganz bewusst nicht verwenden dürfen (z. B. „müssen“, „Zeit“, „schnell“). Ziel ist nicht Vermeidung um der Vermeidung willen, sondern das bewusste Umgehen, Umkreisen und Ergründen des Begriffes durch Sprache.
→ Das erzeugt ein neues Verhältnis zu Gewohnheitssprache und meinen Denkmustern.
Tascheninhalt erzählen – aber anders
Ein Mitmensch nimmt ein beliebiges Objekt aus der Tasche oder Jacke und sagt:
„Stell dir vor, das wäre kein Schlüssel, sondern …“
Dann wird gemeinsam weitergesponnen: Wer benutzt das? Wozu? Hat es eine Geschichte? –
→ Das darf uns in einen assoziativen, humorvollen und offenen Modus versetzen. Stelle ich mir gut bei langen Autofahrten vor.
Spazieren mit Bedeutungsumkehr
Beim nächsten Spaziergang mit anderen sich gegenseitig Begriffe vorschlagen, die nicht für das stehen, was sie scheinbar bedeuten. Beispiel:
„Stell dir vor, ‚Weg‘ bedeutet nicht, wohin man geht, sondern was man loslässt.“
Gemeinsame Sammlung: „Die drei …“
In einer Runde (z. B. beim Abend mit Freunden) stellt jemand die Frage:
„Wenn du heute drei Dinge benennen dürftest, die für dich heute wichtig waren – egal wie klein – was wären das für Dinge, und wie würdest du sie nennen?“
Beispiel: „Mein Kaffeeduft hieß heute ‚Stille zwischen den Stunden‘.“
Gespräch mit Fragekarten à la Bichsel
Bereite kleine Karten vor mit ungewöhnlichen Fragen wie:
„Gibt es ein Wort, das du nie benutzt, obwohl du es eigentlich magst?“
„Welcher Gegenstand in deinem Leben ist völlig bedeutungslos – und warum vielleicht doch nicht?“
„Wenn du deinem Tag einen neuen Namen geben müsstest, wie würde er heißen?“
→ So entstehen möglicherweise Gespräche, in denen Sprache nicht nur Werkzeug, sondern Spiel- und Erkenntnisraum wird.