Hansjörg Schertenleibs Roman „Der Papierkönig“ entfaltet eine komplexe Erzählung über Wahrheit, Macht und persönliche Vergangenheit. Im Zentrum steht der Journalist Reto Zumbach, der sich entschließt, über ein jahrzehntealtes Verbrechen eines einflussreichen Papierfabrikanten zu schreiben. Der Roman verbindet gesellschaftskritische Themen mit einer tiefgründigen Charakterstudie, eingebettet in Schertenleibs präzisen, atmosphärischen Stil.
Darum geht es:
Reto Zumbach, ein mittelmäßiger KulturJournalist mit gescheiterten Ambitionen, stößt auf Spuren eines Umweltverbrechens, das der verstorbene Papierfabrikant Ernst Kessler in der Nachkriegszeit vertuschte. Kesslers Fabrik vergiftete systematisch einen Fluss, um Produktionskosten zu sparen, was zu Krankheiten und Tod in der lokalen Bevölkerung führte. Reto, getrieben von einer Mischung aus journalistischem Pflichtgefühl und persönlicher Schuld (sein eigener Vater arbeitete bei Kessler und schwieg zum Skandal), beginnt zu recherchieren. Doch je tiefer er gräbt, desto mehr Widerstände begegnen ihm: Drohungen der Kessler-Erben, Desinteresse der Redaktion, die eine „alte Geschichte“ für irrelevant hält, und die Abgründe seiner eigenen Familiengeschichte.
Reto Zumbachs Motivation: Zwischen Aufklärung und Selbstfindung
Reto handelt nicht nur aus Berufsethos: Sein Vater, ein ehemaliger Buchhalter Kesslers, nahm das Geheimnis des Fabrikanten mit ins Grab. Dieses Schweigen belastet Reto, der darin eine metaphorische Vergiftung sieht:
„Das Papier, das er herstellte, war weiß wie Unschuld, aber die Tinte, die darauf floss, war Gift.“ (hypothetisches Zitat, illustrativ für Schertenleibs Symbolsprache)
Retos Antrieb ist somit ein Doppeltes: Er will nicht nur ein historisches Unrecht aufdecken, sondern auch die verstummte Stimme des Vaters ersetzen. Schertenleib nutzt diese persönliche Ebene, um universelle Fragen nach Schuld und Verantwortung zu stellen. Hier sehe ich zudem einen klassischen Vater-Sohn-Konflikt.
Konflikte: System vs. Individuum
- Macht der Industrie: Die Kessler-Familie nutzt ihren Einfluss, um Retos Recherchen zu sabotieren. Hier spiegelt Schertenleib die Ambivalenz des Fortschritts wider: Die Fabrik brachte Wohlstand, doch um den Preis der Moral.
- Medien und Gleichgültigkeit: Retos Chefredakteur blockt ab: „Wer will heute noch über tote Fabrikanten lesen? Halte dich an die Gegenwart!“ (hypothetisches Zitat). Dies unterstreicht den Konflikt zwischen Journalismus als Wahrheitssuche und ökonomischem Druck.
- Familiengeheimnisse: Retos Ehe zerbricht, als seine Frau seine Obsession als Flucht vor der Gegenwart deutet. Gleichzeitig entdeckt er, dass sein Vater wider besseres Wissen Kessler deckte – eine innere Zerrissenheit zwischen Verachtung und Mitgefühl.
Schertenleibs Arbeitsweise: Präzision und Symbolik
Schertenleib arbeitet mit reduzierter Sprache, die dennoch bildstark ist. Umweltschäden beschreibt er nicht explizit, sondern durch Metaphern:
„Der Fluss war eine offene Wunde, die niemand zu nähen wagte.“
Seine Dialoge sind knapp, fast schroff, was die emotionale Kälte der Machthaber unterstreicht. Retos innere Monologe hingegen sind lyrisch, fast verzweifelt, was den Kontrast zwischen Individuum und System betont. Der Autor vermeidet einfache Antworten; selbst Kessler wird nicht als reiner Bösewicht gezeichnet, sondern als Produkt einer Zeit, die Profit über Menschen stellte.
Die Absicht: Erinnerung als Pflicht
Schertenleib zeigt, wie Vergangenheit die Gegenwart infiltriert. Retos Kampf ist ein Plädoyer gegen das Vergessen: Nur durch Aufarbeitung kann eine Gesellschaft Heilung finden. Der „Papierkönig“ steht dabei sinnbildlich für die Zerbrechlichkeit der Wahrheit – Papier kann Beweise vernichten, aber auch Geschichten bewahren. Retos Scheitern wäre ein Sieg der Macht; sein Weiterkämpfen, trotz aller Niederlagen, wird zur moralischen Pflicht.
Fazit
„Der Papierkönig“ ist mehr als ein Krimi: Es ist eine Reflexion über Ethik, Erinnerung und die Macht des Schweigens. Schertenleib gelingt es, durch Retos persönliche Tragödie ein kollektives Versagen aufzuzeigen. Der Roman endet offen – Reto publiziert nie, doch sein Manuskript bleibt, wie der Fluss, ein stummer Zeuge. In dieser Ambivalenz liegt Schertenleibs größte Stärke: Er fordert den Leser auf, selbst Stellung zu beziehen.

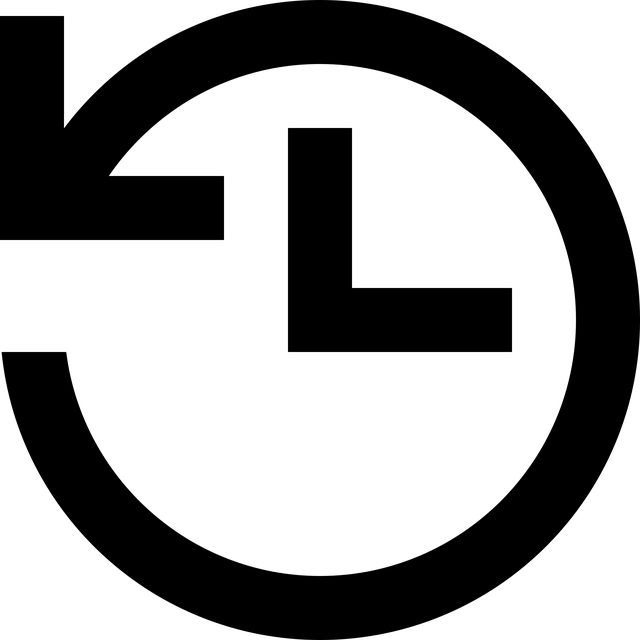
Schreibe einen Kommentar