Ich besitze fast 3.000 Bücher. Eine Zahl, die Ehrfurcht einflößt – und 99 % davon habe ich noch nicht gelesen. Diese Sammlung ist kein Zeugnis literarischer Leidenschaft, sondern ein stummer Konflikt: ein Interesse und ein Sehnen nach fremden, neuen Geschichten, und die gleichzeitige Ablehnung und das Misstrauen ihnen gegenüber.
Die Wurzeln des Widerstreits
In meiner Kindheit und Jugend wurde Lesen nicht zur Freude, sondern zur Pflicht. Bücher waren entweder vorgegebene Werkzeuge der Kontrolle oder Objekte des Spotts, wenn meine eigenen Wahlversuche als „unpassend“ abgetan wurden. Mein Elternhaus, geprägt von psychischer und physischer Gewalt, zwang mich zudem in ein Doppelleben: Nach außen wurde eine heile Familie inszeniert, innen lagen Lügen wie Schutt. Romane, die ich als „erfundene Geschichten“ kennenlernte, wurden so zum Spiegel dieser Heuchelei. Warum sollte ich mich auf Lügen einlassen, wenn sie mich schon umgaben?
In der Schule verstärkte sich das Gefühl des Fremdseins. Während Lehrkräfte in Texten klare Botschaften sahen, erkannte ich Ambivalenzen, Brüche, unausgesprochene Schmerzen – vielleicht weil ich selbst darin geübt war, zwischen den Zeilen zu lesen. Doch statt Anerkennung erntete ich oft Unverständnis. Lesen wurde zum Ort der Ohnmacht.
Der Zwiespalt: Lüge vs. Sehnsucht
Heute steht die ungelese(n)ne Bibliothek als Symbol dieses Paradoxons: Einerseits wecken Bücher in mir eine tiefe Sehnsucht nach Welten, die anders sind als meine eigene. Andererseits triggert der Akt des Lesens Erinnerungen an Kontrolle und Täuschung. Wie kann ich Geschichten vertrauen, wenn ich gelernt habe, Fiktion als Bedrohung zu sehen?
Diese Ambivalenz teilen viele Menschen mit traumatischen Erfahrungen. Studien zeigen, dass Gewalt und emotionale Vernachlässigung in der Kindheit oft zu Schwierigkeiten im Umgang mit narrativen Texten führen – sei es aus Misstrauen gegenüber Autor:innen, aus Angst vor Überwältigung oder wegen des Gefühls, „falsch“ zu verstehen. Gleichzeitig berichten Betroffene häufig von einem unbändigen Wunsch, über Geschichten Heilung zu finden.
Wege zurück zu den Büchern
Wie also die Freude am Lesen (wieder)entdecken? Hier sind Ansätze, die mir und anderen helfen:
- Klein anfangen, Druck rausnehmen
Kein Buch muss „von vorne bis hinten“ gelesen werden. Blättern, querlesen, Absätze überspringen – erlauben Sie sich, Bücher als Werkzeugkoffer zu nutzen, nicht als Pflicht. - Genres jenseits der „Lügengeschichten“
Autobiografien, Sachbücher oder Lyrik können Brücken bauen: Sie erzählen von realen Erfahrungen oder Emotionen, ohne den Beigeschmack der Fiktion. - Gemeinschaft suchen
Leseclubs oder Online-Foren bieten sichere Räume, um Interpretationen ohne Bewertung zu teilen. Hier lernen viele, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt. - Schreiben als Gegenmittel
Tagebücher oder eigene Kurzgeschichten helfen, die Kontrolle über Narrative zurückzugewinnen – und zu spüren, dass Geschichten auch empowern können. - Therapie & Bibliotherapie
Professionelle Begleitung kann dabei helfen, Traumata aufzuarbeiten, die mit dem Lesen verknüpft sind. Bibliotherapie nutzt gezielt Texte, um emotionale Blockaden zu lösen.
Schlussgedanke: Die Wahrheit in der Fiktion
Bücher sind weder reine Lügen noch reine Wahrheiten. Sie sind Möglichkeitsräume – auch für uns, die wir einst lernen mussten, Misstrauen zu überleben. Vielleicht liegt gerade darin die Chance: Indem wir Geschichten neu als Orte der Selbstermächtigung begreifen, statt als Spiegel vergangener Verletzungen.
Meine 3.000 Bücher warten nicht darauf, „abgehakt“ zu werden. Sie warten darauf, dass ich bereit bin, ihnen auf meine Art zu begegnen. Langsam. Fragmentarisch. Mit der Freiheit, auch mal wütend zuzuklappen – und dem Wissen, dass jede Seite ein Schritt sein kann, mich selbst neu zu erzählen.
Dieser Blog soll ein Raum werden, um solche Prozesse zu teilen. Haben Sie ähnliche Erfahrungen? Wie haben Sie Ihre Beziehung zu Büchern neu definiert? Kommentare sind offen – denn Geschichten entstehen erst im Dialog.

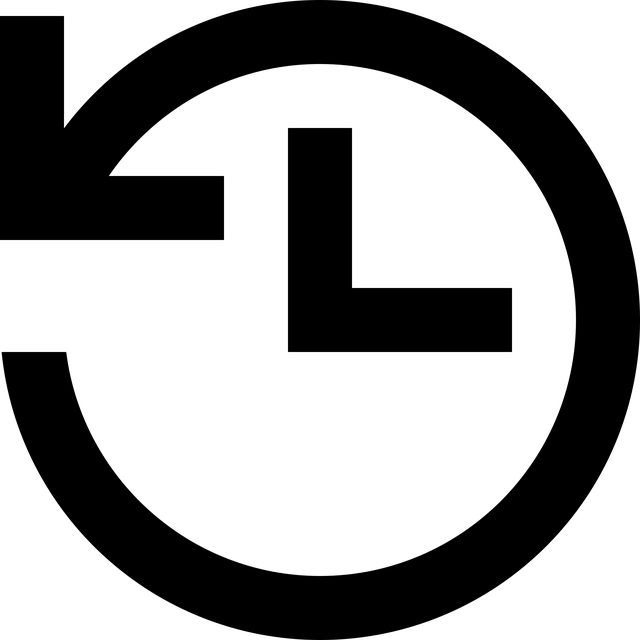
Schreibe einen Kommentar