Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte:
Form und Struktur
Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche Fixierung auf den Begriff wider.
Fragmentarische Kürze: Die kurzen, abgehackten Zeilen erinnern an ein Mantra oder eine Litanei, was die Unerbittlichkeit des Themas unterstreicht. Die Struktur wirkt absichtlich unvollendet, als könne die Aufzählung ewig weitergehen.
Thematische Deutung
Illusion der Lösung:
Die Zeilen „nur einer noch / wirklich / dann wird alles / wieder gut“ suggerieren eine naive Hoffnung, dass mit dem letzten „Einzeltäter“ alle Probleme gelöst seien. Doch die ständige Wiederholung von „noch ein“ entlarvt dies als Trugschluss – die Ursachen liegen tiefer, neue Täter entstehen immer wieder.
Gesellschaftskritik:
Der Begriff „Einzeltäter“ ist oft mit medialen Narrativen verknüpft, die komplexe soziale oder politische Probleme individualisieren. Das Gedicht könnte diese Vereinfachung kritisieren: Indem jede Tat als isoliert dargestellt wird, werden systemische Missstände unsichtbar gemacht.
Vereinsamung und Kollektiv:
Obwohl jeder Täter „allein“ handelt, bildet ihre Häufung paradoxerweise ein Kollektiv. Die Wiederholung unterstreicht, dass Einzeltaten Teil eines größeren Musters sein können – eine Ambivalenz zwischen Individualität und Massenphänomen.
Ironie und Verzweiflung:
Der scheinbar optimistische Schluss „dann wird alles / wieder gut“ wirkt ironisch, da die vorangehende Aufzählung keine Lösung, sondern eine Endlosschleife darstellt. Es bleibt offen, ob die Hoffnung naiv oder zynisch gemeint ist.
Sprachliche Besonderheiten
Aneinanderreihung/Parataxe: Die Reihung gleichwertiger Sätze ohne logische Verknüpfung („und noch ein“, „noch ein“) verstärkt den Eindruck von Beliebigkeit und Überforderung.
Bruch im Schluss: Die abrupte Zeilenwende „und noch ein aller / letzter Einzeltäter“ untergräbt die finale Behauptung – der „letzte“ ist nie wirklich der Letzte.
Meine Lesart
Das Gedicht stellt infrage, warum wir bei Problemen immer nur auf Einzelpersonen zeigen. Es sagt: Wenn wir immer nur „noch einen Einzeltäter“ suchen, vergessen wir die wahren Ursachen – wie Fehler im System oder in der Gesellschaft. Die ständige Wiederholung von „noch ein Einzeltäter“ wirkt wie ein Teufelskreis: Solange wir nicht die tieferen Gründe angehen, kommen immer neue Täter nach. Der Schluss „dann wird alles wieder gut“ klingt deshalb wie Hohn – denn das Gedicht zeigt gerade, dass es nie aufhört, wenn wir nichts ändern.
Kurz: Es geht nicht um einzelne Bösewichte, sondern darum, warum es sie immer wieder gibt. Dieses Gedicht enstammt dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiye Can.
-
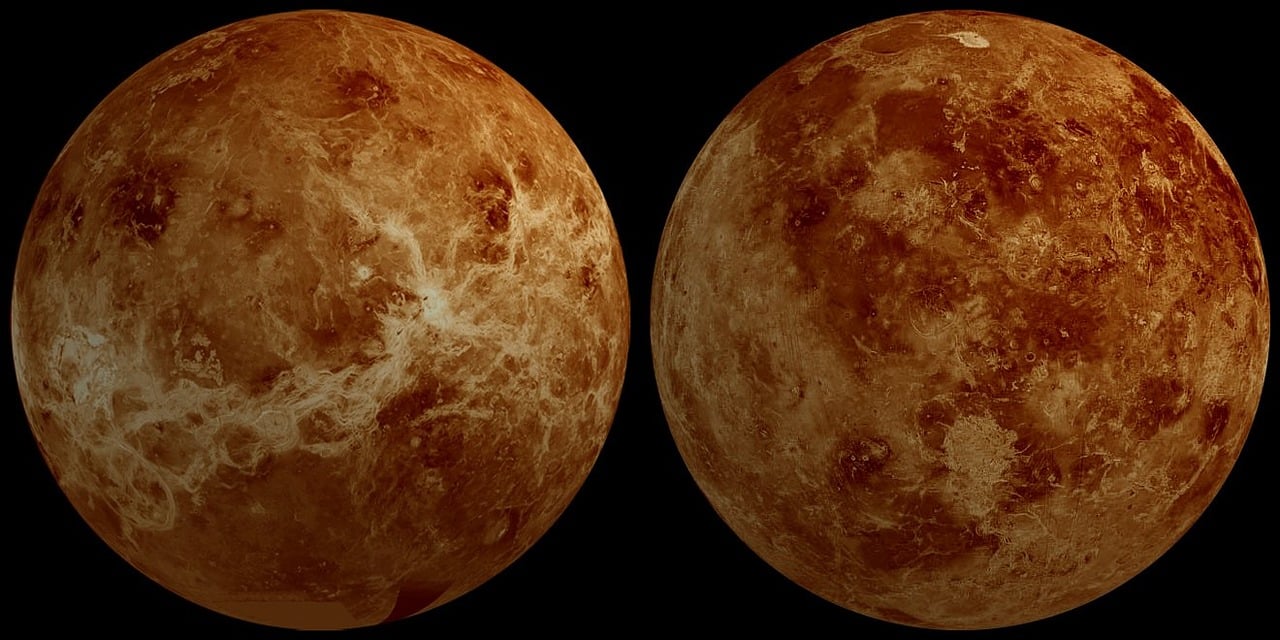
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Wie liest man ein Gedicht, das einen nicht meint?
3–4 MinutenKonkret geht es um dieses Gedicht von Safiye Can: Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung Das Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen.…
-

Die Farbe Lila
1–2 MinutenDie Verbindung zwischen der Farbe Lila im Gedicht Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung von Safiye Can und Die Farbe Lila (Buch/Film) von Alice Walker ist eher indirekt. Dennoch gibt es Überschneidungen in der Symbolik: Alice Walkers Roman Die Farbe Lila (1982) & Film (1985) erzählt vom Überleben und Empowerment/Ermächtigung einer schwarzen Frau (Celie) – heute…
-

Das Patriarchat ist kein Männerclub, sondern ein System
2–4 MinutenAusgangspunkt ist das Gedicht Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung von Safiye Can Warum der Kampf gegen das Patriarchat dominiert – und warum das nicht das Ende der Debatte sein muss Der feministische Diskurs kreist heute unübersehbar um einen Begriff: das Patriarchat. Für viele Männer wirkt das wie ein Generalangriff – als würden sie pauschal zu…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-

Lila und Blau
1–2 Minuten„Die beste Antwort auf ein Gedicht ist ein neues Gedicht.“– Adrienne Rich Ich steh’ im Flur der Jahre,hör’ die Türen knarren:Hier Mutter, die sichmit jedem Atemzugein Stück kleiner macht,dort Großmutter,die schweigenddie Nähte im Teppichzerreißt –bis alles Fadenwerksich löst. Meine Tochter trägt lila Schuhe,tanzt in einen Kreis,der mich nicht ruft.Doch ich höreihr Miteinanderwie einen Fluss,der mich…
-

Blindstellen | Blind stellen?
1–2 MinutenUm das Gedicht Einzeltäter von Safiye Can zu erfassen; hier ein Versuch eigene Worte mit einem veränderten Fokus zu finden: „Blindstellen“ Der Einzeltäter trägt Grau,der Einzeltäter trägt Wut,der Einzeltäter trägt ein Lächeln –und niemand sieht die Rissein der Wand, wo die Drohung stand. „Ein Streit, kein Mord“, sagt das Protokoll.„Ein Einzelfall“, schreibt die Zeitung klein.„Das…
-

Kein Einzelfall
1–2 MinutenBezug nehmend auf das Gedicht Einzeltäter von Safiye Can versuche ich mich in einer kritischen Reflexion das Originalgedicht in konkrete Handlungsimpulse zu übersetzen – weg von Ohnmacht hin zu Empowerment. Hier ein Vorschlag, wie sich Fragestellungen und Aktionsmöglichkeiten ableiten lassen: Fragestellungen für den Einzelnen Warnzeichen erkennen:– „Sehe ich die ‚Risse in der Wand‘ – also…
-

Safiye Can | Lyrikerin
1–2 MinutenSafiye Can, geboren am 24. August 1977 in Offenbach am Main als Kind tscherkessischer Eltern, ist eine deutsche Dichterin, Schriftstellerin, literarische Übersetzerin sowie Künstlerin der konkreten und visuellen Poesie. Sie studierte Philosophie, Psychoanalyse und Rechtswissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und schloss ihr Studium mit einer Magisterarbeit über Friedrich Nietzsches „Also sprach…
-
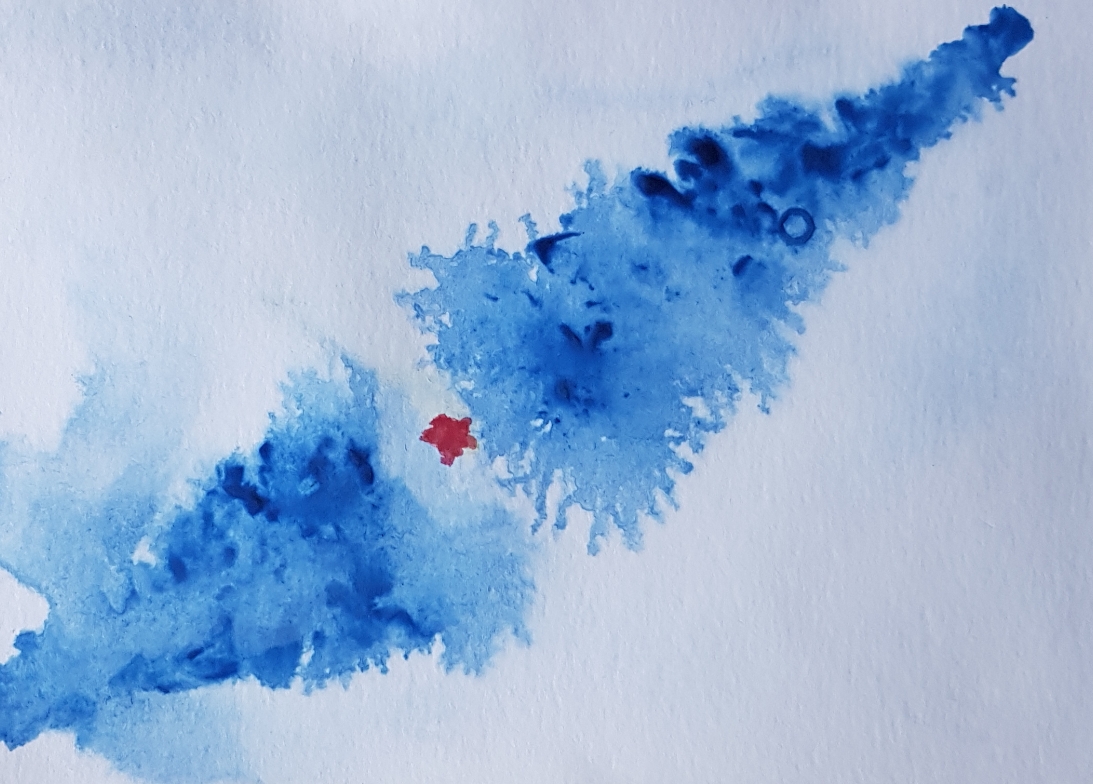
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Safiye Can – Poesie und Pandemie
5–7 MinutenRingen mit Safiye Cans Lyrik: Eine persönliche Annäherung an „Poesie und Pandemie“ und darüber hinaus Beim Eintauchen in Safiye Cans Lyrikband „Poesie und Pandemie“ wurde mir immer wieder bewusst, wie unterschiedlich kollektive Erfahrungen wahrgenommen werden können. Ich habe mit vielen der Texte gerungen – und ringe noch immer mit ihnen. Oft überkam mich das Gefühl,…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
