Die alten Götter sind tot. In diesen Tagen haben wir ihre Bilder zerschlagen und künden laut ein neues Gebot. Volk du bist groß und unbegreiflich in deinem Tun. Volk, dein Schoß läßt die Kinder der Zukunft los. Söhne der Lüge, Söhne der Wahrheit. Brüder im Irrtum, Brüder in Klarheit wirren um dich in buntem Schwarm. Alle liegen in deinem Arm und wollen an deinem Herzen ruhn, Mutter! Ewig junges Angesicht kehrst du nach der Erde hin. Große Allgebärerin, du stirbst nicht. Du bist unsres Lebens Leben, Volk, und unser tiefster Wurzelgrund. Jeder Hauch ist dir ergeben, jede Hand beschwöre neu den Bund. Tod ist Irrtum, Sterben Trug, was da lebt, ist schon gewesen. Immer hebt zu neuem Flug sich der Geist und will in Sternen lesen. Einmal müssen wir genesen, und aus aller Wirrnis uns befrein. Volk, dann wirst du erst geboren sein, wirst dein eignes Antlitz kennen und dich mit dem wahren Namen nennen. Mächtig schwillt das Beten, Rufen, Schrein: Geburt, Geburt
Aus: Karl Bröger | Sturz und Erhebung
Gesamtausgabe der Gedichte
Eugen Diederichs Verlag Jena
1. bis 10. Tausend | 1943
Karl Brögers „Die alten Götter sind tot“ – Ein Gedicht zwischen Revolution und Vereinnahmung
Karl Brögers Gedicht „Die alten Götter sind tot“ entstand in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche: zwischen den Weltkriegen, in der Krise der Weimarer Republik. Es ist ein Werk voller Widersprüche – hymnisch und politisch, mythisch und agitatorisch. Die Nazis versuchten es für sich zu nutzen, doch Bröger selbst entzog sich ihrer Vereinnahmung. Was lässt sich heute noch mit diesem Text anfangen?
Das Gedicht im historischen Kontext
Bröger (1886–1944) war ein Arbeiterdichter, der zunächst der SPD nahestand, später aber auch nationalistische Töne anschlug. Sein Gedicht spiegelt die Suche nach einem neuen kollektiven Mythos nach dem Zusammenbruch alter Ordnungen:
„Die alten Götter sind tot. / In diesen Tagen / haben wir ihre Bilder zerschlagen / und künden laut ein neues Gebot.“
Diese Zeilen erinnern an Friedrich Nietzsches „Gott ist tot“, aber sie sind auch ein Aufruf zur kollektiven Erneuerung – sei sie sozialistisch, nationalistisch oder spirituell.
Warum die Nazis Bröger vereinnahmen wollten
Die NS-Propaganda mochte seine völkisch-pathetische Sprache:
- Das „Volk“ wird als ewige, lebensspendende Kraft dargestellt („Mutter! / Ewig junges Angesicht“).
- Begriffe wie „Geburt“ und „neues Gebot“ ließen sich als Vorwegnahme der NS-„Volksgemeinschaft“ deuten.
Doch Bröger widersetzte sich:
- Er trat nicht der NSDAP bei und blieb seiner sozialdemokratischen Haltung treu.
- Nach 1933 zog er sich zurück, schrieb harmlosere Texte (Naturlyrik, Kinderbücher).
- Die Nazis zensierten später sogar einige seiner Werke – sie passten nicht ins Regime.
Was das Gedicht heute noch aussagt
a) Sprache und Macht
Das Gedicht zeigt, wie unbestimmte Begriffe („Volk“, „Geburt“) politisch umgedeutet werden können.
- Aktueller Bezug: Heutige Populismen nutzen ähnliche Mythen („Wir sind das Volk“, „Great Again“).
b) Die Sehnsucht nach Gemeinschaft
Brögers Text spricht eine tiefe Suche nach Zugehörigkeit aus – eine Reaktion auf die Krisen seiner Zeit.
- Heutige Parallele: In Zeiten von Digitalisierung und Vereinzelung sehnen sich viele nach neuen kollektiven Identitäten (ob in Politik, Subkulturen oder Religion).
c) Kunst zwischen Vereinnahmung und Widerstand
Das Gedicht steht in einer Grauzone:
- Es ist weder eindeutig faschistisch noch klar widerständisch.
- Es wirft die Frage auf: Wie gehen wir mit „belasteter“ Kunst um? Dürfen wir sie lesen, ohne ihre historische Instrumentalisierung zu reproduzieren?
Ein Text, problematisch und wichtig
Brögers Gedicht ist kein unproblematisches Werk, aber ein wichtiges Zeitdokument. Es zeigt:
- die Macht der Sprache,
- die Gefahren politischer Vereinnahmung,
- die ewige Suche des Menschen nach Zugehörigkeit.
Für heutige Lesende ist es vor allem eine Einladung zur kritischen Reflexion:
- Welche „neuen Mythen“ schaffen wir heute?
- Wie vermeiden wir, dass sie zu Werkzeugen der Spaltung werden?


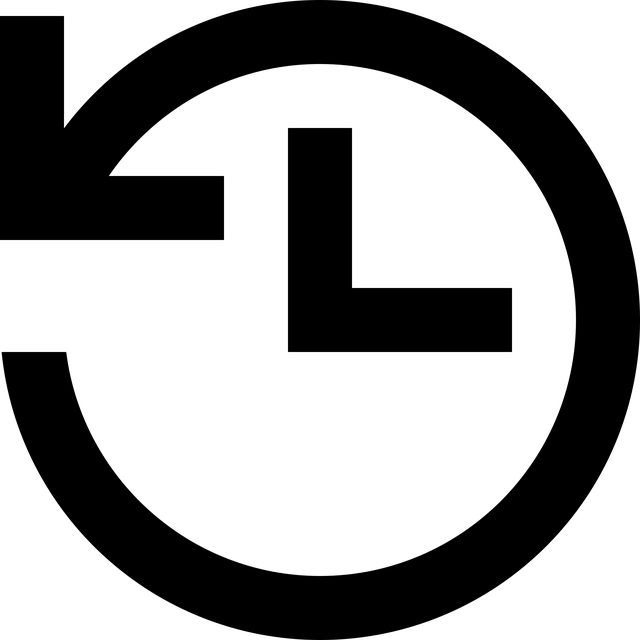
Schreibe einen Kommentar