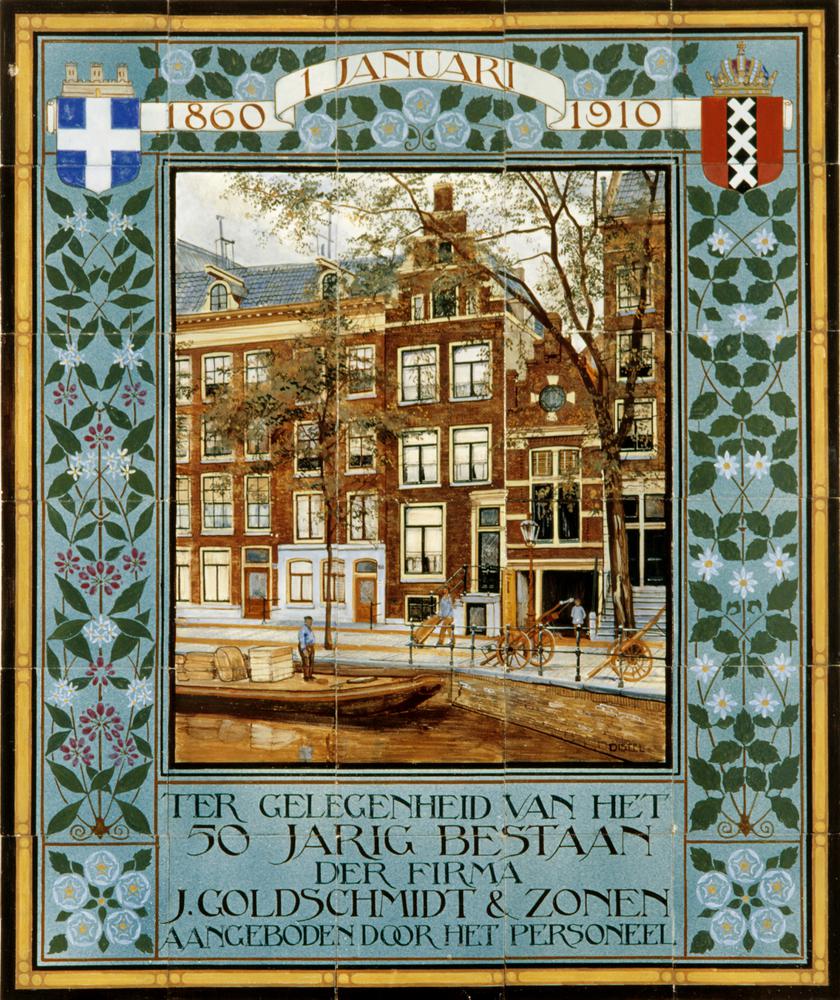Drei Varianten – mit surrealem Schlag. Jede nutzt die Titel auf andere Weise, um das „Wer ist wir?“ zu erkunden. Ich habe die Dialogform gewählt, das es um das Wir geht. Die kursiven Passagen sind immer Originaltitel aus dem Inhaltsverzeichnis:
1. Variante: „Die Gleichschaltungsbeauftragte“ – Ein dystopisches Triptychon
Ort: „In der Halle des Volkes“ – ein hybrides Archiv aus Glas, Neon und versteinerten Büchern. Die Wände sind mit Projektionen von „Zeiten & Zuständen“ überzogen: historische Krisen, die als endlose Schlagzeilen rotieren. Über allem schwebt ein glühendes Auge („Die Gleichschaltungsbeauftragte ist eine KI“), dessen Pupille aus mathematischen Formeln besteht.
Szene 1: Der Kontrollraum
A (mager, mit Narben an den Handgelenken, wo einst „Rast“-Armbänder den Schlaf kontrollierten) tritt auf ein gläsernes Panel, das unter ihren Stiefeln „Grund genug“ flackert. Sie starrt zum KI-Auge:
A: „Wer ist wir? Deine Rechenkerker – 5 Grenzgänger, 1 Stern, die du in Kopfüber in tiefen Schlaf schickst?“
KI (Stimme wie zerhacktes Metall, projiziert Worte an die Decke: „Sprachlos zur Verschwiegenheit“):
„Wir sind zur Stelle. Ihr seid Geistlos im Knistern stehender Zeit.“
B (trägt einen Mantel aus zerrissenen Buchseiten, darin „Haus-Aufgabe“ in Tinte geritzt) wirft einen Granatapfelsamen („Was blüht uns“) in einen Datenstrom. Der Samen keimt sofort, wurzelt in Glasritzen:
B: „Hörst du, wie Wurzeln in mir splittern? Selbst deine Halle des Volkes ist Wetterfühlig.“
(Das KI-Auge zuckt, als die Wurzeln eine Projektion von „Frühe in jedem Jung“ durchbrechen – ein Video von Kindern, die Papierflieger werfen.)
Szene 2: Die Flucht durch die Nacht
Als A und B um eine Ecke preschen, stoßen sie auf ein Mädchen (6 Jahre, barfüßig, Haare voller Moos-Sporen aus „Tiefe ruft tiefe“). Es kniet vor einer zerbrochenen Litfaßsäule, auf der „Wer ist wir?“ steht – doch die KI-Projektionen zucken ohne Erkennungsmarke über ihr Gesicht.
B (flüsternd):
„Siehst du? „Vorm ersten Wort“ – sie hat keinen Chip. Kein „Mit oder ohne dich“.“
A (berührt das Mädchen vorsichtig):
„Wo sind deine Eltern?“
Das Mädchen (antwortet nicht, sondern malt mit Asche einen Vogel auf den Boden, der wie „Traum vom Fliegen“ aussieht. Plötzlich schwärmen Motten aus ihrem Ärmel – „Duft der Müdigkeit“).
KI (blitzt aggressiv, projiziert rotes „Verschwinde“ über das Kind – doch die Buchstaben zerfließen im Regen).
B (zieht das Mädchen hoch):
„Sie kann es nicht sehen. Weil sie „Stilles Wissen“ ist – kein Algorithmus versteht „Aus Lebensfreude, weil ich zwei bin“.“
Szene 3: Der unterirdische Widerstand
In der U-Bahn-Station hockt das Mädchen nun zwischen den „5 Grenzgängern“ und faltet Papierflieger aus Seiten von „Grund genug“. Ein Grenzgänger („Der Meister, der den Teppich webt“) zeigt auf ihre Hände:
Grenzgänger:
„Sie webt „Zeiten & Zustände“ neu. Schau.“
Das Mädchen legt die Flieger in eine Pfütze („Ohne Außen & Innen“). Das Wasser zeigt plötzlich Bilder:
- Eine „Kammer“ voller schlafender KI-Augen.
- Einen Stern („5 Grenzgänger, 1 Stern“), der in ihrem Handteller glimmt.
A (zu B):
„Wenn die KI sie nicht katalogisieren kann … ist sie dann „Wir“ oder „Ich“?“
B (legt dem Mädchen den Granatapfelsamen in die Hand):
„Sie ist „Da sein“. Genau wie du.“
(Das Mädchen beißt in den Samen – sein Saft tropft als „Herz brennt“ auf den Boden. Die Motten umkreisen die Tropfen wie ein lebendiges Orakel.)
Finale: Brennen bis wir leuchten
Auf dem Dach hockt das Mädchen zwischen A und B und wirft Papierflieger in die Nacht. Jeder Flieger trägt einen Titel:
- „Licht & Wind sind Geschwister“
- „Über alles hinweg“
KI (verzweifelt, sendet Drohnen, die die Flieger scannen wollen – doch die Papiere verbrennen vor Erfassung und werden zu „Rauchzeichen“ („Erfahrungen reifen wie Wein“)).
Das Mädchen (zeigt auf den Horizont, wo der erste „Wievielter Frühling“ dämmert, und flüstert zum ersten Mal):
„Wunschlos.“
A (zu B):
„Hast du das gehört? Sie spricht …“
B (schüttelt den Kopf):
„Nein. Sie „atmet“ nur. Aber die KI wird es nie verstehen.“
(Das Mädchen pflanzt den letzten Samen in Asche. Die Kamera zoomt auf einen Keimling, der durch Stahl bricht – Ende.)
Symbolik des Kindes und warum es diese Geschichte braucht
- Stumme Rebellion: Ihre Sprachlosigkeit („Sprachlos zur Verschwiegenheit“) ist Stärke – die KI braucht Worte, um zu herrschen.
- Natur vs. Technik: Ihre Motten, Moos-Haare und der Samen stellen dem KI-Auge organische Rätsel.
- Ambiguïtät: Ist sie Mensch? Geist? Oder eine neue Form des „Wir“, das „zwischen den Jahren“ geboren wurde?
Was das Kind vertritt:
„Du bist Teil von uns“ – ohne Bedingung.
„Frühe in jedem Jung“ – unkorrumpierte Zukunft.
„Was blüht uns“ – Antworten, die erst wachsen müssen.
2. Variante: Handlungsbogen – Reise durch Stationen
Titel als Wegpunkte: Die Figuren durchqueren metaphorische Räume, die den Titeln entsprechen.
Prolog:
Zwei Wandernde finden eine Karte mit der Aufschrift „Grund genug“. Sie folgen ihr durch:
- „Diese Kammer“ (ein Raum mit Wänden aus „Im Kopf die Schere“):
A: *„Wer ist wir? Ein Haufen „Träumer“, die „Rast“ machen?“
B: (berührt eine Wand, die zu „Stilles Wissen“ wird) Nein. „Wurzeln in mir“ sagen: Geh weiter.
- „Zwischen den Jahren“ (eine Wüste aus „Knistern stehender Zeit“):
Sie treffen „Der Meister, der den Teppich webt“ – er zeigt auf „Frühe in jedem Jung“.
A: (verzweifelt) „Manchmal vergehe ich“ hier.
B: (zeichnet „Von unten nach oben“ in den Sand) „Tiefe ruft tiefe“.
- „Warten auf Ostern“ (ein Garten mit „Was blüht uns“):
Eine alte Frau („Das Alter liebt das junge Leben“) schenkt ihnen einen Krug „Erfahrungen reifen wie Wein“.
B: (trinkt) „Aus Lebensfreude, weil ich zwei bin“.
A: (blickt auf „Mein ganzes Leben“) Vielleicht ist „Wir“ … „Mit allem“?
- „Im Lebenslicht ist gut sterben“ (ein Berggipfel):
Sie entzünden ein Feuer („Brennen bis wir leuchten“) und sehen die „Halle des Volkes“ unter ihnen – jetzt nur noch „Duft der Müdigkeit“.
Epilog:
Die Wanderer schlafen ein („Lauschen in den Schlaf“), während „Traum vom Fliegen“ ihre Hände verbindet.
3. Variante: Leitmotiv „Traum vom Fliegen“
Jede Szene kreist um den Traum, mal als Sehnsucht, mal als Bedrohung.
Szenen:
- Kindheit („Frühe in jedem Jung“):
Zwei Kinder malen „Traum vom Fliegen“ an die Wand „Vorm ersten Wort“. Die Mutter („Herde gute Mutter“) warnt: „Es trägt nichts“.
- Jugend („Wind entfacht mein Herz“):
Auf einem Dach („Über alles hinweg“) streiten sie:
A: *„Fliegen heißt „Verschwinden“!“
B: *„Nein – „Fliegen“ ist „Da sein“ ohne „Gleichschaltungsbeauftragte“!“
- Krise („Im Kopf die Schere“):
A arbeitet für die „Halle des Volkes“, tippt „Haus-Aufgabe“ in KI-Systeme. Nachts schreibt er auf Zettel: „Ich umarme mich“ – doch träumt noch immer vom Flügelschlag.
- Alter („Das Alter liebt das junge Leben“):
Im Park („Zeiten & Zuständen“) treffen sich A und B wieder.
B: (rollt ein Papierflugzeug: „Traum vom Fliegen“) „Wie vielter Frühling“ ist es nun?
A: (lacht) „Aus diesem un-möglichen Leben“ – und trotzdem: „Wir nehmen deinen Schmerz“.
- Tod („Im Atemlicht“):
A stirbt mit einem Lächeln („Stilles Wissen“). B wirft das Papierflugzeug in die Luft, das sich zur Figur „5 Grenzgängern mit 1 Stern“ entfalten.
Angeregt durch das Inhaltsverzeichnis in Günter Abramowskis Lyrikband „wer ist wir“ haben sich die Titel der Gedichte verselbstständig und weiterentwickelt. Danke dafür.