Fünf Ansätze für aktives Lesen | Nach der Lektüre von Niemelas „pont des arts“ stellte sich mir die Frage: Gibt es einen sinnvollen Ansatzpunkt, mit dem man nach dem Lesen weiterarbeiten kann? Im Sinne des aktiven Lesens – nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen, selbst ausprobieren?
Hier sind fünf Möglichkeiten, die sich für mich aus dem Gedicht ergeben:
1. Die Klangkette weiterschreiben
„zirzt, ziert sich, resigniert“ – das ist eine Bewegung in drei Schritten. Wörter, die ähnlich klingen, aber deren Bedeutung sich verschiebt. Vom Verführen über das Zieren zum Aufgeben.
Der Versuch: Selbst solche Klangketten bauen. Drei oder vier Wörter finden, die sich reimen oder ähnlich klingen, aber eine Bewegung beschreiben. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Klang und Bedeutung zusammenspielen können. Wie hart oder weich klingen die Wörter? Was passiert, wenn man sie hintereinander sagt?
2. Einen anderen Ort verdichten
Niemela nimmt die Pont des Arts – einen bekannten, touristischen Ort – und löst ihn in Sprache auf. Nicht beschreiben, nicht erzählen, sondern in Bewegung, Klang, Bruchstücke zerlegen.
Der Versuch: Einen anderen Ort nehmen. Vielleicht den Eiffelturm, vielleicht den Berliner Fernsehturm, vielleicht eine U-Bahn-Station. Nicht schreiben „Der Turm ist hoch“, sondern: Was bewegt sich dort? Was klingt? Was riecht? Was bricht, biegt sich, splittert? Was passiert mit dem Ort, wenn man ihn so auflöst? Mein Versuch:
verlassenes haus
fenster starren /
es riecht nach feucht,
als die stufen nachgeben/
zu viel neugier wiegt,
bricht sich in scherbenlicht /
staubzitterbild, wie
schubladen sich öffnen /
schlösser klicken /
schlüssel verschwinden /
räume geben preis,
das intime flieht, fließt
vorbei an kameras / tastet,
nimmt mit, lässt liegen /
das wohnen hat sich ausgeblutet
Bei diesem Versuch habe ich mich für eine Umkehrung entschieden: Bei Kathrin Niemela Überfülle → Ersticken
bei mir Leere → Ausbluten.
3. Das Gedicht verlangsamen
Das Gedicht ist – in meiner Lesart – eine einzige Zeile ohne Pause. Alles fließt ineinander, atemlos.
Der Versuch: Das Gedicht aufbrechen. Wo würde man Zeilen setzen? Wo Strophen? Wo eine Atempause einbauen? Man könnte es auf ein Blatt schreiben und mit Bleistift experimentieren: Hier ein Umbruch, dort eine Lücke. Was verändert sich dadurch am Rhythmus? Wird das Gedicht klarer oder verliert es seine Kraft?
4. Die Bilder isolieren
Das Gedicht arbeitet mit visuellen Momenten: „himmel splittert“, „brücke biegt sich“, „schlüssel ertrinken“. Aber es gibt einem keine Zeit, diese Bilder festzuhalten.
Der Versuch: Die Bilder tatsächlich zeichnen oder skizzieren. Nicht um das Gedicht zu illustrieren, sondern um zu sehen, wo die Sprache ins Bildhafte kippt und wo sie sich entzieht. Was kann man festhalten? Was lässt sich nicht zeichnen? Ein splitternder Himmel – wie sieht der aus? Eine sich biegende Brücke – in welchem Moment? Die Zeichnung muss nicht gut sein. Es geht darum zu merken, wo die Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein.
5. Mit der Struktur spielen
Das Gedicht benutzt Schrägstriche statt Zeilenumbrüchen. Diese Form erzeugt Verdichtung, aber auch Atemlosigkeit.
Der Versuch: Einen eigenen kurzen Text in dieser Form schreiben. Irgendein Thema – ein Spaziergang, ein Gespräch, eine Erinnerung. Aber: keine Zeilen, nur Schrägstriche. Keine langen Pausen, alles muss ineinander fließen. Was macht diese Verdichtung mit der eigenen Sprache? Wird sie präziser oder verkrampfter? Wo fehlt der Atem?
Alle diese Ansätze sind weniger Interpretation als Nachvollzug der Arbeitsweise. Ich verstehe ein Gedicht oft besser, wenn ich versuche, ähnlich zu arbeiten. Nicht um das Original zu kopieren, sondern um zu spüren, was es macht – und wo meine eigenen Grenzen liegen.
-

Wenn das Licht den Raum gibt
3–5 MinutenAm frühen Morgen sah ich im Garten eine vertrocknete Stockrose stehen, unbewegt, unbeirrt. Ein Zimmerlicht fiel schräg von außen auf ihr verblasstes Kleid, und plötzlich wirkte sie nicht mehr ausgebrannt, sondern strahlend. Dieses Strahlen entstand nicht aus der Pflanze selbst, sondern im Zusammenspiel von Körper, Licht und Blick: ein Raum wurde ihr gegeben, und sie…
-

Literatur aus Fotografien
3–5 MinutenBei der Lektüre von John Bergers und Jean Mohrs Eine andere Art zu erzählen stellte sich mir eine Frage: Gibt es Literatur, die überwiegend aus Fotografien besteht – ähnlich wie Comics oder Graphic Novels ihre Geschichten in Bildern erzählen? (Damit meine ich nicht die Foto-Love-Story aus der Bravo die ich in meiner Jugend nicht las.)Die…
-
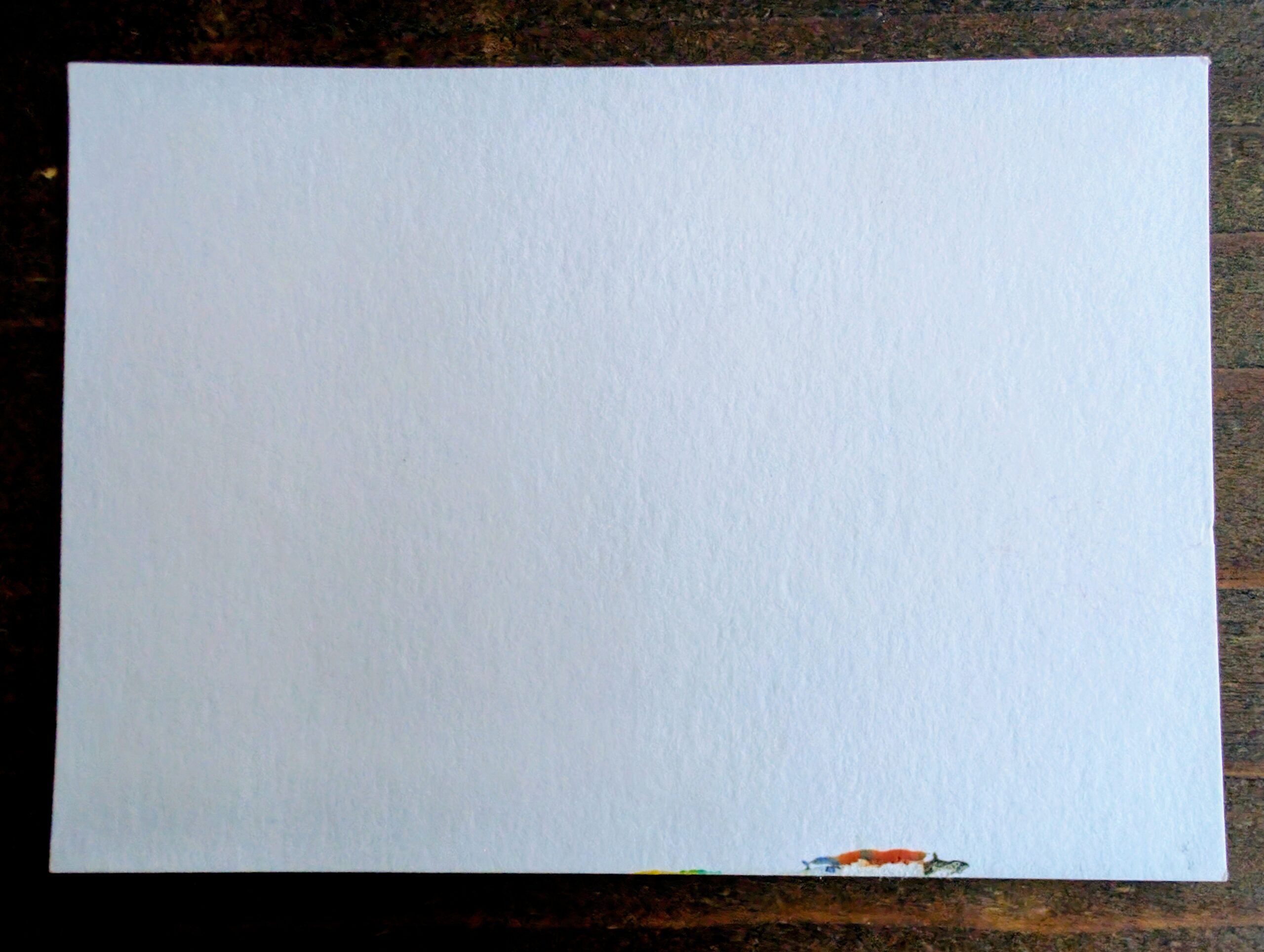
Autobiografie als Spur
Schreiben jenseits der Erinnerung I. Das Problem mit dem Erinnern Wenn Frank Witzel vom Erinnern als „diffuser und unzureichender Prämisse für das Schreiben“ spricht, meint er zunächst das aktive, willentliche Erinnern: Ich setze mich hin, rufe meine Vergangenheit ab, konstruiere aus Fragmenten eine Geschichte. Dieses autobiografische Schreiben ist Arbeit am Material der Erinnerung – Auswahl,…
-

Schreiben im reinen Präsens. Ein Experiment nach Frank Witzel
Frank Witzel beginnt seinen Text über vergessene, verkannte und verschollene Autoren mit einem Eingeständnis: Der Vorgang des Erinnerns, obwohl er sein gesamtes literarisches Schaffen zu durchziehen scheint, erscheint ihm als „diffuse und unzureichende Prämisse für das Schreiben“. Was auf den ersten Blick wie eine Selbstkritik klingt, entpuppt sich als radikale Sehnsucht nach einem anderen Schreiben…
-

Wolfgang Mattheuer als Erzählanlass – Werkstattbericht
6–8 MinutenWarum ich zögere | Ich lese Wolfgang Mattheuers Buch Äußerungen und zögere – immer wieder. Nicht, weil mich seine Bilder kalt lassen – im Gegenteil. Sie ziehen mich an, sie reizen mich, sie erzählen mir Geschichten, bevor ich selbst anfange zu schreiben. Aber genau da beginnt mein Zögern: Darf ich das überhaupt? Darf ich als…
-

Exkurs: Weiterarbeiten mit „pont des art“
2–4 MinutenFünf Ansätze für aktives Lesen | Nach der Lektüre von Niemelas „pont des arts“ stellte sich mir die Frage: Gibt es einen sinnvollen Ansatzpunkt, mit dem man nach dem Lesen weiterarbeiten kann? Im Sinne des aktiven Lesens – nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen, selbst ausprobieren? Hier sind fünf Möglichkeiten, die sich für mich aus dem…
-

Wenn Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein
4–6 MinutenÜber Kathrin Niemelas „pont des arts“ | Kathrin Niemelas Gedicht „pont des arts“ erschien in der Literaturzeitschrift Wortschau in einer Paris-Ausgabe. Es ist ein Text, der sich beim ersten Lesen entzieht – nicht weil er hermetisch wäre, sondern weil er so verdichtet ist, dass man ihn kaum greifen kann. Die Sprache ist präzise, die Klänge…
-

Den Mund über Wasser halten
6–9 MinutenEin Essay über männliche Verantwortung im Angesicht von Femiziden I. Das Gedicht als Warnsignal Kathrin Niemelas Gedicht „Beckenendlage“ beginnt mit einem medizinischen Begriff – einer riskanten Geburtslage – und endet im Ertränkungsbecken. Es verbindet die Hinrichtung verurteilter „Hexen“ im isländischen Drekkingarhylur mit Agnes Bernauer in der Donau und mit den ertrinkenden Frauen im Mittelmeer. Der…
-

Sarah Kirschs Gedichte verstehen – Eine Annäherung
4–7 MinutenWer zum ersten Mal ein Gedicht von Sarah Kirsch liest, steht oft vor einem Rätsel. Da ist die Rede von Bäumen und Vögeln, von Wetter und Landschaften – aber irgendwie schwingt da mehr mit, als man auf den ersten Blick sieht. Wie kann man sich dieser eigenwilligen Dichterin nähern, die aus der DDR stammte und…
-

lonesome journalist
4–7 MinutenEine literarische Spurensuche | Als Kultur- und Literaturblogger begegne ich immer wieder Romanen, die mehr sind als nur fiktive Geschichten – sie sind Spiegel der Medienrealität und zugleich Sehnsuchtsorte für das, was der Journalismus verloren zu haben scheint. Hansjörg Schertenleibs Roman „Der Papierkönig“ ist ein solches Werk: eine literarische Meditation über die Einsamkeit des recherchierenden…
-

Atmen, Handeln, Lesen: Michael Fehr und das bewegte Lesen
3–4 MinutenLaut gedacht | Ein Plädoyer für das körperliche Erleben von Literatur Der Atem gehört zum Erzählen «In der Schriftkultur haben wir völlig vergessen, dass der eigentliche Inhalt von Erzählung der Atem ist», sagt der Schweizer Autor Michael Fehr. Das klingt erst mal seltsam. Aber Fehr hat einen Punkt: Geschichten kommen aus dem Körper. Aus Atem,…

