Fünf Ansätze für aktives Lesen | Nach der Lektüre von Niemelas „pont des arts“ stellte sich mir die Frage: Gibt es einen sinnvollen Ansatzpunkt, mit dem man nach dem Lesen weiterarbeiten kann? Im Sinne des aktiven Lesens – nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen, selbst ausprobieren?
Hier sind fünf Möglichkeiten, die sich für mich aus dem Gedicht ergeben:
1. Die Klangkette weiterschreiben
„zirzt, ziert sich, resigniert“ – das ist eine Bewegung in drei Schritten. Wörter, die ähnlich klingen, aber deren Bedeutung sich verschiebt. Vom Verführen über das Zieren zum Aufgeben.
Der Versuch: Selbst solche Klangketten bauen. Drei oder vier Wörter finden, die sich reimen oder ähnlich klingen, aber eine Bewegung beschreiben. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Klang und Bedeutung zusammenspielen können. Wie hart oder weich klingen die Wörter? Was passiert, wenn man sie hintereinander sagt?
2. Einen anderen Ort verdichten
Niemela nimmt die Pont des Arts – einen bekannten, touristischen Ort – und löst ihn in Sprache auf. Nicht beschreiben, nicht erzählen, sondern in Bewegung, Klang, Bruchstücke zerlegen.
Der Versuch: Einen anderen Ort nehmen. Vielleicht den Eiffelturm, vielleicht den Berliner Fernsehturm, vielleicht eine U-Bahn-Station. Nicht schreiben „Der Turm ist hoch“, sondern: Was bewegt sich dort? Was klingt? Was riecht? Was bricht, biegt sich, splittert? Was passiert mit dem Ort, wenn man ihn so auflöst? Mein Versuch:
verlassenes haus
fenster starren /
es riecht nach feucht,
als die stufen nachgeben/
zu viel neugier wiegt,
bricht sich in scherbenlicht /
staubzitterbild, wie
schubladen sich öffnen /
schlösser klicken /
schlüssel verschwinden /
räume geben preis,
das intime flieht, fließt
vorbei an kameras / tastet,
nimmt mit, lässt liegen /
das wohnen hat sich ausgeblutet
Bei diesem Versuch habe ich mich für eine Umkehrung entschieden: Bei Kathrin Niemela Überfülle → Ersticken
bei mir Leere → Ausbluten.
3. Das Gedicht verlangsamen
Das Gedicht ist – in meiner Lesart – eine einzige Zeile ohne Pause. Alles fließt ineinander, atemlos.
Der Versuch: Das Gedicht aufbrechen. Wo würde man Zeilen setzen? Wo Strophen? Wo eine Atempause einbauen? Man könnte es auf ein Blatt schreiben und mit Bleistift experimentieren: Hier ein Umbruch, dort eine Lücke. Was verändert sich dadurch am Rhythmus? Wird das Gedicht klarer oder verliert es seine Kraft?
4. Die Bilder isolieren
Das Gedicht arbeitet mit visuellen Momenten: „himmel splittert“, „brücke biegt sich“, „schlüssel ertrinken“. Aber es gibt einem keine Zeit, diese Bilder festzuhalten.
Der Versuch: Die Bilder tatsächlich zeichnen oder skizzieren. Nicht um das Gedicht zu illustrieren, sondern um zu sehen, wo die Sprache ins Bildhafte kippt und wo sie sich entzieht. Was kann man festhalten? Was lässt sich nicht zeichnen? Ein splitternder Himmel – wie sieht der aus? Eine sich biegende Brücke – in welchem Moment? Die Zeichnung muss nicht gut sein. Es geht darum zu merken, wo die Sprache Bilder erzeugt, ohne Bilder zu sein.
5. Mit der Struktur spielen
Das Gedicht benutzt Schrägstriche statt Zeilenumbrüchen. Diese Form erzeugt Verdichtung, aber auch Atemlosigkeit.
Der Versuch: Einen eigenen kurzen Text in dieser Form schreiben. Irgendein Thema – ein Spaziergang, ein Gespräch, eine Erinnerung. Aber: keine Zeilen, nur Schrägstriche. Keine langen Pausen, alles muss ineinander fließen. Was macht diese Verdichtung mit der eigenen Sprache? Wird sie präziser oder verkrampfter? Wo fehlt der Atem?
Alle diese Ansätze sind weniger Interpretation als Nachvollzug der Arbeitsweise. Ich verstehe ein Gedicht oft besser, wenn ich versuche, ähnlich zu arbeiten. Nicht um das Original zu kopieren, sondern um zu spüren, was es macht – und wo meine eigenen Grenzen liegen.
-

Im Dialog mit dem Gedicht
2–3 minutesEinige Überlegungen | Die herkömmliche Gedichtinterpretation folgt meist einem analytischen Schema: Wir sezieren den Text, ordnen Stilmittel zu und formulieren eine Deutung. Doch was passiert, wenn wir stattdessen versuchen, mit dem Gedicht ins Gespräch zu kommen? Am Beispiel von Nathalie Schmids Gedicht „im namen der eisheiligen“ habe ich drei alternative Methoden erprobt. Das Rollengespräch: Dem…
-
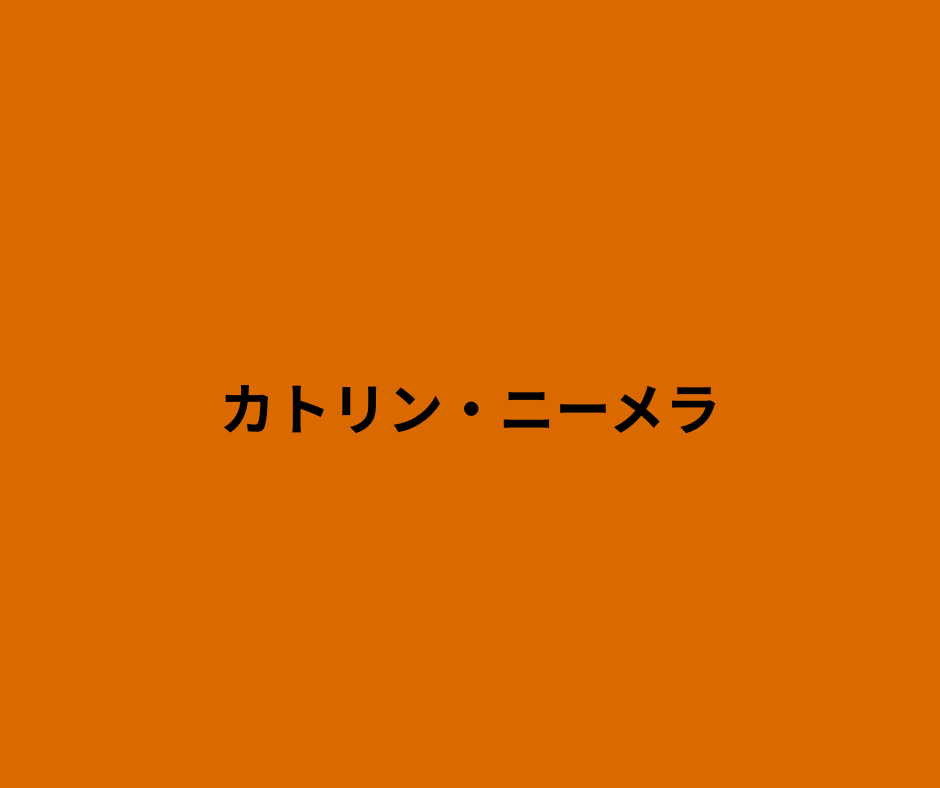
Kathrin Niemela
3–4 minutes„kriegen kinder von / fremden Gedichten“ – dieser Satz aus einem Gedichtzyklus ‚die süße unterm marmeladenschimmel‘ in wenn ich asche bin,lerne ich kanji hat sich mir eingebrannt. Er wurde zum Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit ihren Texten. Kathrin Niemela wurde 1973 in Regensburg geboren. Nach Studien in Romanistik, Politologie und Jura absolvierte sie ein betriebswirtschaftliches Studium…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 minutesEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…



Schreibe einen Kommentar