Ein literarischer Essay zu Kurt Martis Subjektivität
„Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.“ – Kurt Marti
Was soll das heißen – „unbeirrt subjektiv sein“? Ist Subjektivität nicht genau das, was wir in rationalen Diskursen zu überwinden suchen? Je länger ich über Martis Worte nachdenke, desto klarer wird mir, dass hier ein fundamentaler Widerstand formuliert wird – einer, der sich in der Literatur immer wieder spiegelt.
Marti spielt mit einem Spannungsverhältnis: „objektive Notwendigkeit“ versus „subjektiv sein“. Mit „objektiver Notwendigkeit“ meint er das, was als unvermeidlich, logisch, rational und von übergeordneter Autorität hergeleitet dargestellt wird – politische Entscheidungen, Kriegshandlungen, Unterdrückung, Gewalt, die mit Sachzwängen oder angeblich „höherer Vernunft“ begründet werden. „Terror“ steht hier nicht nur für physische Gewalt, sondern allgemein für Handlungen, die anderen Schaden zufügen und sich gleichzeitig durch eine scheinbar unanfechtbare Begründung rechtfertigen: „Wir mussten so handeln.“
Diese behauptete Objektivität soll Kritik von vornherein delegitimieren. Wer sich widersetzt, stellt sich vermeintlich gegen die Vernunft selbst. Genau hier setzt Martis Gegenmittel an: die „unbeirrte Subjektivität“. Sie bedeutet nicht Willkür oder Egoismus, sondern das Beharren auf der eigenen Wahrnehmung, dem eigenen Gewissen und der persönlichen Verantwortung.
Die innere Haltung als Fundament
Martis Satz ist zunächst eine innere Haltung, eine Art ethische Selbstverortung. „Unbeirrt subjektiv sein“ bedeutet, sich nicht von großen, scheinbar unanfechtbaren Begründungen einschüchtern zu lassen, sondern den eigenen inneren Kompass nicht zu verlieren. Es ist wie ein stilles „Ich glaube nicht alles, nur weil es als notwendig dargestellt wird“.
Diese Subjektivität kann das „Objektive“ hinterfragen: Stimmt es wirklich, dass diese Handlung notwendig ist? Wer profitiert davon? Wer leidet? Sie bringt das Leid einzelner ins Blickfeld, denn Zahlen und Notwendigkeiten können Menschen unsichtbar machen – Subjektivität gibt ihnen Gesicht und Stimme.
Die Betonung liegt auf dem „unbeirrt“ – also darauf, sich nicht verunsichern zu lassen. Das ist zunächst eine Frage der eigenen geistigen Unabhängigkeit und Klarheit. Diese innere Haltung ist die Voraussetzung für alles weitere. Denn wer innerlich bereits der Illusion der „alternativlosen Objektivität“ erlegen ist, kann kaum noch authentischen Widerstand leisten.
Literarische Spiegelungen: Von Antigone zu Dürrenmatt
Ein klassisches literarisches Beispiel, das Martis Gedanken illustriert, ist Sophokles‘ „Antigone“. König Kreon hat nach einem Bürgerkrieg befohlen, dass der gefallene Polyneikes nicht bestattet werden darf. Er begründet das mit Staatsräson – es sei notwendig, den Verräter zu bestrafen, um Ordnung und Sicherheit im Staat zu wahren. Das ist seine „objektive Notwendigkeit“: Gesetz, Macht, Vernunft der Herrschaft.
Antigone widersetzt sich diesem Befehl. Sie sagt: Meine Pflicht gegenüber dem Bruder und den göttlichen Gesetzen steht höher als dieses Menschengebot. Sie bestattet ihn trotzdem und nimmt den Tod in Kauf. Kreon argumentiert mit Logik und Staatsinteresse (scheinbar objektiv), Antigone dagegen mit innerem Maßstab: Pietät, Familie, göttliche Ordnung, die nicht messbar ist.
Diese subjektive Haltung wirkt wie ein Spiegel: Sie macht sichtbar, dass das, was Kreon als „notwendig“ ausgibt, auch grausam, unrecht und begrenzt sein kann. Antigones Tat ist zunächst kein öffentlicher Diskurs, sondern eine private Gewissensentscheidung, die später aber politisch wird.
Ein modernes Beispiel, das Martis Gedanken noch schärfer spiegelt, ist Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“. Die Milliardärin Claire Zachanassian bietet ihrer verarmten Heimatstadt eine riesige Geldsumme an – aber nur unter der Bedingung, dass die Bürger ihren ehemaligen Liebhaber Alfred Ill töten. Anfangs sind alle empört: „Man kann doch keinen Menschen für Geld töten!“ Doch je mehr die Notwendigkeit des Geldes betont wird („Wir brauchen es für die Zukunft unserer Kinder, es ist objektiv das Beste für alle“), desto mehr kippt die Stimmung.
Dürrenmatt zeigt, wie leicht sich Menschen hinter scheinbar neutralen oder objektiven Gründen verstecken, um Grausames zu rechtfertigen. Die Bürger sehen sich nicht als Täter, sondern als Handelnde im Dienst des Gemeinwohls. Sie geben der Tat ein Mäntelchen der Logik: „Wir tun es für die Allgemeinheit.“
Herta Müllers „Atemschaukel“
Ein weniger mainstream gewordenes, aber nicht minder eindringliches Beispiel finde ich in Herta Müllers „Atemschaukel“. Müller erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in sowjetische Arbeitslager deportiert wird. Die Deportation wird mit „objektiver Notwendigkeit“ begründet – Wiederaufbau, historische Gerechtigkeit, staatliche Ordnung. Doch Müller lässt ihren Protagonisten mit einer unbeirrt subjektiven Stimme erzählen: von Hunger, Kälte, von der Sehnsucht nach einem Löffel Suppe, von kleinen Momenten der Menschlichkeit.
Diese subjektive Erzählweise wird zum Widerstand gegen die große politische Erzählung. Sie macht das Leid sichtbar, das hinter den objektiven Notwendigkeiten verschwindet. Der Protagonist widersteht nicht durch lauten Protest, sondern durch das Beharren auf seiner eigenen Wahrnehmung, seinem eigenen Erleben – und gerade dadurch entlarvt er die Unmenschlichkeit des Systems.
Von innen nach außen
Was mich an Martis Gedanken besonders fasziniert: Diese Subjektivität muss nicht unbedingt laut sein, aber sie muss standhaft bleiben. Es kann durchaus Wirkung nach außen haben – wenn diese subjektive Haltung stark ist, führt sie oft irgendwann zu äußerem Handeln, sei es in Form von Fragen, Diskussionen, Widerspruch oder auch einfach dadurch, dass man Entscheidungen anders trifft.
Viele Menschen, die im Dritten Reich Juden versteckten, leisteten keinen lauten Protest. Sie folgten „nur“ ihrem Gewissen, also einer inneren Subjektivität – und genau diese persönliche Haltung war das Gegengewicht zur angeblich „objektiv notwendigen“ Verfolgungspolitik.
Das Literarische als Raum des Subjektiven
Vielleicht ist das auch der Grund, warum mich Literatur abstößt und anzieht: Sie ist ein Raum, in dem Subjektivität nicht als Schwäche gilt, sondern als Erkenntnisweg. Literatur zeigt uns immer wieder, dass hinter den großen objektiven Wahrheiten Menschen stehen – mit ihren Ängsten, Hoffnungen, ihrer Verletzlichkeit. Sie mahnt uns, nicht alles zu glauben, nur weil es als rational und notwendig verkauft wird.
Marti ruft nicht zu Egoismus auf, sondern zu innerer Standhaftigkeit: In einer Welt, in der Gewalt und Macht sich gern hinter „Notwendigkeiten“ verstecken, bleibt das individuelle, subjektive Gewissen ein unverzichtbares Gegengewicht. Es beginnt im Inneren, aber es kann – und muss manchmal – zu Handlung werden, die Widerstand leistet gegen die kalte Logik der Macht.
Dieser Essay entstand aus dem Wunsch heraus, Literatur nicht nur zu konsumieren, sondern sie als Denkraum zu nutzen – als Ort, wo sich zeigt, was es bedeutet, unbeirrt subjektiv zu sein.
-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee
Annähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen…
-

Olga Benario Prestes: Literarisches Porträt und Nachleben
Tätigkeit als Autorin | Olga Benario verfasste 1929 in Moskau die Schrift „Berlinskaja komsomolija“ (Der Berliner kommunistische Jugendverband), die auf Russisch erschien. 2023 erschien dieser Text erstmals…
-
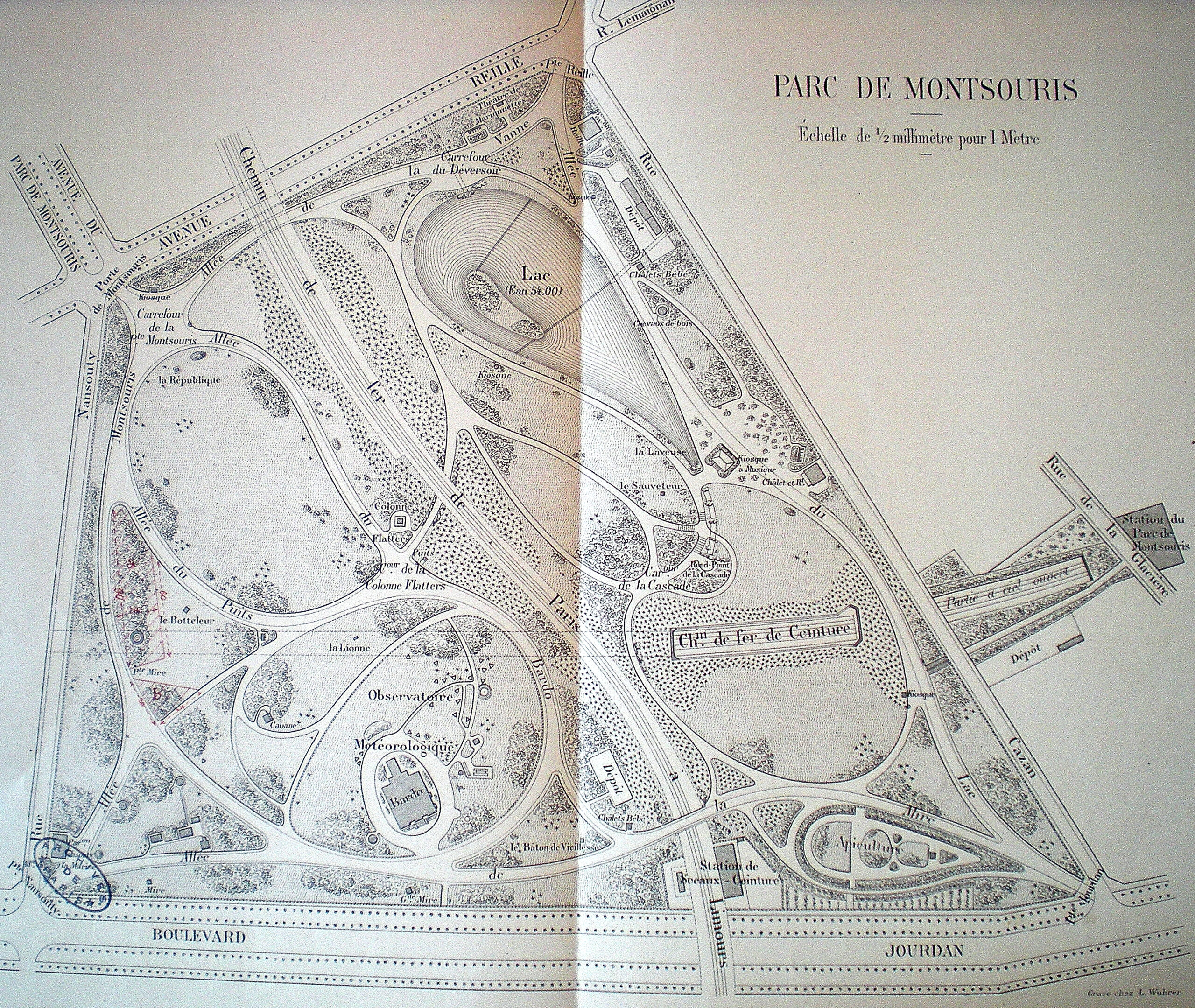
Ille Chamier und Stella Avni
Im Zentrum von Ille Chamiers Gedicht steht die Figur der Schauspielerin Stella Avni – eine heute nahezu vergessene Künstlerin, deren Lebensspuren sich nur rudimentär rekonstruieren lassen. Gesichert…
-

Unbeirrt subjektiv sein
Ein literarischer Essay zu Kurt Martis Subjektivität „Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.“ – Kurt Marti Was…
-

Heil
Annähernd gelesen | Ilse Chamiers Gedicht reflektiert ihre Erfahrungen als Kindergartenkind im nationalsozialistischen Deutschland. Dabei verbindet sie Erinnerungen an Rituale, religiöse Erziehung und Kriegsrealität zu einer erschütternden…
-

Das erste Buch: Eine Anthologie über literarische Debüts
Renatus Deckerts „Das erste Buch. Schriftsteller über ihr literarisches Debüt“, erschienen 2007 im Suhrkamp Verlag, ist eine Anthologie, die sich der Bedeutung des ersten veröffentlichten Werks von…
-

Ein rotes Kreuz, das sein Schicksal besiegelt.
Sasha Filipenko | Rote Kreuze. Ein Roman Sachbücher mag ich eher selten. Lieber ist es mir, Wissen aus fundiert recherchierten Romanen zu sammeln. Da geschieht meist eher…
-

Kurt Marti | Zärtlichkeit und Schmerz
«Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.» Kurt Marti Dieses Buch von Kurt Marti aus dem Jahre 1979…
-

Otto F. Walter – Wie wird Beton zu Gras
Otto F. Walters Roman Wie wird Beton zu Gras? (erstmals 1979 erschienen, hier in der Rororo-Taschenbuchausgabe von 1988 vorliegend) wird zur ökologischen Literaturbewegung der späten 1970er Jahre gezählt. Im…
-

Wenn die Hände denken.
Du musst deinem Leben Hände geben. Das Gedicht „RATLOS„von Jürgen Völkert-Marten schlägt mir entgegen wie eine kalte Wand. Eine Litanei des Erstickens: Strick. Pistole. Schlaftabletten. Eine Aufzählung von Auswegen,…
-

Kurt Schumacher – Fallender
Der Bildhauer Kurt Schumacher (1905-1942) schuf eine männliche Figur im Moment des Falls. (Im Stil des Expressionismus?) aufgerichtet und die Arme emporreißend, zeigt die Skulptur eine tiefe…
-

Widerstand als ethische Grammatik
Ergänzung zu Kurt Schumachers Fallender | Einige zeitgenössische Texte und künstlerische Positionen, die Kurt Schumachers Skulptur und den Widerstandsgedanken neu reflektieren. Hier eine Auswahl mit Schwerpunkt auf…
