Als hätten sich György Kurtág, Johann Sebastian Bach und Oskar Loerke am Hubertussee getroffen.
Der Silberdistelwald
Mein Haus, es steht nun mitten
Im Silberdistelwald.
Pan ist vorbeigeschritten.
Was stritt, hat ausgestritten
In seiner Nachtgestalt.
Die bleichen Disteln starren
Im Schwarz, ein wilder Putz.
Verborgne Wurzeln knarren:
Wenn wir Pans Schlaf verscharren,
Nimmt niemand ihn in Schutz.
Vielleicht, dass eine Blüte
Zu tiefer Kommunion
Ihm nachfiel und verglühte:
Mein Vater du, ich hüte,
Ich hüte dich, mein Sohn.
Der Ort liegt waldinmitten,
Von stillstem Licht gefleckt.
Mein Herz – nichts kam geritten,
Kein Einhorn kam geschritten –
Mein Herz nur schlug erweckt.
Oskar Loerke | 1934
Begleitmusik | Játékok. Marta und György Kurtág spielen J. S. Bach. ECM Records, ℗1997. Darauf zu finden: Distel III, 14 — Dauer: 24 Sekunden. Ob das dieser Pflanze gerecht wird?
Der „Silberdistelwald“ des Oskar Loerke liegt am Hubertussee, geschaffen im Zusammenhang mit dem Bau der Gartenstadt Frohnau aus einem verlandeten Tümpel. Im späten 19. Jahrhundert wurde hier Ton für die nahegelegene Ziegelei gegraben. [Loerkes Vater war übigens Ziegeleibesitzer.]
Oskar Loerke (* 13. März 1884 in Jungen bei Schwetz/ Wiąg in Westpreußen; † 24. Februar 1941 in Berlin) war ein deutscher Dichter des Expressionismus und des Magischen Realismus. Das Gedicht erschien 1934 im gleichnamigen Gedichtband.
Seine ausgeprägte Liebe zur Musik fand u.a. Ausdruck in veröffentlichten Texten zu Johann Sebastian Bach und 1938 zu Anton Bruckner:
1922 Wandlungen eines Gedankens über die Musik und ihren Gegenstand bei Johann Sebastian Bach
1935 Das unsichtbare Reich. Johann Sebastian Bach, S. Fischer
1938 Anton Bruckner. Ein Charakterbild
Begleitmusik 2 | Johann Sebastian Bach „Geschwinde, ihr wirbelnden Winde (BWV 201)“ – eine weltliche Kantate. Im Autograph trägt sie den Titel „Der Streit zwischen Phoebus und Pan“]
Eine Annäherung an Oskar Loerkes „Der Silberdistelwald“
Oskar Loerkes Gedicht „Der Silberdistelwald“ (1934) erzählt von einem Haus im Wald, und von dem, was dort geschieht – oder vielmehr: nicht geschieht. Es ist die Geschichte einer Begegnung, die bereits vorüber ist, bevor das Gedicht beginnt.
Was ist geschehen?
Pan, der antike Hirtengott, ist durch den Wald geschritten, in seiner „Nachtgestalt“. Sein Durchgang hat etwas beendet: „Was stritt, hat ausgestritten.“ Nach diesem Ereignis herrscht eine eigentümliche Stille. Das lyrische Ich befindet sich nun inmitten eines verwandelten Raums – der Silberdistelwald, der das Haus umgibt, erscheint wie eine Bühne nach dem Drama.
Die Disteln starren bleich im Schwarzen, ein „wilder Putz“, als wären sie Zeugen oder Überbleibsel. Unter der Oberfläche knarren verborgene Wurzeln. Und hier taucht das erste Rätsel auf: „Wenn wir Pans Schlaf verscharren, / Nimmt niemand ihn in Schutz.“ Ist Pan gestorben? Ist sein Durchgang sein Ende gewesen? Das Begraben seines Schlafs – nicht seiner Leiche – deutet auf etwas Unabgeschlossenes hin. Niemand würde ihn schützen, heißt es, und das „wir“ bleibt unbestimmt.
Die Blüte und die verkehrten Rollen
Dann folgt eine merkwürdige Wendung: „Vielleicht“ sei eine Blüte Pan nachgefallen und verglüht, „zu tiefer Kommunion“. Dieses „vielleicht“ öffnet den Raum der Spekulation – ist es eine Geste der Hingabe, ein letzter Gruß? Die nächsten Zeilen brechen mit jeder Erwartung: „Mein Vater du, ich hüte, / Ich hüte dich, mein Sohn.“
Wer spricht hier zu wem? Das lyrische Ich scheint beide Positionen gleichzeitig einzunehmen – es ist Kind und Elternteil zugleich, oder es spricht zu Pan, der sowohl Vater als auch Sohn ist. Die Generationengrenzen lösen sich auf, Fürsorge wird nicht weitergegeben, sondern kreist in sich selbst. Diese Zeilen lesen sich wie ein Versprechen oder ein Gebet – aber an wen oder was?
Die Stille danach
Die letzte Strophe kehrt zum Ort zurück: „waldinmitten“, von „stillstem Licht gefleckt“. Das Herz des lyrischen Ichs schlägt erweckt – aber es ist „nichts“ gekommen. Kein Einhorn (das christliche Symbol der Reinheit), keine mythische Rettung, keine äußere Erscheinung. Das Erwachen geschieht allein, ohne Anlass, ohne Ereignis. Das „nur“ wirkt beinahe ernüchtert: Nur das eigene Herz, sonst nichts.
Eine Geschichte ohne Handlung?
Das Gedicht erzählt von einem Zustand nach einem Geschehen. Pan ist vorbeigezogen, etwas hat sich erledigt, aber was bleibt, ist Ambivalenz: Der Wald ist Schutzraum und Ort des Verglühens, das Ich übernimmt Fürsorge für etwas Unsichtbares, das Herz erwacht in völliger Einsamkeit. Es ist keine lineare Erzählung, sondern eher eine mythische Nacherzählung – ein Echo eines Ereignisses, das sich der Darstellung entzieht.
Die Disteln, die starren, die Wurzeln, die knarren, das Licht, das fleckt: Alles deutet auf Spuren hin, auf Reste einer Präsenz. Pan selbst ist abwesend, aber die Landschaft trägt seine Signatur. Das lyrische Ich scheint sich in dieser Zwischenposition eingerichtet zu haben – nicht mehr wartend auf etwas Großes, aber wach für das, was im Verborgenen weiterlebt.
Form und Atmosphäre
Loerke arbeitet mit kurzen, gereimten Versen im Kreuzreim, die durch Enjambements ineinander fließen. Die Sprache ist knapp, fast archaisch („verscharren“, „Kommunion“), und schafft eine feierliche, aber auch unheimliche Grundstimmung. Wörter wie „knarren“ oder „geschritten“ verleihen dem Wald eine haptische, fast körperliche Präsenz.
Entstanden 1934, lässt das Gedicht keine direkten zeitgeschichtlichen Bezüge erkennen. Doch die Betonung von Schutzlosigkeit und die Suche nach einem inneren Erwachen könnten als Resonanz auf Umbrüche gelesen werden – weniger als politische Aussage, eher als existenzielle Grundierung.
Der Silberdistelwald ist beides: Ort der Stille und Ort der Vergänglichkeit. Was hier geschieht, geschieht leise, aber nachhaltig – ein Erwachen ohne Ankunft, eine Fürsorge ohne Objekt, eine Geschichte, die schon zu Ende ist, bevor sie beginnt.
-

aber das kaputte Salzfaß
Eine Annäherung | Dieses Gedicht erzählt eine Geschichte, die von einem rätselhaften Bild lebt: dem kaputten Salzfass. Es ist zerbrochen, hält nichts mehr, und doch wird es immer wieder gefüllt. Salz selbst ist ja seit jeher ein Symbol für das Lebensnotwendige – es würzt unser Essen, konserviert, und die Redewendung vom „Salz der Erde“ spricht…
-

Ille Chamier – Lied 76
Eine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…
-

Frühling | Christoph Kuhn
Das Gedicht von Christoph Kuhn spielt mit ungewöhnlichen Perspektiven auf den Frühling und nutzt dabei Sprachbilder, die Bewegung und Veränderung betonen. Meine Annäherung an den Text: „die bäume ausgebrochen über nacht“– Das Bild des „Ausbruchs“ suggeriert eine plötzliche, fast revolutionäre Veränderung. Der Frühling kommt nicht allmählich, sondern scheint explosionsartig zu geschehen. Es erinnert an das…
-

Øyvind Berg – Schwärze, was ist das?
in LyrikØyvind Bergs Gedicht „Schwärze, was ist das? / Licht in einem ungeöffneten Buch. / Gebärmutterlicht.“ verdichtet in drei Zeilen eine tiefgründige Reflexion über das Verborgene, das Potenzial und den Ursprung von Existenz. Hier meine Annäherung an diesen Text: Schwärze als paradoxer Träger von Licht:Die Frage „Schwärze, was ist das?“ setzt ein, indem sie das scheinbar…
-

Tagtexte – Ille Chamier
LektüreNotizen | Knappe biografische Angaben zur Autorin, ansonsten: kein Klappentext, kein Marketingsprech, kein Inhaltsverzeichnis. Lesende sind mit sich und den Texten allein. Das ist gut. Die Tagtexte sind in Lyrikform ; wobei ich nicht weiß, ob der Einzeiler am Anfang bereits ein Gedicht ist. Jedenfalls ist er der Einstieg in eine (zu erzählende) Geschichte. „das…
-

Adolf Endlers Gedicht „Dies Sirren“
Adolf Endlers Gedicht „Dies Sirren“ aus dem Jahr 1971 wirkt auf den ersten Blick wie ein surrealistisches Rätsel. Doch hinter der grotesken Szenerie dieser nur vier Zeilen verbirgt sich eine vielschichtige Auseinandersetzung mit historischen Traumata und politischer Ohnmacht. Basierend auf biografischen und literaturkritischen Quellen, bietet es Einblicke in ein rätselhaftes Meisterwerk, das zu den Schlüsseltexten…
-

Gegenentwürfe zur Ratlosigkeit: Wiederaufbruch
Meine Entwürfe beziehen sich auf das Gedicht RATLOS von Jürgen Völkert-Marten. Im Dunkel der Nacht, dieses bodenlose Schwarz, wo Fragen wie Schatten wuchsen, ungreifbar, und die Stille selbst nach einer Antwort schrie, einer wirklichen, da begann es, dieses zaghafte Flimmern. Nicht laut, kein Donner, der zerbricht, nicht grell, kein Blitz, der blendet, sondern wie ein…
-

Ille Chamier & Karen Roßki
DAS ZÜNDBLÄTTCHEN – Heft 21 LektüreNotizen | Das Heft beinhaltet acht Gedichte der in Düsseldorf lebenden Autorin Ille Chamier und vier Bleistiftzeichnungen der Dresdner Künstlerin Karen Roßki. Stammabschnitte von Bäumen, die, obwohl blattlos, für mich die Energie der vier Jahreszeiten vermitteln. Details von Ästen, , markante Jungbäume, Totholz(?). Die Zeichnungen erinnern teils an Fabelwesen, so…
-

Das tierische Gebet
in LyrikIch preise Dich Herr, / Darum hüpfe ich | Drutmar Cremer Tiere beten in Dur heiter beschwingt schlitzohrig – so lautet der Untertitel dieses Buches. Und ja, ungewöhnliche Gebete sind das, die der Benedektiner Drutmar Cremer da verfasst hat. Charakteristisch für das lyrische Werk des Dichters, Verlegers & Theologen Drutmar Cremer ist sein sparsames Vokabular,…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
Ich zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
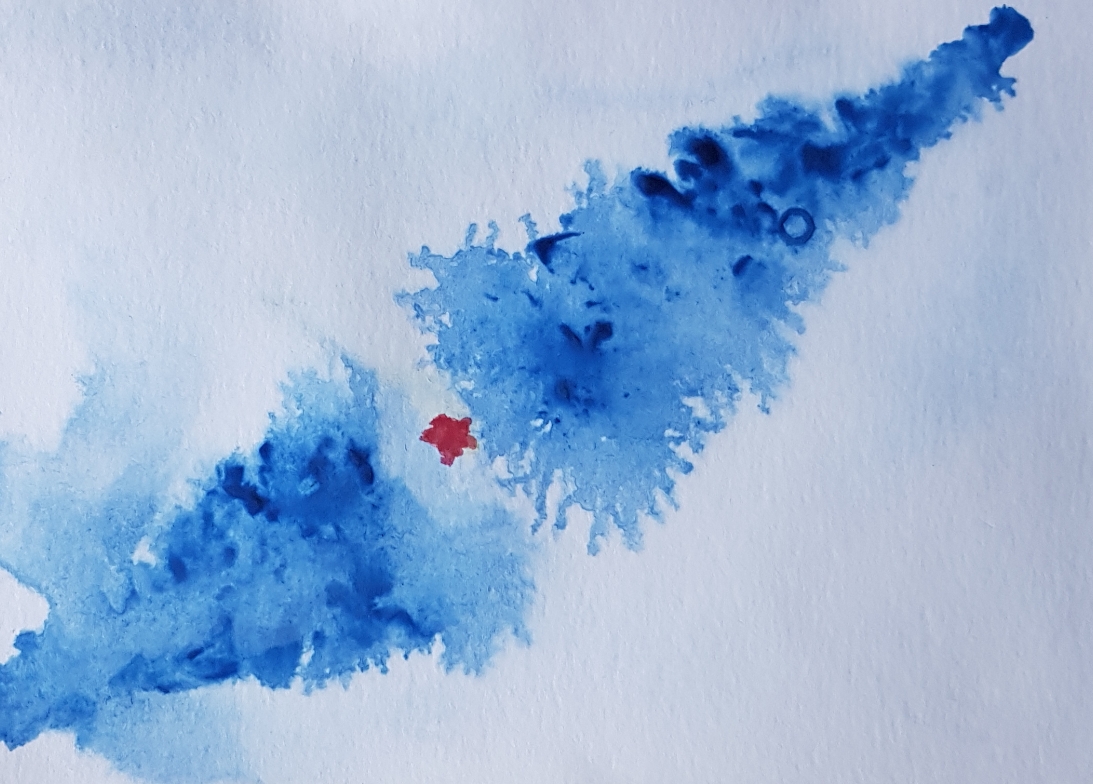
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Kurt Schumacher – Fallender
Der Bildhauer Kurt Schumacher (1905-1942) schuf eine männliche Figur im Moment des Falls. (Im Stil des Expressionismus?) aufgerichtet und die Arme emporreißend, zeigt die Skulptur eine tiefe Wunde in Herzhöhe. Aus ihr strömt Blut, das sich wie ein stilisiertes Gewand um die Hüften legt, die Scham des nackten Körpers bedeckt und an den Beinen hinunterfließt.…

Schreibe einen Kommentar