Dieses Gedicht ist ein einziger Atemzug. Zwar gliedern Kommata den Text und ein Punkt beschließt ihn, doch syntaktisch bleibt es ein langer, fließender Satz. Die Interpunktion ordnet, ohne zu zerhacken – die Kommata schaffen Pausen wie beim Sprechen, wenn man Luft holt, ohne den Gedankenfluss zu unterbrechen. Die wiederholten Konjunktionen „und“ schaffen Rhythmus und Vorwärtsdrang zugleich, als würde die Erinnerung selbst sprechen, ungefiltert, wie sie kommt.
„Mitte der Sechziger zwischen elf und zwölf Uhr nachts“ – so präzise, als könnte man die Zeit noch riechen, die Spannung in der Luft. Die Art, wie die Erinnerungsfetzen aneinandergereiht werden – „wie“, „und bei“, „und wissen“ – lässt alles ineinanderfließen, sprungweise, aber ohne Unterbrechung.
BFBS, der britische Soldatensender. Für deutsche Jugendliche ein Fenster in eine andere Welt, aber auch ein Risiko. Die Angst vor den „Alten im Schlafzimmer nebenan“ macht aus dem Musikhören einen Akt der Rebellion, heimlich und kostbar zugleich. Das Radio wird zum Komplizen, die Lautstärke zur Waffe gegen die Ordnung der Erwachsenen.
Dann dieser Moment: „Ferry cross the Mersey“ und das „sanfte, wunderschöne Kopfhautkribbeln“. Hier wird Musik körperlich, wird zu etwas, das die Haut berührt, nicht nur die Ohren. Gerry and the Pacemakers – eine Band aus Liverpool, wie die Beatles, aber sanfter, melancholischer. Das Lied erzählt vom Übersetzen über den Mersey-Fluss, von Heimkehr und Sehnsucht. Für den Jugendlichen im Gedicht wird es zur körperlichen Erfahrung, zu etwas, das ihn verändert.
„Auf die alten Songs abfahren, wie man jetzt sagt“ – hier bricht die Zeitebene auf. Der Erzähler ist nicht mehr der Jugendliche von damals, sondern ein Erwachsener, der zurückblickt. Das „wie man jetzt sagt“ markiert die Distanz, aber auch die Kontinuität des Gefühls. Die Sprache wandelt sich, die Erfahrung bleibt.
Am Ende die Gewissheit: ein Mädchen wartet, nichts scheint kompliziert. Diese Schlichtheit ist das Gegenteil von Naivität – sie ist das Ergebnis einer Klarheit, die nur die Jugend kennt. Bevor die Welt ihre Komplikationen zeigt, bevor Liebe schwierig wird, bevor Musik zur Nostalgie erstarrt.
Der Effekt des einen Atemzugs verstärkt das Gefühl der Unmittelbarkeit: Als würde der Sprecher diese Nacht noch einmal durchleben, in einem Zug, ohne die analytischen Pausen, die Reflexion mit sich bringen würde. Die Erinnerung rollt ab, wie sie damals erlebt wurde – als zusammenhängende Erfahrung einer einzigen Nacht.
Das Gedicht trägt seinen Titel zu Recht. Nostalgie ist nicht nur süße Erinnerung, sondern – wie eine Definition sagt – eine „vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste Sehnsucht“. Was damals selbstverständlich war – die Musik, das Mädchen, die Einfachheit –, erscheint aus heutiger Sicht wie ein verlorenes Paradies.
Die Literatur der Zeit kannte solche Momente. Rolf Dieter Brinkmann machte aus Alltagserfahrungen und Popkultur Poesie, allerdings lauter, fragmentierter. Die jungen DDR-Lyriker von „Sonnenpferde und Astronauten“ fingen ähnliche Zeitgefühle ein, aber politischer, kollektiver. Karl-Heinz Bittel erinnerte sich prosäisch an die Beatzeit, Anneliese Albrecht an die Magie des Radios.
Alle diese Texte verbindet die Erkenntnis: Musik war damals mehr als Unterhaltung. Sie war Identitätsstiftung, Abgrenzung, ein Versprechen von Freiheit. Das Radio brachte die große Welt ins Kinderzimmer, machte aus dem heimlichen Zuhörer einen Weltbürger der Popkultur.
Heute klingt das nostalgisch – nicht weil es vergangen ist, sondern weil die Gegenwart diese Unmittelbarkeit vermissen lässt. Streaming und Algorithmen haben die Zufälle des Radios ersetzt, die großen Gesten der Popmusik sind kleinteiliger geworden. Was bleibt, ist die Erinnerung an Momente, in denen ein Lied zum Ereignis wurde, in denen Musik die Haut berührte und nichts kompliziert schien.
Das Gedicht erzählt davon ohne Sentimentalität, ohne Verklärung. Es ist einfach da, wie die Erinnerung selbst – präzise, körperlich, unwiderruflich.
Weitergelesen
Diese Art von Rückblick, der Musik, Alltag und Erinnerung verschränkt, begegnet uns auch an anderen Orten der Literatur. Eine Zusammenfassung der im Text erwähnten Literatur:
- Rolf Dieter Brinkmann, „Vanille“ (1969): Alltagsprosa, Songzitate, Sprachsplitter. Auch hier wird der Moment zur Bühne. Brinkmann ist lauter, fragmentarischer, greller – aber die Nähe zur Popkultur verbindet ihn mit dem Nostalgie-Gedicht.
- „Sonnenpferde und Astronauten“ (1964): Eine Anthologie junger DDR-Lyriker, die Alltagsbilder und jugendliche Erfahrungen literarisch verdichten. Politischer, kollektiver, während das Gedicht von persönlicher Intimität lebt.
- Karl-Heinz Bittel: Singen – ein Anfang: Prosaerinnerung an die Beatmusik und das Aufbegehren der Jugend in den 60ern. Dokumentarisch, detailreich, weniger poetisch – aber in der Erfahrung des Radios als Tor zur Welt dem Gedicht sehr nah.
- Anneliese Albrecht: Wo steckt der Mann im Radio?: Kindliche Erinnerung an Radiosendungen, in denen eine neue Welt aufscheint. Nüchterner, sachlicher, ohne körperliche Sinnlichkeit, doch ebenso geprägt vom Zauber des Hörens.
Allen gemeinsam ist die Ahnung, dass Musik mehr war als Klang: Sie war ein Versprechen. Ein Stück Identität, Abgrenzung, Freiheit.
Quellen
- Brinkmann, Rolf Dieter: Vanille (1969).
- Anthologie: Sonnenpferde und Astronauten (1964).
- Bittel, Karl-Heinz: Singen – ein Anfang. Deutschlandfunk, als der Beat die Jugend begeisterte.
- Albrecht, Anneliese: Wo steckt der Mann im Radio?. Zeitgut Verlag, Radiogeburtstag – Erinnerungen.
- Überblick zur Popliteratur der 1960er: Uni Siegen, Popliteratur der Sechzigerjahre.
- Überblick zur Lyrik der 1960er: Lernhelfer.
NOSTALGIE veröffentlicht in:
Jürgen Völkert-Marten – UNSER FORTGESETZTER WUNSCH NACH OPTIMUSMUS
Tentamen-Drucke Bad Cannstatt – Kleine Handbibliothek – Heft 3
ISBN 3-921625-09-2
1977
Im Dialog mit der NOSTALGIE
-

Jürgen Völkert-Marten – Wege – Anders gelesen
Das Gedicht zeigt eine Spannung zwischen der Erfahrung von Wegen in der Natur und ihrer abstrakten Darstellung durch den Menschen. Während die Wege „inmitten metallisch glänzender Wasser“ scheinbar „nicht enden wollen“, sondern sich „biegen und den Ausgang finden“, werden sie in der kartografischen Abbildung „zusammengezogen“ und „verschwinden im Nichts“. Damit wird deutlich, dass Wege in…
-
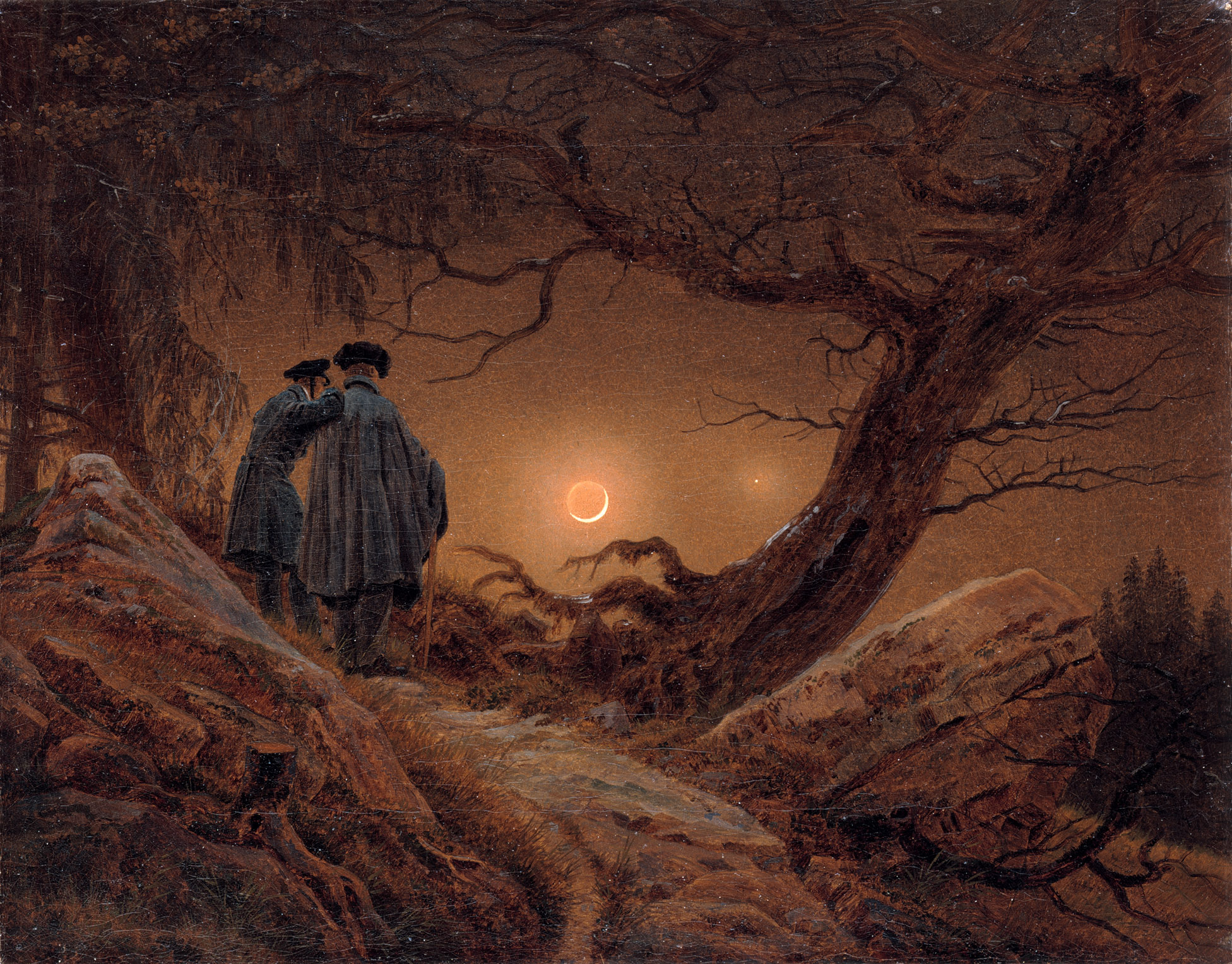
PROMETHEUS – Jürgen Völkert-Marten
Das Gedicht „Prometheus“ arbeitet mit einer besonderen Erzählsituation: Ein Sprecher wendet sich direkt an den mythischen Titanen selbst. Durch die durchgehende Du-Ansprache entsteht der Eindruck einer unmittelbaren Konfrontation mit der prometheus’schen Figur, die hier nicht nur als literarische Metapher fungiert, sondern als konkreter Gesprächspartner angesprochen wird. Die Umdeutung des Mythos Der Text nimmt eine interessante…
-

Jürgen Völkert-Marten – Wege – Lyrik
„Wege“ führt uns durch einen merkwürdigen Wechsel der Perspektiven: Erst sind wir mittendrin im Matsch und Regen, dann schauen wir von oben auf eine Landkarte. Diese Bewegung von der körperlichen Erfahrung zur abstrakten Betrachtung durchzieht das ganze Gedicht wie ein roter Faden. Unterwegs im Regen Die erste Strophe lässt uns förmlich die nassen Füße spüren.…

Schreibe einen Kommentar