Annähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung.
Gelesen habe ich das Gedicht in der WORTSCHAU 43 | Es hört nie auf
Der Jüdische Friedhof Weißensee wurde 1880 eingeweiht. Er umfasst rund 42 Hektar, ist in 120 Felder gegliedert und zählt über 115 000 Grabstellen. Das Eingangsensemble (Trauerhalle, Arkaden, gelbe Ziegel) entwarf Hugo Licht. Nach jüdischer Tradition werden Gräber nicht neu belegt („ewiges Ruherecht“). Der Ort steht seit den 1970er-Jahren unter Denkmalschutz.
Die Anlage überstand den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet. Der friedhofstypische Bewuchs (u. a. Efeu) ist hier bewusst Teil des Gartendenkmals und wird nicht einfach „bereinigt“ – die Vegetation gehört zur historischen Erscheinung.
Zur jüngsten Gegenwart: Am 13. Mai 2025 wurde die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer in Weißensee beigesetzt; zahlreiche Medien berichteten, die Beisetzung war ein öffentliches Erinnerungsereignis. (Ergänzend: Die Mauer an der Indira-Gandhi-Straße wurde 1983/84 zur Auflockerung mit Menora-Motiven gestaltet – eine seltene Sichtbarkeit jüdischer Symbolik im Stadtraum der DDR.)
„Ich hisse meine blaue Signalflagge.“ Im Text steht „Blau“ explizit für Nervosität/Schutzlosigkeit. In der jüdischen Symbolik verweist Blau (תכלת/tekhelet) auf das Gebot des blauen Fadens an den Zizit (Num 15,38) und – nach Menachot 43b – auf eine Kette Meer → Himmel → göttlicher Thron. In moderner Farblehre/-psychologie wird Blau häufig mit Ruhe, Distanz, Kühle, Vertrauen konnotiert. Diese Spannbreite (sakral entrückt vs. psychophysisch kühl) macht die „Signalflagge“ doppeldeutig: religiöse Fern-Assoziation vs. leibliche Alarmierung. Sefaria+1Rowohlt Verlag
„Ich vergleiche die Zeit mit der Wahrheit.“ Präzise Leseart: Der Vers setzt zwei harte Maße aneinander. „Zeit“ = nachprüfbare Dauer/Verfall; „Wahrheit“ = das Unausweichliche, was bleibt, wenn alles Beschönigen wegfällt. Auf einem Friedhof decken sich beide Größen: Die Zeit macht die Wahrheit der Vergänglichkeit sichtbar. Am Ort Weißensee ist das buchstäblich lesbar (ununterbrochene Belegung seit 1880; kein Umbruch durch Wiederbelegung).
„Zwischen den Gräbern liegt die Melancholie von Jahrhunderten.“ Kein Pathos nötig: Historische Schichtung plus bewusst belassene Vegetation erzeugen den Eindruck eines „wachsenden“ Gedächtnisses. Der Ort dokumentiert bürgerliche Repräsentationskunst um 1900 ebenso wie spätere Zäsuren – ohne fortwährende Planierung.
„Und ein kleines Kind.“ Drei praktikable Lesarten:
Konkretes Gegenbild: reale Besucherszene (Friedhöfe sind öffentlich zugänglich).
Biographische Rückblende: das verletzliche „Innen-Ich“.
Erinnerung an geraubte Kindheit: Stellvertreter für jene, die jung starben.
Alle drei sind im Text gestützt; der Vers bleibt absichtlich offen.
„Ein Fliegenschwarm … halb verweste Maus.“ Memento-mori-Detail ohne Metaphorikschutz. Es verankert die Rede von „Zeit/Wahrheit“ in Geruch, Bewegung, Verfall – eine Antithese zu geschliffener Grabarchitektur.
„Siebenarmige bemooste Wege führen ins Licht.“ Topografisch gibt es keine fest dokumentierte „siebenarmige“ Wegefigur. Die Sieben-Armigkeit ist daher als Menora-Allusion zu lesen, die sich mit dem realen Menora-Motiv an der Friedhofsmauer kurzschließt. Dass die Wege „ins Licht“ führen, neutralisiert jede düstere Engführung: Orientierung, nicht Ausweglosigkeit. Berlin
„Leise atmende Steine halten den Himmel auf.“ Hier ist keine Esoterik nötig: Grabsteine „atmen“ wörtlich nicht, aber sie arbeiten – nehmen Feuchte auf, geben sie ab, werden von Moosen und Flechten besiedelt, verändern Farbe und Textur. „Leise“ verweist auf diese sehr langsame, aber sichtbare Materialzeit. „Himmel halten“: vertikale Ordnung, die den Blick rahmt und den Raum „spannt“.
„Ich schwebe … davon.“ Kein Fluchtgestus, eher Entkopplung: Die Wahrnehmung löst sich vom Körpergewicht (nach der sensorischen Überlastung der vorigen Bilder). „Davonschweben“ passiert am Ort – nicht „weg vom Ort“. Der Schluss belässt die Spannung: Präsenz im Erinnerungsraum, Distanz zur eigenen Erregung.
Was es zu tun gilt: In meinem näherem Umfeld gibt es mindestens 5 jüdische Friedhöfe. Ich suche diese auf und schaue, wie es mir dort ergeht. Mit Dokumentation.
Quellen:
Landesdenkmalamt Berlin: Gartendenkmal Jüdischer Friedhof Weißensee (Daten zur Anlage, Pflegeprinzip, Denkmalschutz).
Bezirksamt / Tourismus Pankow: Flächengröße, Grabstellen, Felder, Einweihung 1880.
Berlin.de: Wettbewerb/Entwurf durch Hugo Licht, historische Einordnung.
Menora-Mauer (1983/84) – Museum Pankow / Bezirksportal. Berlin
Beisetzung Margot Friedländer (Mai 2025), Berichte.
Tekhelet in Tora und Talmud: Num 15,38; Menachot 43b. Sefaria
Farbpsychologie (Blau): Eva Heller, Wie Farben wirken (Verlagsseite). Rowohlt Verlag
-

Olga Benario Prestes: Literarisches Porträt und Nachleben
4–6 minutesTätigkeit als Autorin | Olga Benario verfasste 1929 in Moskau die Schrift „Berlinskaja komsomolija“ (Der Berliner kommunistische Jugendverband), die auf Russisch erschien. 2023 erschien dieser Text erstmals auf Deutsch unter dem Titel „Berliner Kommunistische Jugend“ in deutscher Übersetzung von Kristine Listau beim Verbrecher Verlag. Das Werk beschreibt den Alltag der Kommunistischen Jugend in Berlin-Neukölln mit…
-

Dialog über Hermetik und Zugänglichkeit in der Lyrik
5–7 minutesEin Nachtrag zur WORTSCHAU Nr. 43 | Mein kritischer Beitrag zur WORTSCHAU Nr. 43 hat auf Facebook eine bemerkenswert konstruktive Diskussion ausgelöst. Dass sich Herausgeber, Autorinnen und Autoren die Zeit genommen haben, auf meine Fragen einzugehen, freut mich sehr – und zeigt, dass die Spannung zwischen Hermetik und Zugänglichkeit keine einseitige Irritation ist, sondern ein…
-

Jane Wels‘ Sandrine
3–4 minutesErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…
-
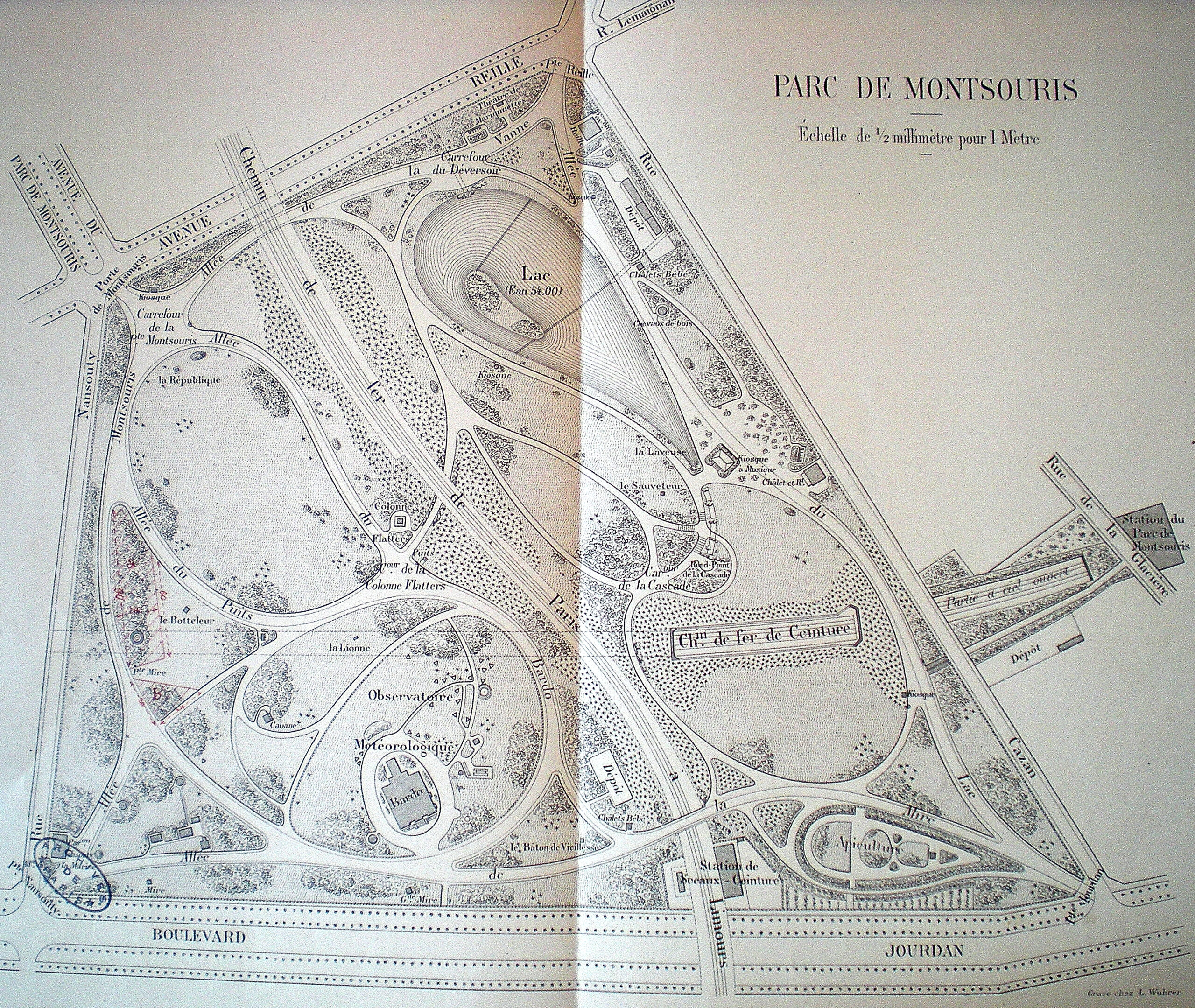
Ille Chamier und Stella Avni
2–3 minutesIm Zentrum von Ille Chamiers Gedicht steht die Figur der Schauspielerin Stella Avni – eine heute nahezu vergessene Künstlerin, deren Lebensspuren sich nur rudimentär rekonstruieren lassen. Gesichert ist: Sie wurde 1921 im damals rumänischen Czernowitz (Bukowina) geboren, jener multikulturellen Stadt, aus der auch Paul Celan und Rose Ausländer hervorgingen. Stella Avni war jüdischer Herkunft und…
-

Unbeirrt subjektiv sein
4–6 minutesEin literarischer Essay zu Kurt Martis Subjektivität „Jeder Terror rechtfertigt sich mit objektiver Notwendigkeit. Um so mehr gilt es, unbeirrt subjektiv zu sein.“ – Kurt Marti Was soll das heißen – „unbeirrt subjektiv sein“? Ist Subjektivität nicht genau das, was wir in rationalen Diskursen zu überwinden suchen? Je länger ich über Martis Worte nachdenke, desto…
-

WORTSCHAU Nr. 43
2–3 minutesGedanken zur „WORTSCHAU“ #43 (Es hört nie auf) – oder: Warum ich beim Lesen ins Stolpern kam Beim Lesen dieser Ausgabe drängte sich mir eine Frage auf: Für wen sind diese Texte eigentlich gedacht? Nicht, weil die Sprache unzugänglich wäre – im Gegenteil, Satzbau und Wortwahl sind oft klar –, sondern weil viele Gedichte in…
-

BECKENENDLAGE – Kathrin Niemela
3–4 minutesWenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken. Drekkingarhylur:…
-

WORTSCHAU 43 – Es hört nie auf
1–2 minutesDiese Ausgabe des Literaturmagazins WORTSCHAU präsentiert sich als besonders lyrik-fokussierte Publikation mit Thomas Kunst als Hauptautor. Feridun Zaimoglu charakterisierte Kunst in seiner Kleist-Preis-Begründung als den „sprachbesessensten und herzverrücktesten deutschen Dichter unserer Zeit“ – eine durchaus plakative Zuschreibung, die der Leser selbst überprüfen kann. Kleine Einblicke in Thomas Kunsts Gedankenwelt | Der beigefügte Fragebogen gibt Einblicke…
-

Marina Büttner – Jüdischer Friedhof Weißensee
3–4 minutesAnnähernd gelesen | Gedichtlektüre und Kontext. Das 1-strophige Gedicht von Marina Büttner verdichtet eine Momentaufnahme auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zu einer Folge von starken, teils naturrohen Bildern, in denen persönliche Erschütterung und historische Schwere ineinanderfließen. Zwischen verwitterten Steinen, Symbolen und Zeichen des Verfalls verhandelt es die Beziehung von Zeit, Wahrheit und Erinnerung. Gelesen habe…
-

Jörn Peter Budesheim
1–2 minutesIn der WORTSCHAU 43 bin ich auf Arbeiten von Jörn Peter Budesheim gestoßen. Besonders auffällig ist dabei, wie er in seinen Zeichnungen mit verschiedenen Ebenen arbeitet. Sie erschließen sich nicht sofort, sondern fordern dazu auf, gelesen zu werden – Schicht für Schicht. Und das passt gut zu diesen Gedichten. 1960 in Marburg geboren, arbeitete Budesheim…

Schreibe einen Kommentar