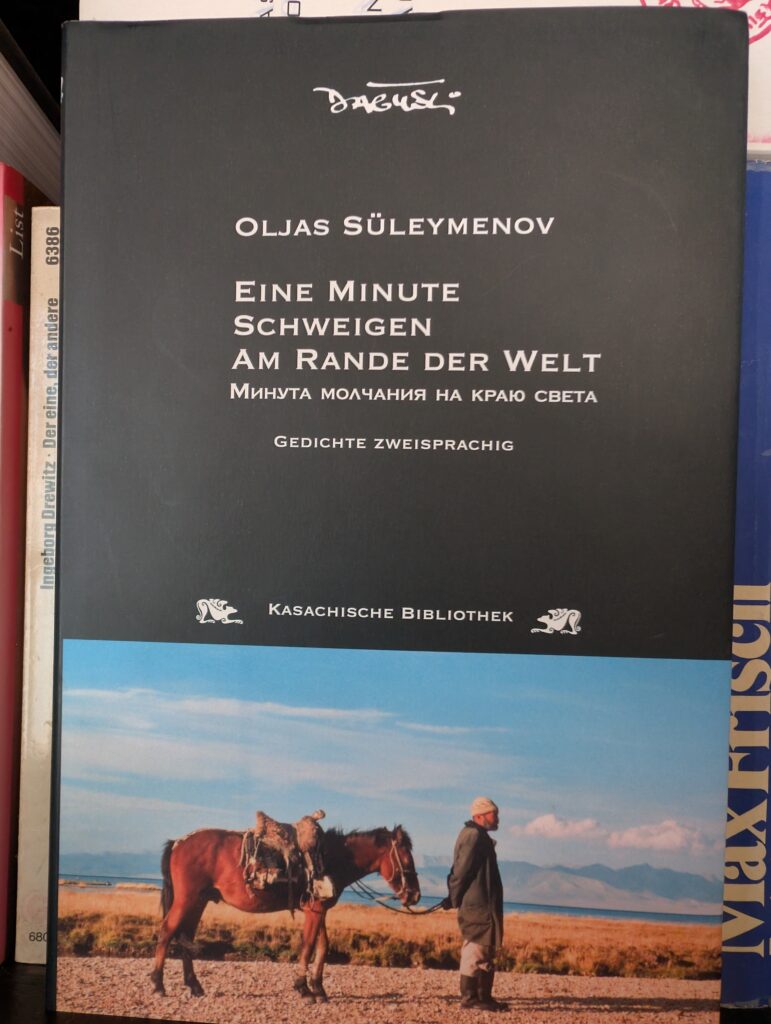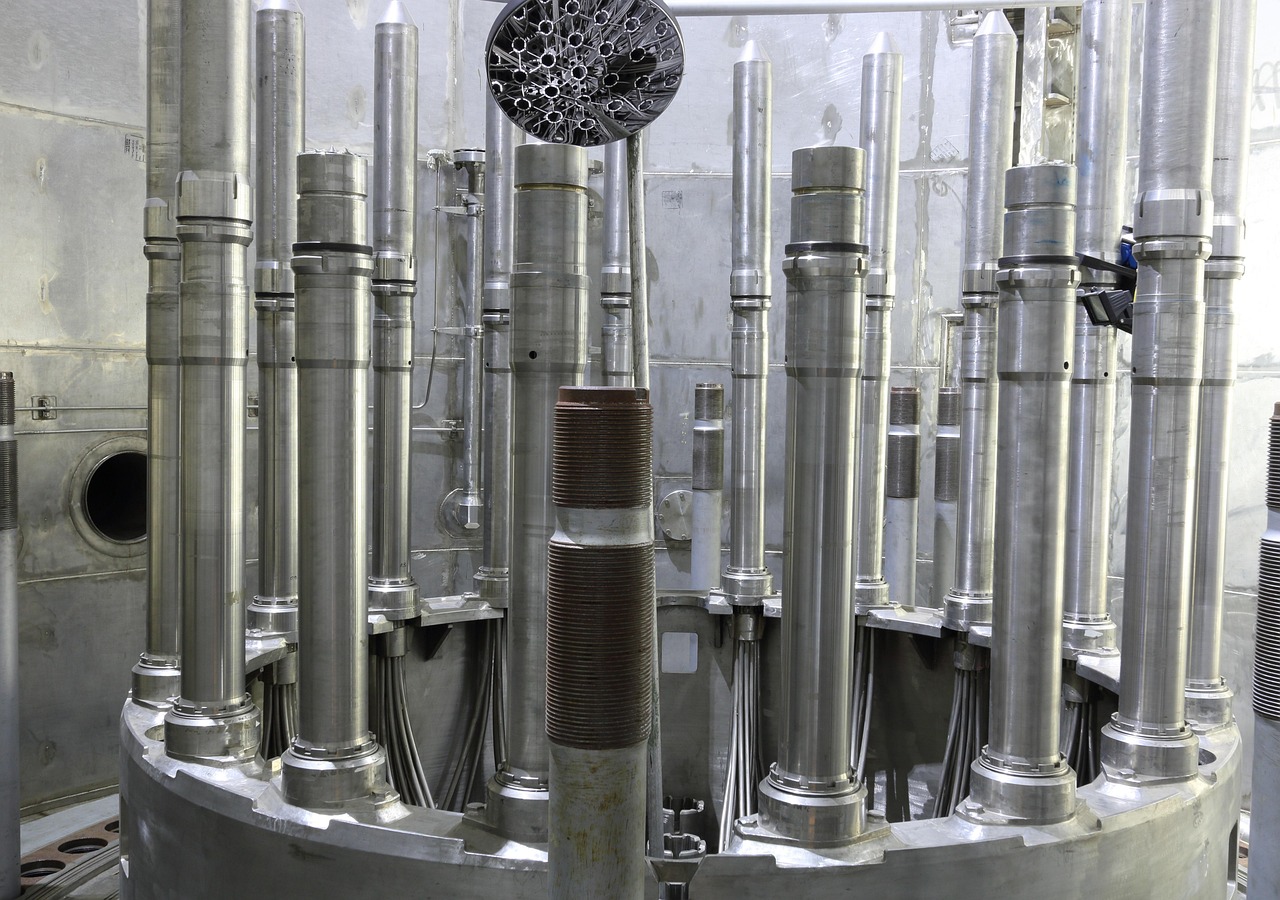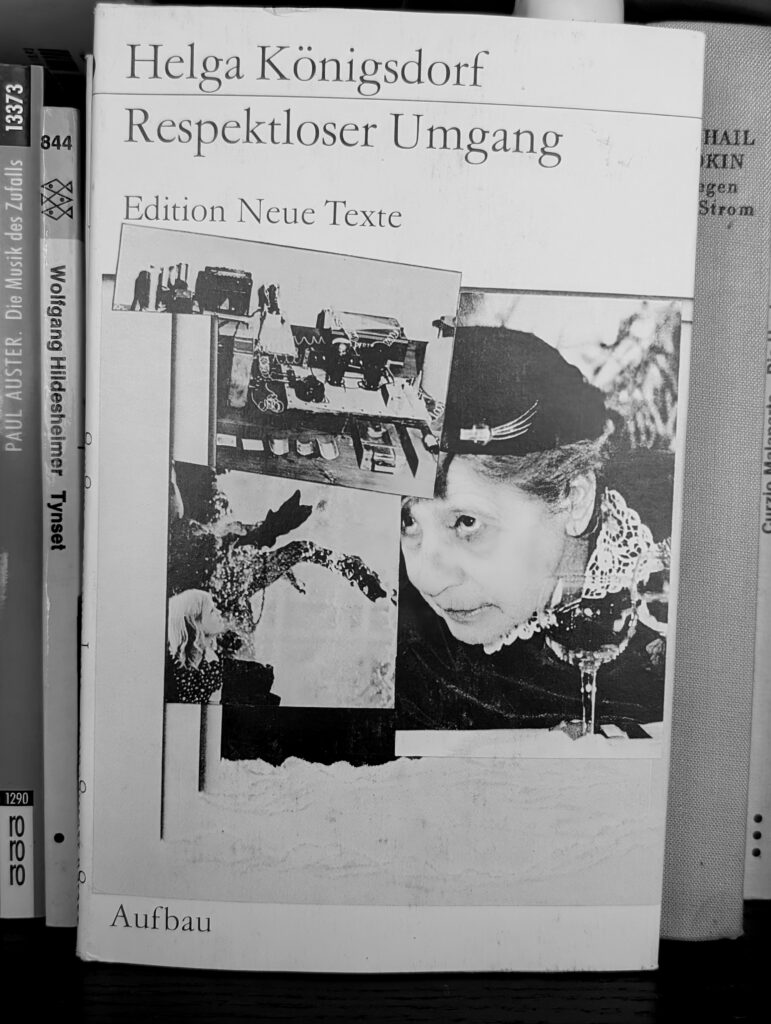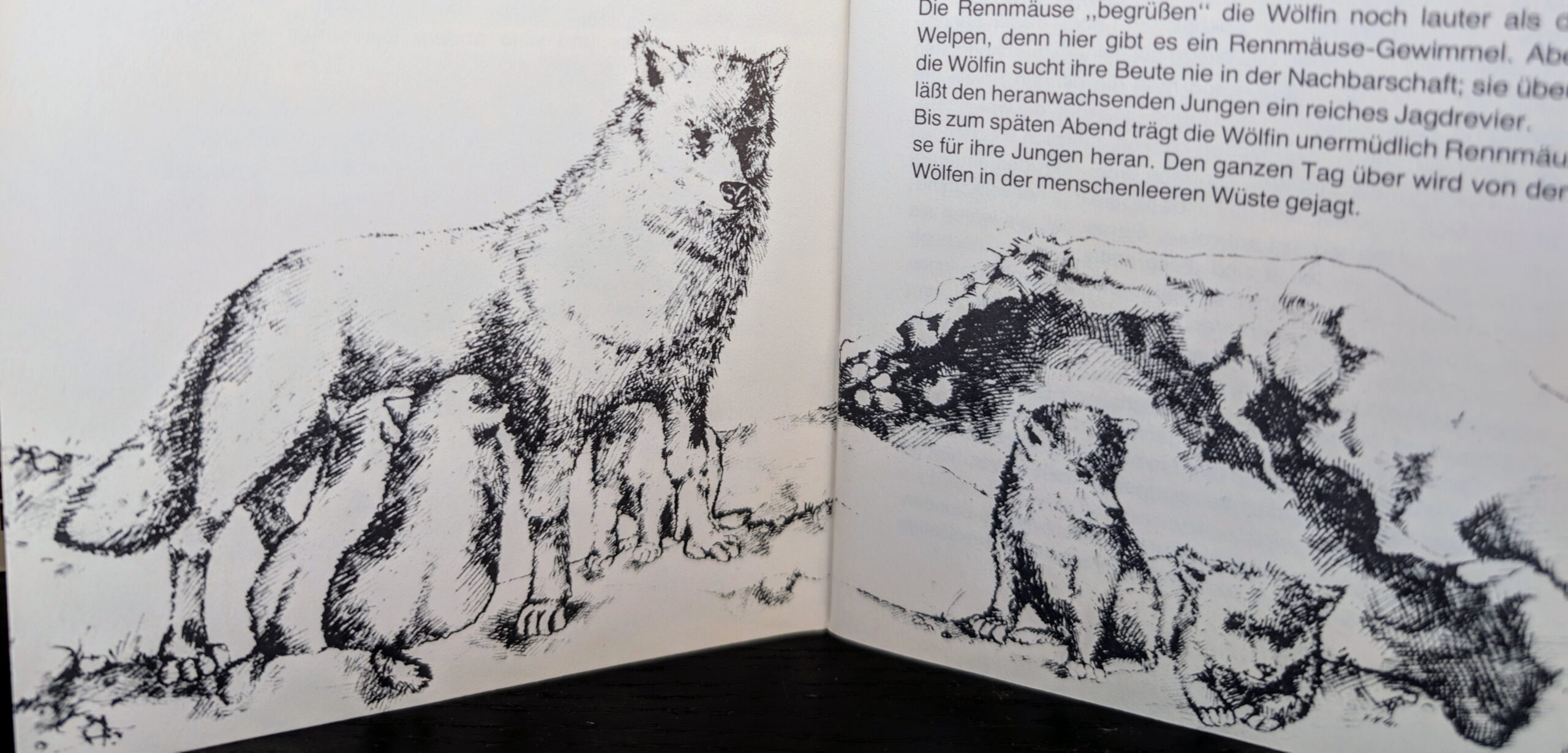Wie ein kunstvoll komponiertes Musikstück, in dem jede Note und jeder Klang seinen Platz hat, so war das Leben von Polykarp Uehlein – ein Leben, das sich in vielen Facetten offenbarte und bis zuletzt von der Liebe zu Kunst, Musik und dem Glauben getragen wurde.
Frühe Jahre und Weg ins Kloster
Geboren am 15. Februar 1931 in Amorbach, im Schatten der alten Abtei, wuchs der damals noch Otto in einem lebendigen Umfeld auf. Seine Eltern – Heinrich, ein Kaufmann, der eine Kaffeerösterei und einen Kolonialwarenladen führte, und Auguste, eine engagierte Studienrätin – vermittelten ihm früh eine Wertschätzung für Kultur und Bildung. Bereits in der Volksschule und später in der Oberschule, die er in Miltenberg mit dem Abitur 1949 abschloss, entwickelte Otto den Blick für das Schöne und Geistige, der ihn ein Leben lang begleitete.
Schon kurz nach dem Schulabschluss richtete sich sein Lebensweg klar auf das Geistliche: Nach zwei Semestern Theologiestudium in Würzburg trat er am 1. September 1950 in die Benediktinerabtei Münsterschwarzach ein. Wenige Tage später, am 11. September 1950, erhielt er den Klosternamen Polykarp – ein Name, der fortan sein künstlerisches und geistliches Schaffen prägen sollte. Die Ordensgelübde folgten in zeitlicher und feierlicher Form, und am 1. Juli 1956 wurde er schließlich zum Priester geweiht.
Zwischen Unterricht, Kunst und Musik
Ursprünglich war für ihn eine Laufbahn als Englischlehrer am hauseigenen Egbert-Gymnasium vorgesehen. Von 1957 bis 1959 verbrachte er eine Studienphase in England, um sich für den Lehrberuf zu qualifizieren. Doch während dieser Zeit entdeckte er, dass seine wahre Leidenschaft in der Malerei und der Musik lag. Zwischen 1959 und 1963 vertiefte er seine künstlerische Ausbildung am Städel in Frankfurt am Main, wo Einflüsse von Größen wie Prof. Burkhard und Georg Meistermann seinen kreativen Ausdruck nachhaltig formten.
Künstlerische Mission in Afrika und darüber hinaus
Das Schicksal führte Polykarp 1963 in das Missionsgebiet der Abtei Ndanda in Tansania. Dort begann er, Religionsbücher zu illustrieren und entwickelte sich zu einem wahren „Malermönch“. Über die Jahrzehnte schuf er mehr als 50 Wandmalereien, die in Kirchen, Klöstern und Krankenhäusern in Tansania, Kenia und Togo biblische Botschaften in leuchtenden Farben verkünden. Auch in Deutschland, der Schweiz und den USA prägen seine Glasfenster – wie die im Jahr 1975 für die Pfarrkirche St. Martin in Kleinrinderfeld – sakrale Räume mit Licht und Farbe. Zudem schuf er auf Leinwand und Papier zahlreiche Werke – von ernsten, abstrakten Bildern bis hin zu satirischen Zeichnungen –, die in unzähligen Ausstellungen von 1964 bis 2021 zu bewundern waren. In Afrika hinterließ er zudem einen nachhaltigen Eindruck, indem er Schülerinnen und Schüler in der Malerei ausbildete und so seine künstlerische Vision weitertrug.
Ein Leben voller Klang und Wort
Nicht nur in der Bildkunst fand Polykarp seine Ausdrucksform, sondern auch in der Musik. Sein Atelier und sein Alltag waren erfüllt von den Klängen von Gustav Mahler, Mozart oder Operngesang – Klänge, die ebenso zu ihm sprachen wie seine Malerei. Als Mensch war er bekannt als „Pater, der ein Bruder ist“, denn seine herzliche Nähe und Offenheit machten ihn zu einem geschätzten Begleiter im klösterlichen Leben. In den 70er Jahren, als der Übergang zu muttersprachlichem Chorgebet anstand, spielte er in Ndanda und Münsterschwarzach eine bedeutende Rolle und verfasste sogar mehrere Hymnen, die noch heute Teil des Chorgesanges sind. In Gesprächen glänzte er zudem mit seinem reichen Wissen über Philosophie, Romane, Biografien und Lyrik – ein Geist, der sich in all seinen Werken widerspiegelte.
Das Lebensmotto und das Vermächtnis
Für den Bildband über Münsterschwarzach und die Missionsarbeit (1980) verfasste er einen einprägsamen Text, der unter dem Titel „Damit in allem Gott verherrlicht werde“ firmiert – ein Leitsatz, der ebenso sein Lebenswerk und seine künstlerische Mission zusammenfasst. Obwohl er hin und wieder an seiner eigenen Berufung als Mönch zweifelte, blieb ihm stets das offene Herz, das der heilige Benedikt als Ideal vorzeichnete.
Die letzten Jahre
2019 zwang ihn ein gesundheitlicher Rückschlag dazu, von Ndanda zurück nach Münsterschwarzach zu kehren. Fortan lebte er in der Infirmerie der Abtei, bis er am 23. März 2022 seinen letzten Atemzug tat. Sein Wirken als Geistlicher, Maler, Glaskünstler, Musiker und Mentor hinterlässt ein bleibendes Erbe – ein Zeugnis einer unermüdlichen Suche nach dem Göttlichen, das in jeder seiner Facetten weiterklingt.
Polykarp Uehlein hat in einem Leben, das wie ein vielstimmiges Konzert alle Töne des Glaubens, der Kunst und der Menschlichkeit miteinander verband, Spuren hinterlassen, die weit über seine Zeit hinaus wirken. Sein Schaffen ist nicht nur eine Sammlung beeindruckender Kunstwerke, sondern auch ein lebendiges Zeugnis eines Menschen, der in allen Lebensbereichen mit Leidenschaft und Hingabe wirkte.