Blog
-

Im Silberdistelwald
Als hätten sich György Kurtág, Johann Sebastian Bach und Oskar Loerke am Hubertussee getroffen.
Der Silberdistelwald
Mein Haus, es steht nun mitten
Im Silberdistelwald.
Pan ist vorbeigeschritten.
Was stritt, hat ausgestritten
In seiner Nachtgestalt.Die bleichen Disteln starren
Im Schwarz, ein wilder Putz.
Verborgne Wurzeln knarren:
Wenn wir Pans Schlaf verscharren,
Nimmt niemand ihn in Schutz.Vielleicht, dass eine Blüte
Zu tiefer Kommunion
Ihm nachfiel und verglühte:
Mein Vater du, ich hüte,
Ich hüte dich, mein Sohn.Der Ort liegt waldinmitten,
Von stillstem Licht gefleckt.
Mein Herz – nichts kam geritten,
Kein Einhorn kam geschritten –
Mein Herz nur schlug erweckt.
Oskar Loerke | 1934
Begleitmusik | Játékok. Marta und György Kurtág spielen J. S. Bach. ECM Records, ℗1997. Darauf zu finden: Distel III, 14 — Dauer: 24 Sekunden. Ob das dieser Pflanze gerecht wird?
Diese Aufnahme gehört nicht zur erwähnten ECM-CD. Bogáncs ist übrigens das ungarische Wort für Distel. Játékok – Bogáncs · György Kurtág | Kamarazene (Kammermusik) | ℗ 1976 HUNGAROTON RECORDS LTD. Der „Silberdistelwald“ des Oskar Loerke liegt am Hubertussee, geschaffen im Zusammenhang mit dem Bau der Gartenstadt Frohnau aus einem verlandeten Tümpel. Im späten 19. Jahrhundert wurde hier Ton für die nahegelegene Ziegelei gegraben. [Loerkes Vater war übigens Ziegeleibesitzer.]
Oskar Loerke (* 13. März 1884 in Jungen bei Schwetz/ Wiąg in Westpreußen; † 24. Februar 1941 in Berlin) war ein deutscher Dichter des Expressionismus und des Magischen Realismus. Das Gedicht erschien 1934 im gleichnamigen Gedichtband.
Seine ausgeprägte Liebe zur Musik fand u.a. Ausdruck in veröffentlichten Texten zu Johann Sebastian Bach und 1938 zu Anton Bruckner:
1922 Wandlungen eines Gedankens über die Musik und ihren Gegenstand bei Johann Sebastian Bach
1935 Das unsichtbare Reich. Johann Sebastian Bach, S. Fischer
1938 Anton Bruckner. Ein CharakterbildBegleitmusik 2 | Johann Sebastian Bach „Geschwinde, ihr wirbelnden Winde (BWV 201)“ – eine weltliche Kantate. Im Autograph trägt sie den Titel „Der Streit zwischen Phoebus und Pan“]
-

Wie ins Bier gepisst
„Da schreibt man ein Buch, das man über alle Jahre hinweg liebt, und dann muss man so was erleben – das ist als würde man seinem Vater ins Bier pissen.“
Ernest Hemingway über die Verfilmung von „In einem anderen Land“
In einem andern Land ist ein Roman von Ernest Hemingway, der 1929 unter dem Titel A Farewell to Arms bei Charles Scribner’s Sons in New York erschien. Die deutsche Erstausgabe brachte Rowohlt 1930 in der Übersetzung von Annemarie Horschitz-Horst heraus. Der deutsche Titel basiert auf der 1927 in Scribner’s Magazine publizierten Kurzgeschichte In Another Country.
Hemingway lässt seine Erlebnisse als Sanitäter an der italienischen Front im Ersten Weltkrieg einfließen, wenn er über die Liebe zwischen einem in der italienischen Armee dienenden Amerikaner und einer britischen Krankenschwester während dieses Krieges erzählt.
Das Werk kam 1933 auf die Liste der zu verbrennenden Bücher.Verfilmungen:
1932: In einem anderen Land (A Farewell to Arms), Regie: Frank Borzage, Drehbuch: Oliver H.P. Garrett, Benjamin Glazer, Darsteller: Helen Hayes, Gary Cooper und Adolphe Menjou.
1957: In einem anderen Land (A Farewell to Arms), Regie: Charles Vidor und John Huston, Darsteller: Jennifer Jones, Rock Hudson und Vittorio De Sica. -

Podcasts für den Dezember
Tunnel 29 – die neue Staffel der von Helena Merriman berichteten und erzählten Serie „Intrigue“ von BBC Radio 4, erzählt die wahre Geschichte von Joachim Rudolph, der Anfang der sechziger Jahre als 22-jähriger Ingenieurstudent in der kommunistischen DDR nach West-Berlin floh und dann einen Tunnel zurück in die DDR, unter die Berliner Mauer, grub, um anderen Flüchtlingen zu helfen zu entkommen. In dieser von Stasi verfolgten Dramatisierung des Heldentums gibt es jede Menge Spaten und Schmutz zu sehen, wenn Rudolph und ein unwahrscheinliches Team von Helfern in Richtung eines ostdeutschen Kellers graben. Aber im Gegensatz zur narrativen, nervtötenden „Intrige“ der letzten Saison: The Ratline“ (verstörendes Schloss, NS-Grauen, Schreibmaschinengeräusche) findet „Tunnel 29“ in seiner Erzählung, Performance und Klanggestaltung eine geschickte Balance von Realismus und Dramatik. Eine überraschend schöne Toast-Essen-Szene mit Ananasmarmelade und Freiheit sorgt für einen unerwarteten Auftakt.
Hier ein Link zu den Hintergründen des Podcasts.
Bereits mehr als 25 Folgen haben Melanie Raabe und Laura Kampf aufgenommen. Ungefiltert und hemdsärmelig. Sie betonen, dass sie sich nicht auf das jeweilige Thema vorbereiten und spontan agieren. Das hat durchaus seinen Reiz und macht (mir) besonders Lust, den Gesprächen zu folgen. Die Erfahrungen und Ideen die sie teilen sind oft nicht neu, dennoch – in der Art und Weise der Präsentation – inspirierend.
Sie kommen aus dem gleichen Dorf. Inzwischen ist die eine Bestsellerautorin – und die andere Künstlerin, Designerin und Makerin mit über 350.000 Abonnenten auf Youtube. In diesem Podcast machen Melanie Raabe und Laura Kampf das, was sie ohnehin ständig tun: Sie sprechen über Kunst, Kreativität, das Freiberuflerinnendasein und alles, was es mit sich bringt: the good, the weird and the ugly.
…überall wo es Podcasts gibt.
Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Etwas sperrig der Titel, die Dialoge zwischen Knut Nippe und Malte Detje dagegen nicht. Es sind bereits mehr als 60 Folgen produziert; es dreht sich um Das Glauben und Zweifeln, die Bibel und Fragen wie: Ist Jesus wirklich Gott? Was ist Gnade? Braucht man das Alte Testament noch? Wie geht man mit Angst um? Gibt es einen freien Willen?
Beide berichten auch aus Ihrem geistlichen Alltag, sind überhaupt nicht dogmatisch, schauen über den Tellerrand und nehme auch Nichtgläubige mit. Wer sich mit Reigion und Glauben auseinandersetzt ist hier gut aufgehoben; auch wenn man nicht alle Sichtweisen, Auslegungen und Ansätze teilen mag.Verfügbar bei zahlreichen Podcasthostern.
-

Peer Teuwsen | Das gute Gespräch
Wie man erfolgreich fragt.
Manche Berufsleute sehen darin eine schnelle, einfach zu realisierende Textform: Mach doch einfach ein Interview, heißt es in Ermangelung origineller Einfälle auf der Redaktion. Ein paar Fragen stellen, das kann jeder; dir kommt dann schon etwas in den Sinn. Abtippen, abdrucken, und fertig ist der Spaß.
Und so sehen die Interviews auch aus: ambitionslos zusammengeschusterte Frage-Antwort-Abfolgen. Am anderen Ende des Spektrums stehen die Meisterstücke, wo wahre KönnerInnen das verschriftlichte Gespräch zur Perfektion treiben. Ein Journalist, der in der obersten Interview-Liga spielt, ist Peer Teuwsen. Der langjährige „Magazin“-Redaktor und heutige Korrespondent der Hamburger „Die Zeit“ in der Schweiz hatte im Laufe seiner Berufsjahre die Gelegenheit, zahlreichen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte im Gespräch gegenüberzusitzen. Nun lässt Teuwsen das Publikum auch am Entstehungs- und Selbstkritikprozess seiner Gespräche teilhaben. Herausgekommen ist, wie Teuwsen oder der Verlag es nennt, ein „Lehrbuch“, doch keines, das nur in aufrechter Sitzposition am Studierpult geniessbar ist. Der Untertitel verweist denn auch primär auf ein paar Seiten im Schlussteil des Buchs, wo der Autor seine Erkenntnisse zur guten Gesprächsvorbereitung und -führung thesenhaft verdichtet hat.
Der Hauptteil des Bändchens besteht aus dem Wiederabdruck von zehn Interviews, die Teuwsen in den letzten sieben Jahren für das „Magazin“ und die „Weltwoche“ geführt hat. Gespräche, die hohe Wellen geworfen haben, wie etwa jenes mit dem türkischen Schriftsteller Orhan Pamuk, mit Personen, die Teuwsen immer schon einmal treffen wollte, wie die beiden britischen Popstars Elton John und Robbie Williams. Als pädagogischen Mehrwert (wir lesen schließlich ein Lehrbuch) hat Teuwsen seinen Interviews ein „Making-of“ vorangestellt, in dem er die Vorgeschichte erzählt. Etwa, wie sich PR-Manager vor ihre prominenten Schützlinge stellten oder wie ihn beim Gespräch mit Susan Sontag ein Grüppchen Zuschauer in seinem Hotelzimmer beobachteten. In den Gesprächen selbst kommentiert Teuwsen seine Strategie bei bestimmten Fragen. Am Ende jedes Interviews resümiert der Autor schliesslich in einer kurzen Bilanz die gezogenen Lehren. Gerne würde man über den Gesprächsverlauf, über die Knack- und Wendepunkte, mehr erfahren. Im Gegensatz zu den einigermassen ausführlich geschilderten Vorgeschichten bleiben diese Zwischenbemerkungen erstaunlich knapp.
Den größten Mehr- und Lernwert bietet Teuwsen mit drei Gesprächen, die er speziell für das Buch mit anderen KönnerInnen des Fachs geführt hat. Aus den Interviews mit André Müller, Katja Nicodemus und Roger Schawinski wird bald einmal ersichtlich, dass ganz unterschiedliche Wege zum guten Gespräch führen:
Müller etwa behauptet, seine Gesprächspartner seien ihm gleichgültig. Schawinski hat sich mit der standardisierten Einstiegsfrage „Wer sind Sie?“ ein Markenzeichen geschaffen, das den Gesprächspartner gleich zu Beginn aus der Reserve lockt. Die Thesen, wie sie Teuwsen als Essenz seiner bisherigen Interviewerfahrung formuliert, würde von anderen JournalistInnen vermutlich ganz anders klingen.Bei allen unterschiedlichen Herangehensweisen und auch Fragetechniken wird eines klar: Ohne seriöse Vorbereitung geht gar nichts. Schnelles Format: von wegen! Das Interview ist eine der aufwendigsten Textsorten. „Alles lesen, was über diesen Menschen veröffentlicht wurde“, empfiehlt Teuwsen. Oder: „Interviewsituation thematisieren – Wenn der Interviewte schweigt, das Schweigen verbalisieren“; usw. Als Checkliste, und sei es nur, um sich seiner eigenen bewährten Methode zu vergewissern, taugen die Thesen Teuwsens zum Interview als journalistische Stilform alleweil.
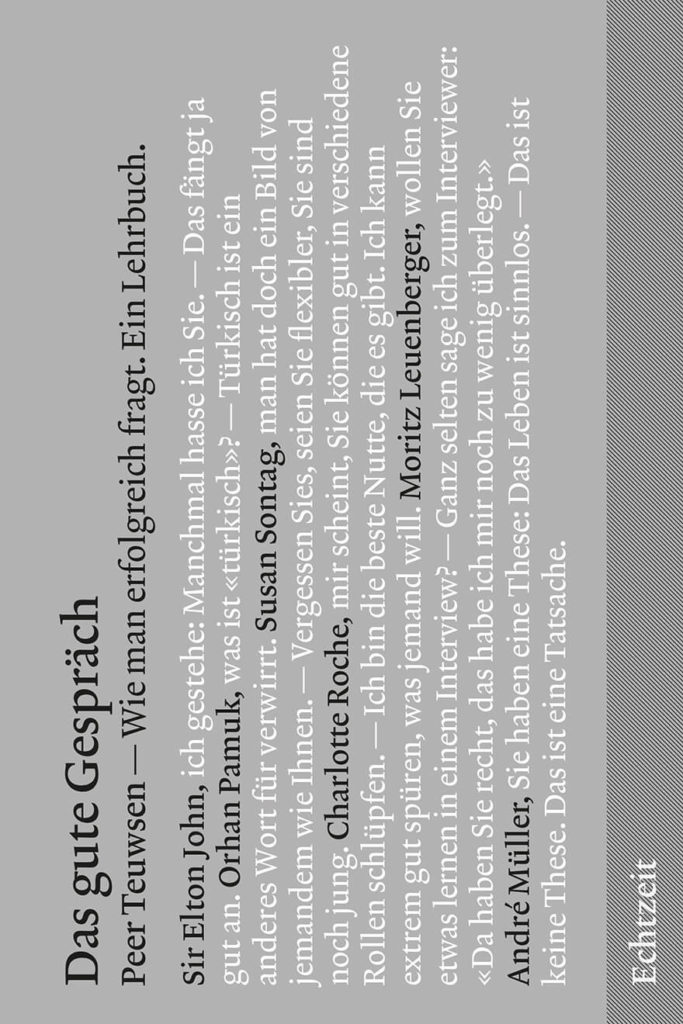
Das gute Gespräch
Wie man erfolgreich fragt Gebunden, 168 Seiten. 2009. SFr. 32.00, Euro 28.00
Echtzeit VerlagPeer Teuwsen: geboren 1967, führte zahlreiche aufsehenerregende Gespräche für «Das Magazin» und die «Weltwoche», wo er in leitenden Positionen tätig war. Danach war er für den Schweizer Bund der «Zeit» verantwortlich, jetzt als Redaktionsleiter bei «NZZ Geschichte».
-

Die Gelübde eines Autors
“The serious writer must take serious vows….a vow of silence, except through his work. A vow of consistency, sticking with writing to the exclusion of other fields. A vow of ego-chastity, abstaining from adulation. A vow of self-regard, placing the self as writer before the self as personality.”
― L.E. Sissman„Der ernsthafte Schriftsteller muss ernsthafte Gelübde ablegen….ein Gelübde des Schweigens, außer durch seine Arbeit. Ein Gelübde der Konsistenz, das beim Schreiben bleibt, ohne andere Felder. Ein Gelübde der Ego-Keuschheit, das auf die Bewunderung verzichtet. Ein Gelübde der Selbstachtung, das das Selbst als Autor vor das Selbst als Persönlichkeit stellt.“
- L.E. Sissman
-

Diese Erde hat Musik
Haben Sie auch schon bemerkt, dass heutzutage jeder versucht, ein echter Abenteurer zu sein? Vom Leben abseits des Stromnetzes, in einer Gemeinschaft von Schamanen im abgelegenen Amazonasgebiet bis hin zum Reiten auf wilden Pferden, die auf einem Vulkan in Island barfuß angetrieben werden, gibt es die verrücktesten Auswüchse in der Form des Reisens. Eher durch Zufall habe ich für mich entdeckt, dass Australiens Hinterhof die Heimat von wilden Orten ist, die reif für ein Abenteuer sind. Ein Roadtrip durch das Outback Queenslands liefert einen zutiefst befriedigenden Realitätscheck, dass Australien mehr zu bieten hat als glanzvolle Städte, Ayers Rock und überlaufene Strände.
Willkommen in Windorah
Eintausend zweihundert Kilometer westlich von Brisbane: die abgelegene Western Queensland Stadt Windorah ist eine willkommene Abwechslung nach ein paar Tagen Fahrt durch ein Gelände, das dem Set von Mad Max entsprungen sein könnte. Unterwegs begegnen Sie Emus mit einer gewissen Todessehnsucht, die diese direkt zu Ihrem Auto führt; wilden Herden von abtrünnigen Rindern, die Sie abfällig anstarren und sich hartnäckig weigern, von der Straße zu verschwinden. Zudem wahnsinnigen Mengen an überfahrenen Tieren in verschiedenen Stadien der, von Maden betriebenen, Zersetzung und dem blauesten blauen Himmel, bevölkert von Keilschwanzadlern, die ihn mit müheloser Anmut tranchieren.
Heimat für 150 Menschen ist Windorah die Art von Ort, wo die Menschen Ihnen in die Augen schauen, wenn sie mit Ihnen sprechen. Wahrscheinlich auch, weil es dort weder Wi-Fi noch Handy-Signal gibt. Und es ist auch die Art von Ort, an dem eine Dose von Queenslands Finest Beer – draußen vor der Tür des einzigen Pubs der Stadt verzehrt – das Beste ist, was man tun kann, nachdem oder bevor man ein paar Münzen in die Telefonzelle eingeworfen hat, um nach Hause zu telefonieren.Ein weiteres Highlight: Mit Sonnenschein in Hülle und Fülle ist es kein Wunder, dass diese verbrannte Ecke Australiens auch der Standort eines ziemlich spacigen Solarparks ist. Es ist irritierend, solch einen futuristisch anmutenden Sonnenteppich am Rande eines winzigen „Kuhdorfs“ zu sehen. Wi-Fi? Nein. Handy-Signal? Nein. Innovativer Multimillionen-Dollar Solarpark? Aber ja.
Einwohnerzahl: Null
Etwa vier Autostunden von Windorah entfernt, offenbart sich die wahre Bedeutung von „das hinterletzte Kaff“. Mit einer Einwohnerzahl von Null, ist Betoota gruselig wie die Hölle. Wahrhaftig ein Geisterstadt, maßgeschneidert als Kulisse für einen Horrorfilm, den Sie mit den Händen vor den Augen anschauen. während diese vor Schrecken zittern.
Betoota ist die einzige Ortschaft, um auf der 400 km langen, roten, staubigen und holprigen Straße zwischen den Städten Windorah und Birdsville anzuhalten. Betoota ist im Grunde genommen nur ein verlassener Pub, der einst als abgelegener Außenposten für Truckies und Reisende diente, die auf ein kühles Bier und ein Plausch vor der Weiterfahrt nach Windorah, Birdsville, Wolf Creek oder darüber hinaus. Geführt wurde er früher von einem tapferen, zuletzt achtzigjährigen Zöllner. Er verstarb 2004, nachdem er fast 50 Jahre lang der Wirt war. Heute ist die Kneipe eine Zeitkapsel, mit einer verrosteten Zapfsäule an der Vorderseite, an der Preise kleben, die seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem Markt zu finden sind.
Eine knarrende Fliegengittertür führt direkt zu einem großen Nostalgietrip: einer alten Küche voller Gerätschaften, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Staubige Arbeitsplatten sind mit Gläsern voll versteinerter Essiggurken und verblichenen Dosen mit ranzigen Gemüsesorten geschmückt. Nach der Durchquerung eines pechschwarzen Ballsaals, der von den Geistern promilleseliger Zeiten der Vergangenheit bevölkert scheint, kommt die Bar in Sichtweite. Und wie erwartet, besitzt sie die seltene Art von gruselnder Atmosphäre, die nur ein verlassener Pub mitten im Nirgendwo bieten kann:
Batterien von billigem Champagner, der mit Wüstenstaub bedeckt ist, säumen die Wände, und die unbeaufsichtigte Bar fühlt sich an wie Lust auf einen Ort, an dem die geisterhafte Erscheinung des Barkeepers aus dem Schatten heraustritt.Auf der Rückseite steht resigniert ein rostiger, gelber Doppeldeckerbus mit kaputten Fenstern herum, während Unkraut seine metallene Leiche erwürgt und Reptilien sich darauf sonnen. Die sinnbefreiten Worte „keep out“, die auf ein Stück Wellblech aufgesprüht wurden, haben nichts dafür getan, um neugierige Menschen davon abzuhalten, in einer der kleinsten Geisterstädte Australiens anzuhalten. Man kann sie dafür nicht wirklich schelten – Betoota ist wunderbar. Und abgesehen davon: es gibt sonst nirgendwo etwas wo man sich aufhalten kann, ohne geröstet zu werden).
Aus Liebe zu Birdsville
Birdsville, Heimat von etwa 115 Menschen, ist nicht weit von den Grenzen Südaustraliens und des Northern Territory entfernt, aber es ist Queensland durch und durch. Und noch einmal ist das Herzstück des Ortes eine Kneipe. Am Rande der Simpson-Wüste gelegen, bietet das Birdsville-Hotel seit 1884 Reisenden, Viehhaltern, Wanderern und Outback-Legenden Schäumereien an. Heute ist es eher Gastgeber für Touristen, die den Outback-Loop durchqueren oder die ikonische Düne der Simpson-Wüste besuchen, die liebevoll Big Red genannt wird.
Birdsville ist ein Ort, an dem man das Wort der Einheimischen respektiert. In der Kneipe warnen Schilder die Gäste davor, dass jeder, der mit seinem Smartphone erwischt wird, vom Barkeeper angemahnt wird und zwangsweise ein paar Münzen in die Sammelbox des Royal Flying Doctor Service einzuwerfen hat. Dieses Szenario funktioniert recht gut und sorgt dafür, richtig guten, altmodischen Spaß zu haben: echte Gespräche mit Fremden & Einheimischen sowie ungeschickten Singspielen am Klavier. Ja, das ist immer noch eine große Sache in Birdsville.
Während die Kneipe das unumstrittene Epizentrum der Stadt ist, sind Kamele ebenfalls ein integraler Bestandteil der Identität von BirdsviIle. Was Sie mit diesen „Schiffen der Wüste“ erleben wollen, liegt ganz bei Ihnen: Entweder Sie reiten die Hauptstraße hinauf und wieder hinunter oder Sie stecken sich in der Birdsville Bakery in ein großes Stück Kamelkuchen in den Mund. Alternativ gehen Sie einfach mal aufs Ganze und machen beides gleichzeitig).
Ein Ort wie Birdsville stellt viele Fragen an seine Bewohner; tiefe, verwirrende Dilemmata wie:
Was passiert, wenn der Laden kein Cola-Eis mehr hat und die nächste Lebensmittellieferung erst in einer Woche erwartet wird?
Wie überleben die Einheimischen die knackigen 5O-Grad-Sommer?Während Sie auf der Veranda mit einer Bierdose von XXXX sitzen, beobachten Sie, wie Flugzeuge auf der Landebahn fahren, die auf der anderen Straßenseite liegt, während Scharen von flammenden Rosakakadus in der Ferne kichern.
Sie haben vielleicht nicht die Antworten auf diese Rätsel, aber eine Sache ist sicher: dass Sie nicht in einer Welt ohne Birdsville leben wollen.[Referenz | Traumpfade von Bruce Chatwin] Die Erde hat Musik für diejenigen die zuhören. Heimat unheimlicher Geisterstädte, Kamikaze-Emus, geradliniger Einheimischer und karger Autobahnen: das Outback Queenslands ist unglaublich anmutig & erdend.
Titelbild: Birdsville DSC02987 SA || Ian Cochrane via flickr.com (CC BY 2.0)






