David Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär in Portugal. Dazwischen: ein korrupter Journalist, ein gescheiterter Gigolo, ein Banker, der alles verliert.
Neun Monate, neun Städte, neun Leben
Szalay ordnet sein Buch streng: Jede Geschichte spielt in einem anderen Monat zwischen April und Dezember, in einer anderen europäischen Stadt, mit einem Protagonisten, der jeweils um einige Jahre gealtert ist. Von Kopenhagen nach Budapest, von Dänemark nach Ungarn – die Schauplätze wechseln, die Themen bleiben: Männer, die um Status ringen, um Anerkennung kämpfen, an Erwartungen scheitern.
Dabei geht es Szalay nicht um große Dramen. Seine Figuren stolpern durch Alltägliches: Ein Mann verliert seinen Job, ein anderer seine Selbstachtung beim Versuch, eine Frau zu beeindrucken. Ein Londoner Gigolo merkt plötzlich: „Er fühlte sich, als wäre er durch sein ganzes Leben gerast, ohne es jemals wirklich zu berühren.“
Der Titel spielt mit uns
Im Original heißt das Buch „All That Man Is“ – und „man“ bedeutet im Englischen schlicht „Mensch“. Die deutsche Übersetzung macht daraus bewusst etwas Doppeldeutiges. Szalay selbst findet das gelungen: Diese Mehrdeutigkeit durchzieht sein ganzes Werk. Es geht ihm weniger um Männer als Geschlecht, sondern um Menschen in ihrer Verletzlichkeit.
Ein Bankier, der sein Vermögen verspielt hat, erkennt: „Alles, wofür er gearbeitet hatte, war nur Luft. Er selbst war nur Luft.“ Diese Momente – wenn die Fassade bröckelt und der Mensch darunter zum Vorschein kommt – interessieren Szalay.
Warum dieses Buch noch immer wichtig ist
Der Guardian nannte Szalay einen „modernen Flaubert“ und lobte seine präzise Beobachtungsgabe. Die Zeit schrieb: „Szalay zeigt, dass die Midlife-Crisis kein Geschlecht kennt, nur die panische Erkenntnis der eigenen Endlichkeit.“
Genau das macht die Stärke des Buches aus: Es gibt keine durchgehende Handlung, keine Hauptfigur, der man folgt – und doch entsteht durch die Montage der Geschichten ein Sog. Man erkennt sich wieder in diesen Männern, egal welches Geschlecht man hat. Ihre Krisen sind universell: die Angst vor dem Scheitern, die Sehnsucht nach Bedeutung, die Erkenntnis, dass die Zeit verrinnt.
Eine weibliche Gegenstimme: Rachel Cusk
Wer nach einer Ergänzung zu Szalays nüchternem Blick sucht, sollte Rachel Cusks „Outline“ (2014) lesen. Auch Cusk arbeitet mit Fragmenten, auch sie interessiert sich für Menschen in Übergangsphasen. Doch während Szalay seine Protagonisten von außen beobachtet, lässt Cusk ihre Erzählerin fast verschwinden – sie wird zur Zuhörerin, zum Spiegel für andere.
In einem Essay für den New Yorker schreibt Cusk über das Schreiben nach persönlichen Krisen: „Ich wollte eine Form finden, die nicht auf dem Ich besteht, sondern Raum lässt für das, was zwischen Menschen geschieht.“ Diese Haltung ergänzt Szalays Ansatz perfekt: Wo er männliche Archetypen entromantisiert, löst Cusk das erzählende Subjekt selbst auf.
Beide Autoren zeigen: Das Leben ist flüchtig, tragikomisch, oft sinnlos – und gerade deshalb erzählenswert.
Zum Autor: David Szalay wurde in Montreal geboren und wuchs in London auf. In seinen früheren Werken wie „London and the South-East“ beschäftigte er sich bereits mit Arbeitswelten und brüchigen Identitäten. Seine Geschichten erscheinen in Zeitschriften wie dem New Yorker und der Paris Review.
-
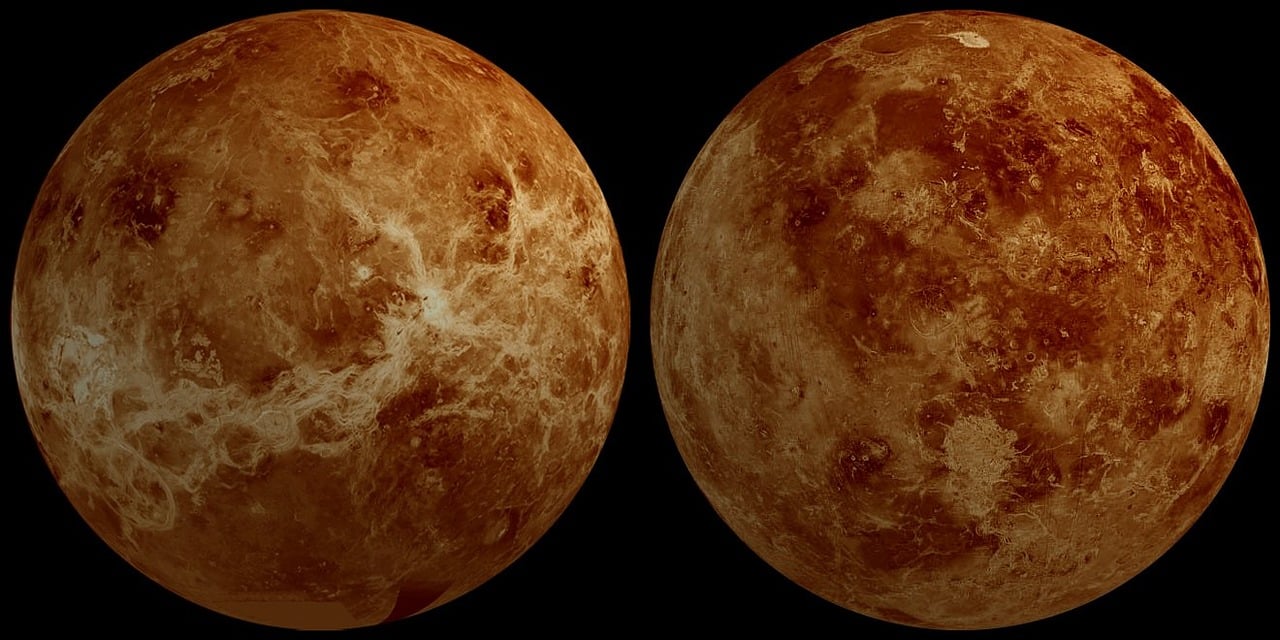
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Ille Chamier – Lied 76
2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
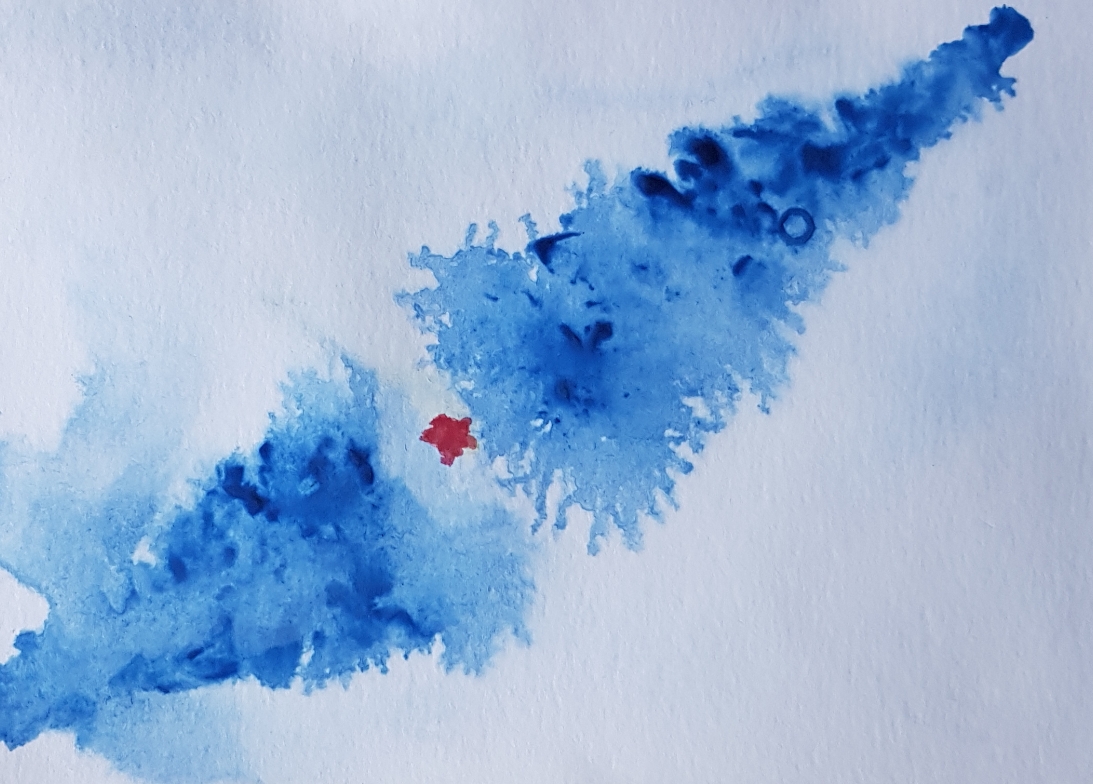
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Körper als Archiv
2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…
-

Annette Hagemann – MEINE ERBSCHAFT IST DIESE
Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
-

David Szalays „Was ein Mann ist“
2–3 MinutenDavid Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär…

