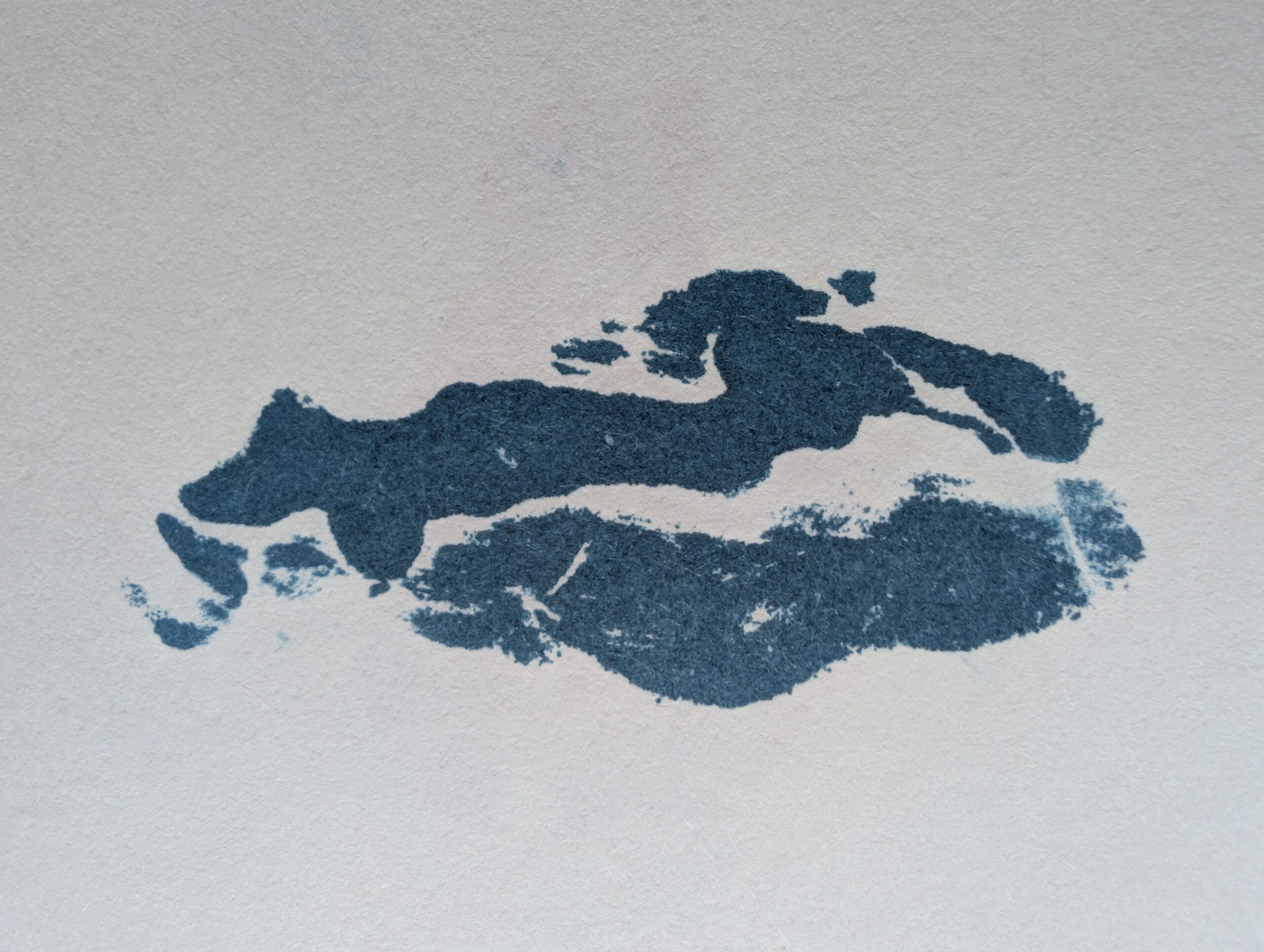Beim ersten Lesen von Klaus Johannes Thies Text „Im Schwimmbad mit Derrida“ stellt sich eine eigentümliche Ratlosigkeit ein. Was ist das? Ein Traumbericht? Eine philosophische Reflexion? Eine Alltagsbeobachtung? Der Text entzieht sich jeder eindeutigen Zuordnung – und genau darin liegt sein Geheimnis. Denn Thies schreibt nicht über Derridas Dekonstruktivismus, er vollzieht ihn.
Das Verschwimmen der Grenzen
Der Text beginnt mit einer unmöglichen Szene: ein Wettkampf mit dem längst verstorbenen Philosophen Jacques Derrida im Schwimmbad. Sofort verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit („Das Bett war nass“), zwischen Leben und Tod, zwischen möglich und unmöglich. Diese Auflösung binärer Oppositionen ist ein Kernprinzip der Dekonstruktion. Thies zeigt: Die Kategorien, mit denen wir Wirklichkeit ordnen wollen, sind durchlässiger als gedacht.
Die Unmöglichkeit von Präsenz
Mitten im Text kommt der entscheidende Moment: „Wie schade, dass es ihn jetzt nicht mehr gab. Ich musste etwas anderes erfinden, das jetzt zu gleicher Zeit mit mir in diesem Schwimmbad existierte.“ Hier wird sichtbar, was Derrida différance nannte – die permanente Verschiebung von Bedeutung und Präsenz. Derrida ist abwesend, aber gerade durch seine Abwesenheit im Text präsent. Der Erzähler erkennt, dass er einen Ersatz braucht, ein Supplement – aber dieser Ersatz wird selbst Teil des Spiels von Anwesenheit und Abwesenheit.
Intertextuelle Verweise
Derrida spricht im Schwimmbad „über Glas und über Postkarten“ – eine subtile Anspielung auf seine eigenen Werke Glas und Die Postkarte. Der Text verweist auf sich selbst als Text, als Konstruktion. Er macht transparent, dass er nicht einfach etwas „abbildet“, sondern selbst Teil eines Netzes von Verweisen ist.
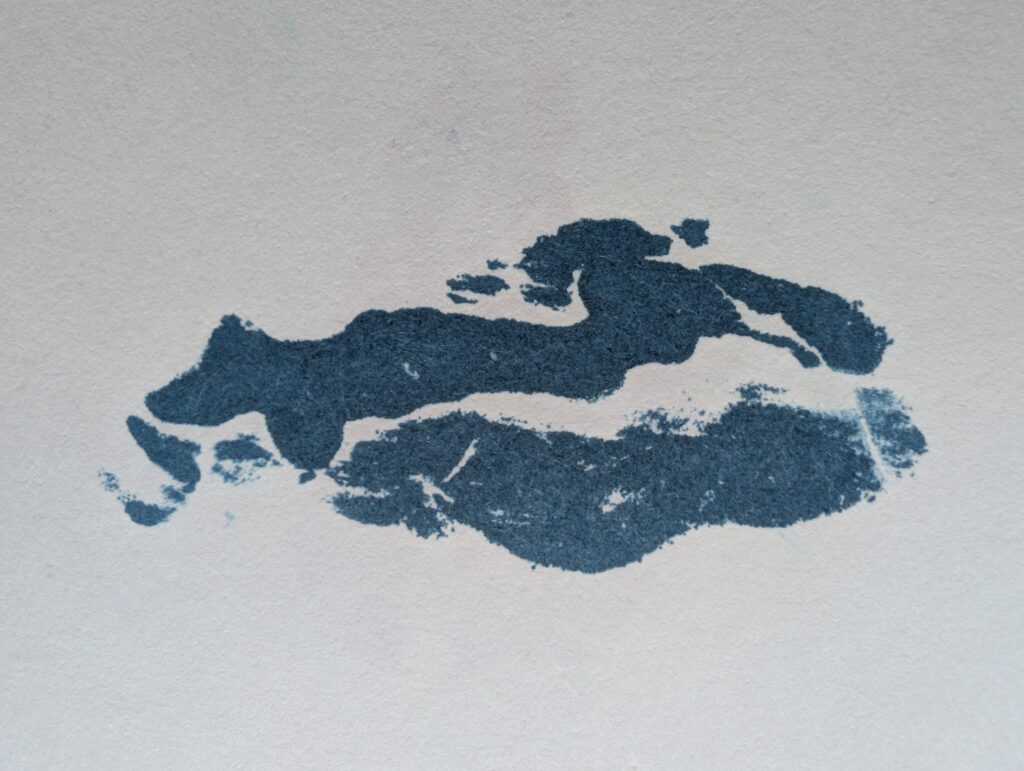
Schwimmen statt Lesen
„Wir schwammen also, was einfacher ist, als seine schwierigen Bücher zu lesen.“ Hier etabliert Thies eine scheinbare Hierarchie: Schwimmen als Ersatz für das intellektuell anspruchsvolle Lesen. Doch der Text behandelt beides gleichwertig – das körperliche Schwimmen wird zur philosophischen Praxis. Das Supplement (Schwimmen) ist nicht weniger wert als das Original (Lesen), es erweitert und verschiebt es nur.
Die permanente Aufschiebung
Der Text kommt nie zum Punkt. Ständig gibt es Einschübe, Unterbrechungen: „Ein paar Sätze noch (bis zu den Nachrichten), ein wenig Chopin, oder schnell noch mal die Zähne putzen…“ Diese Struktur der permanenten Verschiebung, des Nie-Ankommens, ist selbst dekonstruktivistisch. Der Text entzieht sich dem Abschluss, der endgültigen Bedeutung. „Dabei hätte ich so viel noch zu erzählen, so viel“ – aber dieses „Viel“ bleibt aufgeschoben, verschoben, different.
Philosophie als literarische Praxis
Klaus Johannes Thies macht Dekonstruktion lesbar, ohne sie zu erklären. Der Text spricht nicht über Derridas Philosophie, er lässt sie geschehen. Für Leser, die mit Derrida nicht vertraut sind, mag der Text zunächst verwirrend wirken – doch gerade diese Verwirrung, dieses Schwimmen zwischen den Kategorien, ist der Punkt. Der Autor zeigt: Philosophie muss nicht abstrakt bleiben, sie kann sich in der konkreten Sprache, im Traumprotokoll, im Alltäglichen ereignen.
Der Text ist für mich ein kleines Meisterwerk der literarischen Philosophie – oder der philosophischen Literatur. Die Grenze ist ohnehin nicht mehr zu ziehen.
„Im Schwimmbad mit Derrida“ ist erschienen in Unsichtbare Übungen.
Titelfoto: Tiffany Bernarte
-

Ein schöner Satz vorweg.
2–3 MinutenÜber Epigraphen und die Kunst, sie zu überlesen – oder zu nutzen. | Hansjörg Schertenleib, Der Antiquar. Ich blättere die erste Seite auf, und da steht: „Der Weg vollendet sich. Der Schnee fällt in tausend Flocken. Mehrere Rollen blauer Berge sind gemalt worden.“ – Shōbōgenzō Mein erster Gedanke: Das ist ein Haiku. Die Kürze, das…
-

Karen Roßki – Austausch
1–2 MinutenDrei Miniaturen zu einer Zeichnung: Nichts bleibt für sich.Linien steigen auf, andere sinken zurück.Was sich verdichtet, gibt ab.Was aufragt, ist nicht getrennt vom Grund.Bewegung geht in beide Richtungen.Austausch heißt hier nicht Ausgleich.Es ist ein fortwährendes Weitergeben von Spannung. Linien gehen nach oben und kommen zurück.Der Grund bleibt beteiligt.Austausch ist kein Gespräch, sondern Durchlässigkeit. Lange wirkt…
-

Karen Roßki – Durchdringen
1–2 MinutenNichts greift hier ineinander.Von oben drängt etwas Fremdes ins Bild, faserig, hart gesetzt.Unten arbeitet eine andere Bewegung, schwer, erdig, unruhig.Die Farben mischen sich nicht, sie stoßen.Was durchdringt, verbindet nicht.Es verschiebt, verdrängt, reibt sich fest.Der Raum hält das aus, aber er schließt sich nicht.Nähe entsteht hier nicht aus Übergang, sondern aus Druck. In Bezug auf: Karen…
-

Karen Roßki – Weit
1–2 MinutenEs gibt keine Linie, an der das Sehen zur Ruhe kommt.Flächen schieben sich übereinander, als hätten sie Zeit gesammelt.Das Dunkle trägt, das Helle setzt an.Nichts öffnet sich nach außen, alles breitet sich aus.Bewegung ohne Richtung, Dichte ohne Schwere.Zwischen den Schichten bleibt kein leerer Ort, nur Übergang.Was wie Tiefe aussieht, ist Nähe.Was weit scheint, hält fest.…
-

Elisabeth Wesuls – Was ein Kind ist, um 1960
2–3 MinutenGegen das Kind als Postpaket | Beim Lesen eines kurzen Prosatextes über Kindheit „um 1960“ stellt sich ein unmittelbarer Impuls ein: Man möchte widersprechen. Nicht einer Meinung – sondern einem Bild. Der Text zählt auf, was einem Kind zugeschrieben wurde: dass man es „nichts fragen“ müsse, dass ihm „kein eigener Wille“ zugestanden wird, dass es…
-

Elisabeth Wesuls – Hohe Klinken
2–3 MinutenElisabeth Wesuls erzählt von einem Besuch, bei dem man nur eintreten darf, wenn man sich klein macht. Eine Annäherung: Das Eintreten ist kein Beginn, sondern bereits eine Prüfung. Die Tür muss geöffnet werden, nicht sie selbst tritt ein. Der Körper des Mannes entscheidet, wie viel Raum ihr zusteht. Sie passt nur hindurch, indem sie sich…
-

Elisabeth Wesuls – Geschichte
4–6 MinutenTarnung, Enttarnung und das Unheimliche der Kontinuität. Annähernd gelesen | Beim ersten Lesen von Elisabeth Wesuls Miniatur gibt es diesen Moment des Innehaltens. Fast eine Schrecksekunde. Nicht wegen der historischen Kulisse, nicht wegen der Ideologie. Sondern wegen eines Namens. Zunächst bleibt alles im Bereich des Hörensagens. „Man erzählt“, „manche sagen“, „die Leute, die das erzählen“.…
-

Himbeeren – Valerie Zichy
4–6 MinutenHIMBEEREN das hier ist autofiktion. das ich hier ist autofiktion. das ich hinter diesem text isst gerne himbeeren. das ich hat oft ein schlechtes gewissen. und regelschmerzen. das ich trinkt heiße schokolade. das ich ist fiktiv. das ich ist ich und das ich ist nicht ich. das ich ist babysitterin. das ich zieht über-all die…
-

Er im Dialog mit Sandrines fragmentarischen Erinnerungen
1–2 MinutenSandrine, dein Atem ist Gänsedaunen. Meiner stockt beim Lesen, wird zu Stein in der Brust. Während du die kommenden Verheerungen spürst, taste ich mich an bereits vergangene heran. Deine Zeit friert in stehenden Gewässern – meine fließt linear fort, Datum für Datum, wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht. Vielleicht ist das der Unterschied. Du schreibst…
-

Schief gewickelt, wie ich bin! – Herausgelesen
2–3 MinutenEs ist unbefriedigend, etwas teilen zu wollen, was man nicht direkt zeigen kann. Wie in diesem Fall: „Schief gewickelt, wie ich bin!“ Frottage mit Zeichnung von Ille Chamier. Daher habe ich versucht festzuhalten was ich dem Bild entlockt habe: Falsche Schritte? Sie steht da, ein Knoten aus Linien und Schatten,geformt aus Plänen, die nie so…
-

Süleyman I. & Roxelane | Liebesbekundungen
3–5 MinutenAus einem Liebesbrief an den Sultan und seine poetische Widmung an Roxelane Während seiner Feldzüge ließ Sultan Süleyman I. (1494 – 1566) keinen Moment aus, um seiner geliebten Hürrem [Roxelane], die im Schloss auf ihn wartete, Briefe und Gedichte zu schreiben. Diese verliehen Hürrem Kraft und Hoffnung auf ein Wiedersehen. Auch ihre Antworten drückten leidenschaftliche Sehnsucht…