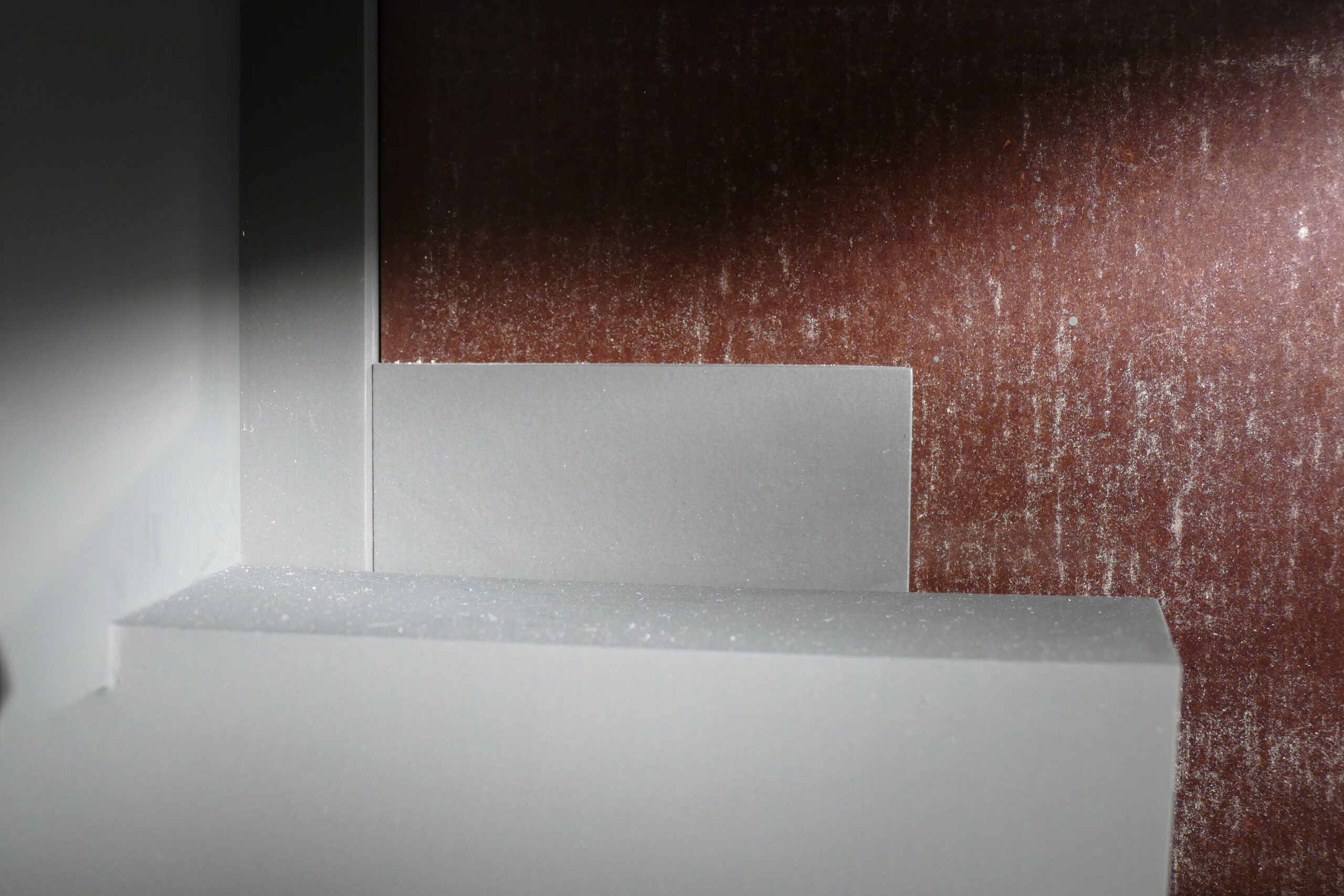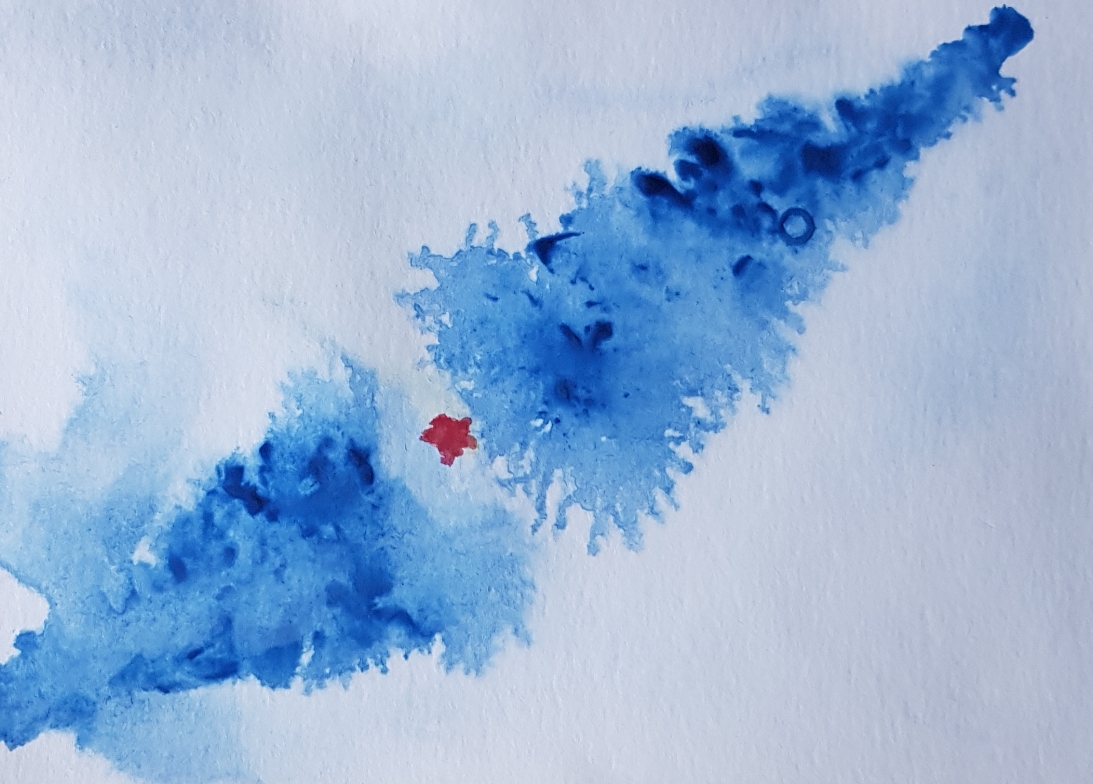Esther Kinskys Roman Hain. Ein Geländeroman erschien 2018 im Suhrkamp Verlag und wurde seitdem vielfach besprochen und mit Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Das Buch entzieht sich einfachen Gattungszuschreibungen; es lässt sich schwer einordnen – irgendwo zwischen autobiografisch grundierter Reiseerzählung, poetischer Prosa und kulturreflexivem Erzählen. Es ist autobiografisch grundiert, aber kein klassischer autobiografischer Text; es handelt von Reisen, ist aber kein Reisebuch im herkömmlichen Sinne; es reflektiert über Sprache, Natur, Erinnerung und Tod, ohne eine lineare Handlung zu verfolgen. Stattdessen lässt sich Hain als poetisch durchwirkter Erzählraum begreifen – ein literarisches Gelände, das durchquert und erkundet wird. Das Buch beschreibt drei Aufenthalte in Italien, die durchzogen sind von Erinnerungen, Beobachtungen und Reflexionen über Sprache, Landschaft und Verlust.
Inhalt und Struktur
Im Zentrum steht eine namenlose Ich-Erzählerin, die nach Italien reist – nicht auf der Suche nach den klassischen Sehenswürdigkeiten oder der malerischen Postkartenidylle, sondern auf der Suche nach Zwischenräumen. Sie hält sich in drei verschiedenen Gegenden auf: zunächst in Olevano Romano östlich von Rom, eine Kleinstadt, die schon in der Kunstgeschichte als Rückzugsort für deutsche Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert bekannt war; später in Chioggia südlich von Venedig; schließlich in Comacchio am Rand des Po-Deltas sowie der Polesine-Region im Nordosten und dem südlichen Apulien. Die Landschaften, Städte und Begegnungen vor Ort dienen als Resonanzräume für persönliche Erinnerungen, insbesondere an den Tod eines nahestehenden Menschen, genauer ihres Vaters. Die Landschaften, Begegnungen und alltäglichen Beobachtungen bilden das narrative Gewebe, in das Erinnerungen an den Vater und frühere Reisen eingesponnen sind. Immer wieder tauchen Motive des Übergangs, der Schwellen und der „Zwischenräume“ auf – in topografischer wie auch in existenzieller Hinsicht.
Geländeroman
Der Untertitel „Ein Geländeroman“ spielt dabei auf den Begriff des „Geländes“ an – nicht im Sinne eines Abenteuers, sondern als Versuch, sich über das Gehen, Sehen und Erinnern ein inneres Gelände zu erschließen. Der Begriff ist ungewöhnlich und verweist auf ein zentrales Motiv des Buches: das Umhergehen, das Unterwegssein, das sich dem Gelände Aussetzen. Es geht um ein Gehen in Sprache, Erinnerung und Landschaft – ähnlich wie bei W. G. Sebald, mit dem Kinskys Werk häufiger in Verbindung gebracht wird. Der Text ist dabei durchzogen von poetischen, fast meditativen Beschreibungen: von Friedhöfen, verwilderten Gärten, Straßenhunden, Zugfahrten und Geräuschen. Es handelt sich dabei nicht um einen klassischen Roman mit Handlung, sondern eher um eine literarische Erkundung in essayistisch-poetischer Form.
Die Autorin Esther Kinsky
Esther Kinsky wurde 1956 in Engelskirchen (NRW) geboren. Sie lebt als Schriftstellerin, Übersetzerin und Lyrikerin in Deutschland und England. Ihre literarische Arbeit ist vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Erich-Fried-Preis und dem Kleist-Preis. Ihr Werk ist stark geprägt von Mehrsprachigkeit, Naturwahrnehmung und Grenzräumen – sowohl geografisch als auch sprachlich und existenziell. Kinsky lebte viele Jahre in London und übersetzte unter anderem Werke von Iossif Brodsky, Olga Tokarczuk, John Burnside, Henry David Thoreau, John Clare und zuletzt J. O. Morgan ins Deutsche. Auch ihre eigene Prosa und Lyrik ist stark von poetischen und sprachreflektierenden Verfahren geprägt. Neben ihrer Prosa hat Kinsky auch Lyrik veröffentlicht, etwa den Band Schiefern (2016), der ebenfalls von Naturbeobachtung und dem Vergehen der Zeit durchzogen ist. Ihre Bücher sind für ihren präzisen, beinahe fotografisch feinen Stil bekannt. Kinsky nähert sich den Dingen in ihrer eigenen Zeit – bedächtig, vielschichtig, oft mit einem ethnografischen Blick.
Über das Verhältnis von Landschaft und Sprache sagte Kinsky in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur: „Ich habe mich schon immer für die Landschaft als eine Form von Text interessiert. Das Gelände, durch das man sich bewegt, ist ein Erzählraum – und ein Raum, in dem Erinnerung abgelagert ist.“ In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Kinsky einmal: „Ich bin keine Schriftstellerin, die sich an Erzählfäden entlangschreibt. Mich interessieren eher die Leerstellen, das, was man nicht sagen kann.“ Dieser Satz charakterisiert auch Hain treffend, in dem das Schweigen, das Verschwiegene und das Nicht-mehr-Vorhandene immer wieder in den Vordergrund rücken. Ihr Schreiben ist stark geprägt von einem beobachtenden, zurückgenommenen Erzählen. Es geht weniger um Handlung als um Wahrnehmung. In einem Porträt der Süddeutschen Zeitung hieß es: „Kinsky schreibt gegen das Sprechen an, das alles einhegen, erklären, benennen will – sie hört den Dingen zu, statt sie zu beherrschen.“
Entstehung und Hintergründe
Hain entstand nach dem Tod von Kinskys Lebensgefährten, dem englischen Schriftsteller und Übersetzer Martin Chalmers, der 2014 starb. Obwohl das Buch keine explizite Trauerliteratur ist, durchzieht das Thema Verlust den gesamten Text. Der Tod ist nicht Mittelpunkt, sondern Echo – das im Gelände widerhallt. Der Roman ist daher auch ein Trauerbuch – aber kein intimes Bekenntnis, sondern ein literarisch gestalteter Rückzugsraum. Die Reisen nach Italien bilden eine Art Zwischenzustand, ein Schweben zwischen Orten, Sprachen und Zeiten. In einem Interview mit der FAZ sagte Kinsky über das Buch: „Ich habe nichts verarbeitet – ich habe etwas erzählt. Schreiben ist nicht Therapie, sondern Wahrnehmung.“ Die Wahl Italiens als Schauplatz hat mehrere Gründe: Kinsky verbrachte als junge Frau viel Zeit dort, spricht Italienisch und kennt viele der beschriebenen Orte aus früheren Reisen. In der Rückkehr dorthin liegt eine Bewegung in die Vergangenheit, aber auch ein Versuch, die Gegenwart zu verorten. Es handelt sich um ein leises, tastendes Schreiben, das weniger verarbeiten als verstehen will.
Rezeption und Auszeichnungen
Hain wurde 2018 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse (Kategorie Belletristik) ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es: „Esther Kinsky hat ein Werk von großer poetischer Kraft und existenzieller Tiefe geschrieben, das sich jeder einfachen Einordnung entzieht.“ Auch die Kritiker würdigten das Buch als Grenzgänger zwischen den Gattungen – nicht zuletzt aufgrund seiner formalen Eigenwilligkeit, der offenen Struktur und der sprachlichen Dichte.
Stilistische Eigenheiten
Der Text ist durchzogen von mehrsprachigen Elementen, Zitaten aus alten Reiseführern und literarischen Anspielungen. Immer wieder steht die Frage im Raum, was es bedeutet, fremd zu sein – in einer Sprache, in einem Land, in der eigenen Erinnerung. Kinsky arbeitet dabei häufig mit Kontrasten: zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erinnerung und Beobachtung. Auch das Layout – kurze Absätze, Leerstellen, Einschübe – unterstützt diesen fragmentarischen, tastenden Stil. Das Buch verzichtet weitgehend auf Dialoge und klassische Handlungselemente. Es ist durchsetzt mit Reflexionen über das Verhältnis von Sprache, Erinnerung und Natur. Zahlreiche literarische, kulturgeschichtliche und historische Verweise durchziehen den Text – subtil und oft beiläufig. Der Erzählton ist durchgängig ruhig, zurückgenommen, beinahe kontemplativ.
Fazit
Hain. Ein Geländeroman ist kein Buch im klassischen Sinne einer Geschichte mit Anfang, Höhepunkt und Ende. Vielmehr ist es ein feingliedriges, sprachlich präzises und vielschichtiges Werk über das Gehen, Sehen, Erinnern und Schweigen, das sich den einfachen Kategorien entzieht. Es stellt Fragen, ohne Antworten zu liefern – und ist damit selbst ein Gelände, durch das man sich langsam bewegt, tastend, beobachtend. Esther Kinsky eröffnet damit einen Raum für das literarische Durchqueren von Landschaft und Verlust, Sprache und Erinnerung – ein Gelände, das von der Leserin oder dem Leser selbst betreten werden will.