Vor der Lektüre | Das Buch besteht aus sechs Kurzgeschichten, die verschiedene Aspekte des Verschwindens umkreisen. Laut Klappentext sammelt Sandig darin Geschichten von Menschen, deren Erzählungen verloren zu gehen drohen. Es geht um Erinnerung, um Migration, Flucht, Verlust. Die Texte arbeiten mit verschiedenen Formen – Lyrik, Prosa, dokumentarische Passagen – und folgen keiner durchgehenden Erzählung.
Ein Satz aus dem Buch hat mich dabei besonders aufhorchen lassen: „Es gibt Dinge von so unwahrscheinlicher Natur, dass die Leute sie einfach nicht glauben. Das stimmt nicht, sagen sie dann, als wären sie dabei gewesen. Aber sie waren nicht dabei und können es nicht wissen. Schreibt man diese unwahrscheinlichen Dinge aber auf und nennt sie eine Geschichte, dann glauben die Leute alles.“
Ulrike Almut Sandig, geboren 1979 in Großenhain, ist Lyrikerin und Klangkünstlerin. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert und ist bekannt für ihre experimentelle Arbeit mit Sprache. Das ist mein erstes Buch von ihr.
Was mich reizt: Was genau soll hier nicht verschwinden? Und wie schreibt man dagegen an? Die Frage, wie man Geschichten bewahrt, wenn sie keinen selbstverständlichen Platz mehr haben. Und wie sich sechs unterschiedliche Annäherungen an das Thema Verschwinden lesen werden.
Annähernd gelesen
„am elften Dezember 2117 zieht die Venus wieder als blinder Fleck vor der Sonne vorüber, so haben es Forscher berechnet.“
Mit diesem Satz eröffnet Ulrike Almut Sandig den titellosen Text, der ihrem Erzählband ‚Buch gegen das Verschwinden‘ vorangestellt wurde.
Diese wissenschaftliche Tatsache wird mit persönlicher Zeit verknüpft. Die Erzählerin denkt voraus: Weder sie selbst, noch ihr Gegenüber, noch das ungeborene Kind werden dann noch leben. Die dreifache Verneinung – „du nicht mehr da“, „ich auch nicht mehr da“, „das Kind […] auch gar nicht mehr da“ – ist unausweichlich in ihrer Klarheit. So entsteht eine still abgewogene Perspektive auf Vergänglichkeit, die das Ende individueller Existenz im Kontrast zur berechenbaren Wiederkehr eines Naturereignisses zeigt.
Doch dem Verschwinden des Persönlichen steht ein anonymes „man“ gegenüber: „man wird im Freien stehen“, „man wird […] entgegensehen“. Während die konkreten Personen vergehen, bleibt die Menschheit als Kontinuum – nicht als Trost, sondern als nüchterne Einsicht. Es wird jemand da sein, der schaut, der staunt, der erkennt. Das ist die stille Hoffnung des Textes: nicht persönliches Überdauern, sondern die Fortdauer des menschlichen Blicks selbst.
Gleichzeitig verweist das Wort Sonnabend auf sprachlichen Wandel. Vielleicht, so heißt es, werde man dieses Wort bis dahin gar nicht mehr benutzen. Damit weitet sich das Thema des Verschwindens von der körperlichen auf die sprachliche Ebene – Erinnerung, Ausdrucksformen, Benennungen verändern sich oder gehen verloren.
Formal unterstützt die konsequente Kleinschreibung nach Punkten diese Kontinuität: Es gibt keine hierarchischen Neuanfänge, keine Unterbrechung. Die Sätze schließen sich nicht ab, sondern fließen ineinander – wie die Zeit selbst, die nicht neu beginnt, nur weitergeht. Die Orthografie ist ansonsten eingehalten, was die Geste umso präziser macht: ein gezielter, asketischer Eingriff an genau der Stelle, wo traditionell Autorität und Neuordnung sitzen.
Am Ende öffnet der Doppelpunkt den Text auf das Wesentliche hin: „einen fast unsichtbaren, pechschwarzen Punkt.“ Er ist eine Geste des Zeigens, des Weitens. Nach all dem Verschwinden bleibt das Bild des Venustransits – ein Zeichen dafür, dass etwas verschwindet und zugleich sichtbar bleibt. Als Eingangstext steht das Gedicht programmatisch für das Buch: Es richtet sich gegen das Vergessen, indem es benennt, was einmal war und was künftig fehlen wird.
Fortsetzung folgt…
Bibliografische Angaben:
Ulrike Almut Sandig – Buch gegen das Verschwinden
Schöffling & Co., Frankfurt am Main – 2015
168 Seiten
ISBN 978-3-89561-464-8
-

Øyvind Berg – Schwärze, was ist das?
2–3 minutesin LyrikØyvind Bergs Gedicht „Schwärze, was ist das? / Licht in einem ungeöffneten Buch. / Gebärmutterlicht.“ verdichtet in drei Zeilen eine tiefgründige Reflexion über das Verborgene, das Potenzial und den Ursprung von Existenz. Hier meine Annäherung an diesen Text: Schwärze als paradoxer Träger von Licht:Die Frage „Schwärze, was ist das?“ setzt ein, indem sie das scheinbar…
-

Tagtexte – Ille Chamier
1–2 minutesLektüreNotizen | Knappe biografische Angaben zur Autorin, ansonsten: kein Klappentext, kein Marketingsprech, kein Inhaltsverzeichnis. Lesende sind mit sich und den Texten allein. Das ist gut. Die Tagtexte sind in Lyrikform ; wobei ich nicht weiß, ob der Einzeiler am Anfang bereits ein Gedicht ist. Jedenfalls ist er der Einstieg in eine (zu erzählende) Geschichte. „das…
-

Adolf Endlers Gedicht „Dies Sirren“
2–4 minutesAdolf Endlers Gedicht „Dies Sirren“ aus dem Jahr 1971 wirkt auf den ersten Blick wie ein surrealistisches Rätsel. Doch hinter der grotesken Szenerie dieser nur vier Zeilen verbirgt sich eine vielschichtige Auseinandersetzung mit historischen Traumata und politischer Ohnmacht. Basierend auf biografischen und literaturkritischen Quellen, bietet es Einblicke in ein rätselhaftes Meisterwerk, das zu den Schlüsseltexten…
-

Warum ich eine „vergessene“ Literatin & Künstlerin sichtbar machen möchte
3–4 minutesVon meiner Tochter wurde ich gefragt, warum ich mich auf meinem Literaturblog einer Autorin widme, die der breiten Öffentlichkeit heute kaum noch bekannt ist: Ille Chamier. Eine Frau, die seit Jahrzehnten nicht mehr in Verlagen publiziert hat und deren gedruckte Werke rar sind. Abgesehen von zwei Verlagsbüchern hat Ille Chamier ihre Texte überwiegend im Selbstverlag…
-

Gegenentwürfe zur Ratlosigkeit: Wiederaufbruch
2–3 minutesMeine Entwürfe beziehen sich auf das Gedicht RATLOS von Jürgen Völkert-Marten. Im Dunkel der Nacht, dieses bodenlose Schwarz, wo Fragen wie Schatten wuchsen, ungreifbar, und die Stille selbst nach einer Antwort schrie, einer wirklichen, da begann es, dieses zaghafte Flimmern. Nicht laut, kein Donner, der zerbricht, nicht grell, kein Blitz, der blendet, sondern wie ein…
-

Ille Chamier & Karen Roßki
1–2 minutesDAS ZÜNDBLÄTTCHEN – Heft 21 LektüreNotizen | Das Heft beinhaltet acht Gedichte der in Düsseldorf lebenden Autorin Ille Chamier und vier Bleistiftzeichnungen der Dresdner Künstlerin Karen Roßki. Stammabschnitte von Bäumen, die, obwohl blattlos, für mich die Energie der vier Jahreszeiten vermitteln. Details von Ästen, , markante Jungbäume, Totholz(?). Die Zeichnungen erinnern teils an Fabelwesen, so…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 minutesIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
2–3 minutesDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Das tierische Gebet
3–4 minutesin LyrikIch preise Dich Herr, / Darum hüpfe ich | Drutmar Cremer Tiere beten in Dur heiter beschwingt schlitzohrig – so lautet der Untertitel dieses Buches. Und ja, ungewöhnliche Gebete sind das, die der Benedektiner Drutmar Cremer da verfasst hat. Charakteristisch für das lyrische Werk des Dichters, Verlegers & Theologen Drutmar Cremer ist sein sparsames Vokabular,…
-

Feministische Lyrik | Eine historische Annäherung
5–8 minutesFeministische Lyrik im deutschsprachigen Raum nach 1945 Die Geschichte der feministischen Lyrik im deutschsprachigen Raum ist eine Geschichte der Grenzüberschreitung – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist…
-
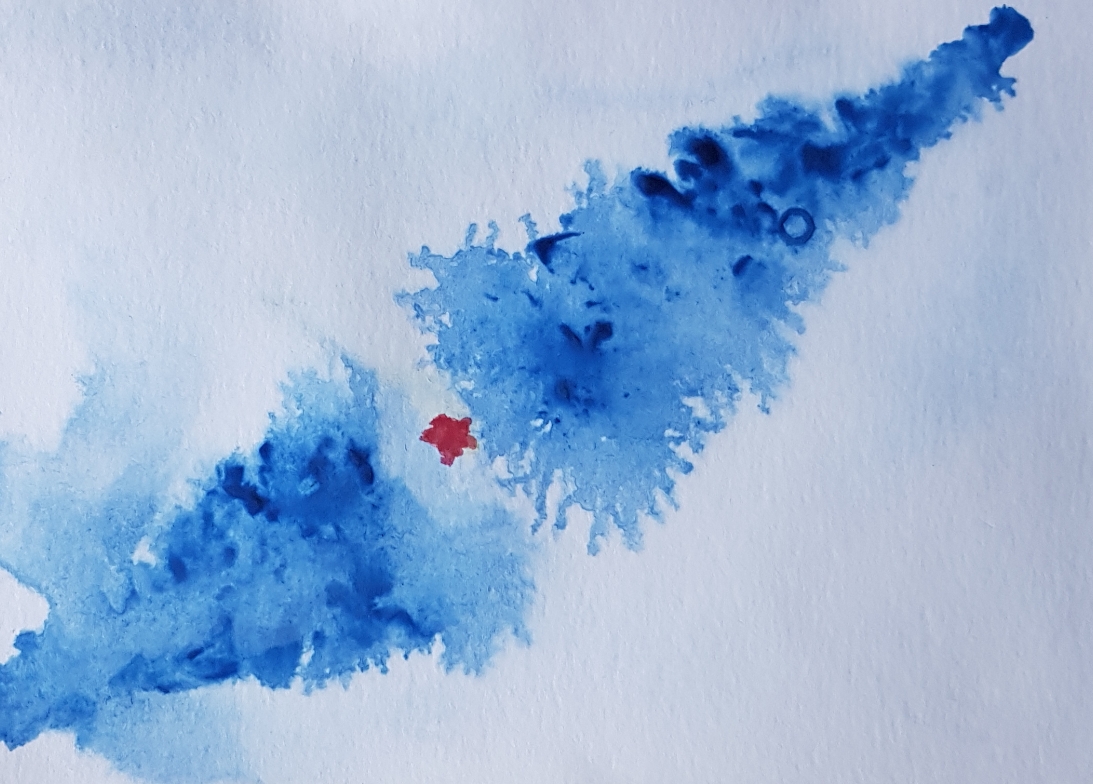
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
2–3 minutesDas Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Kurt Schumacher – Fallender
6–8 minutesDer Bildhauer Kurt Schumacher (1905-1942) schuf eine männliche Figur im Moment des Falls. (Im Stil des Expressionismus?) aufgerichtet und die Arme emporreißend, zeigt die Skulptur eine tiefe Wunde in Herzhöhe. Aus ihr strömt Blut, das sich wie ein stilisiertes Gewand um die Hüften legt, die Scham des nackten Körpers bedeckt und an den Beinen hinunterfließt.…


Schreibe einen Kommentar