Wenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken.
Drekkingarhylur: Ein Ort der Gewalt
Das isländische Wort „Drekkingarhylur“ bedeutet wörtlich „Ertränkungsbecken“. Bis ins 18. Jahrhundert wurden dort Frauen hingerichtet, die man der „Unzucht“ oder Hexerei bezichtigte. Männer, die ähnlicher Vergehen beschuldigt wurden, erhielten meist mildere Strafen – oft Enthauptung statt Ertränkung. Die Wahl der Hinrichtungsmethode war keine technische, sondern eine symbolische Entscheidung: Wasser als Reinigung, als Auslöschung, als Rückkehr ins Nichts.
Das Gedicht beschwört diesen Ort herauf mit einer Sprache, die zwischen dokumentarischer Nüchternheit und physischer Dringlichkeit schwankt. Wellen lecken am Grund der Schuld – aber wessen Schuld ist gemeint? Die der verurteilten Frauen oder die Schuld einer Gesellschaft, die ihre Gewalt an Frauenkörpern vollstreckt und „Reinigung“ nennt?
Agnes Bernauer: Von der Donau zur Torte
Eine weitere Frau taucht auf, über Jahrhunderte und Länder hinweg: Agnes Bernauer. Sie war die Geliebte des bayerischen Herzogs Albrecht III. und wurde 1435 in der Donau ertränkt – angeblich der Hexerei schuldig, tatsächlich politisch unbequem. Heute erinnert in Augsburg eine Torte an sie: die „Agnes-Bernauer-Torte“ aus Buttercreme und Baiser.
Das Gedicht nennt diese makabre Verwandlung beim Namen: „verewigt in buttercreme und baiser“. Was geschieht, wenn eine gewaltsame Hinrichtung zu lokalem Brauchtum wird, zu etwas Essbarem, Süßem, Harmlosem? Die Tote verschwindet hinter ihrer Verzuckerung. Ihre Geschichte wird geschmacklich.
Gegenwart: Das Mittelmeer als Massengrab
Dann vollzieht das Gedicht einen Zeitsprung nach vorn. Von den historischen Hexenverbrennungen und Ertränkungen zur „kenternden Mutter im Mittelmeer“. Zu Frauen, die auf der Flucht ertrinken, schwanger oder mit Kindern, während Europa wegschaut oder Rettungsschiffe kriminalisiert.
Die Verbindung ist brutal und präzise zugleich: Damals wie heute werden Frauenkörper zu Orten erklärt, an denen sich Schuld materialisiert – sei es die erfundene Schuld der Hexerei, sei es die konstruierte Schuld der „illegalen Migration“. Damals wie heute geschieht das Sterben im Wasser, und damals wie heute gibt es Zeugen, die zusehen oder wegsehen.
Das „Mädchen, das ins Wasser geht“ – ist es Suizid? Flucht? Bestrafung? Das Gedicht lässt die Grenzen verschwimmen und macht damit sichtbar, wie dünn die Linie zwischen erzwungenem und gewähltem Tod oft ist.
Den Mund über Wasser halten, den Mund halten
Das Gedicht endet mit einer sprachlichen Verdichtung, die körperlich schmerzt: „den mund über wasser zu halten, den mund zu halten“. Der Überlebenskampf im Wasser wird zur Metapher für das erzwungene Schweigen von Frauen. Wer spricht, geht unter. Wer schweigt, bleibt vielleicht am Leben – aber um welchen Preis?
Diese Doppelbewegung – physisches Ertrinken und symbolisches Verstummen – durchzieht die gesamte Geschichte der Gewalt an Frauen. Die verurteilten „Hexen“ durften sich nicht verteidigen. Agnes Bernauer hatte keine Stimme vor Gericht. Die Ertrunkenen im Mittelmeer werden zu Statistiken, zu Nummern ohne Namen, ohne Geschichten.
Widerstand – damals und heute
Die Frage bleibt: Welchen Widerstand gab es gegen diese Gewalt? Historisch ist er schwer zu greifen – wer gegen Hexenprozesse protestierte, geriet selbst unter Verdacht. Vereinzelt gab es Theologen und Juristen, die die Prozesse kritisierten, doch sie blieben Ausnahmen. Die meisten Gemeinden schwiegen oder beteiligten sich aktiv.
Heute gibt es feministische Bewegungen, die Femizide sichtbar machen, die Namen nennen, die Statistiken führen. Es gibt Initiativen zur Seenotrettung, juristische Kämpfe gegen Gewalt an Frauen, Gedenktage und Demonstrationen. Doch die Gewalt geht weiter – strukturell, alltäglich, tödlich.
Niemelas Gedicht vollzieht keinen Trost. Es zwingt zur Konfrontation: mit der Kontinuität der Gewalt über Jahrhunderte hinweg, mit unserer eigenen Rolle als Zeugen, mit der Frage, wie viel wir wirklich sehen wollen. Der Titel „Beckenendlage“ erweist sich als bittere Ironie – es geht nicht um die Rettung eines Kindes, sondern um die wiederholte Tötung von Frauen, die nie die Chance hatten, den Kopf über Wasser zu halten. Ich habe mich gefragt, ob es damals und welchen Widerstand es heute gegen Femizide gibt.
Dieses Gedicht habe ich in der WORTSCHAU Nr. 43 (Es hört nie auf) gelesen.
Porträt der Autorin Kathrin Niemela.
Titelfoto: Alexander Pixa
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
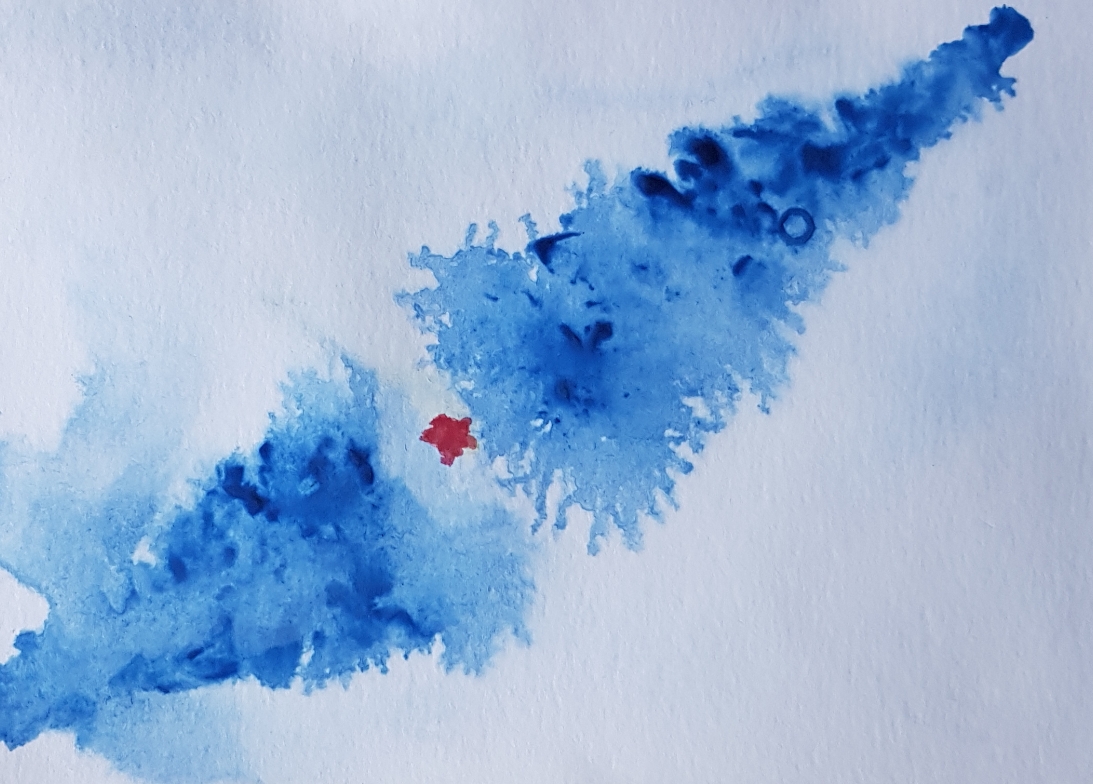
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
in Safiye Can – Poesie und Pandemie, AD, LektüreNotizen, Lyrik, Safiye Can – Einzeltäter, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDas Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Körper als Archiv
2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…
-

Annette Hagemann – MEINE ERBSCHAFT IST DIESE
Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
-

David Szalays „Was ein Mann ist“
2–3 MinutenDavid Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär…

