Annähernd gelesen | Was begrenzt einen Raum durch Schatten? Ist es die Abwesenheit von Licht oder gerade seine Anwesenheit, die den Schatten erst wirft? Wo erscheinen räumliche Begrenzungen? Sind es physische Räume (Fabrikhallen, Wohnungen, Gefängniszellen) oder metaphorische (kulturelle Zugehörigkeit, Geschlechterrollen, politische Zuordnungen)?
Frage zur Vertiefung: Wie verhält sich der Buchtitel zu den konkreten Räumen im Text? Gibt es Szenen, in denen Schatten explizit vorkommen?
Die Sprache Özdamars klingt anders
Es ist Deutsch, aber irgendwie fremd. Hier lohnt es sich, konkrete Beispiele rauszuschreiben. Welche Bilder wirken ungewohnt? Wo fehlen kleine Wörter wie „der“ oder „die“, wo klingen Sätze komisch gebaut?
Eine Überlegung: Macht diese fremde Art zu sprechen das Deutsche reicher oder ärmer? Oder ist das die falsche Frage? Vielleicht geht es weniger darum, ob es „besser“ wird, sondern darum, dass plötzlich sichtbar wird, wie sehr wir an bestimmte Formulierungen gewöhnt sind.
Weiterdenken: Sätze festhalten, die besonders anders klingen. Was genau ist das Fremde daran? Wie würde ich den Satz „normal“ formulieren? Was geht dann verloren?
Ist das hier eine Mischsprache aus Türkisch und Deutsch, oder ist es eher ein Deutsch, das türkisch denkt? Macht dieser Unterschied überhaupt einen Unterschied?
Die namenlose Erzählerin
Die Hauptfigur hat keinen Namen. Das könnte verschiedenes bedeuten: Steht sie stellvertretend für viele andere? Ist die Namenlosigkeit ein Zeichen dafür, dass sie ihre Identität verloren hat – oder gerade dafür, dass sie nicht festgelegt sein will?
Wie verändert sich diese Figur? Gibt es eine klassische Entwicklung von A nach B oder eher ein Sammeln von Erfahrungen? Die Protagonistin nimmt die Welt sehr direkt wahr, fast wie ein Kind – sehr körperlich, sehr bildhaft. Gleichzeitig erlebt sie krasse Gewalt und politische Radikalisierung.
Fragen: Wie passt das zusammen? Ist die poetische Art zu sehen ein Schutz gegen das Schlimme? Oder macht sie gerade diese Offenheit verletzlicher?
Gibt es Momente, in denen die Erzählerin sich selbst von außen sieht? Wo denkt sie über sich selbst nach?
Migration als Erfahrung
Der Roman erzählt keine typische Auswanderergeschichte mit Ankunft, Eingewöhnung und Heimischwerden. Stattdessen geht es hin und her, und beide Orte – Deutschland und die Türkei – werden immer fremder.
Das wirft die Frage auf: Ist Migration hier ein Ortswechsel oder ein Zustand? Die Protagonistin scheint nirgendwo richtig anzukommen, aber vielleicht ist gerade dieses Dazwischen ihr Platz?
Fragen: Wie werden die verschiedenen Orte beschrieben? Gibt es Unterschiede zwischen den deutschen und den türkischen Szenen? Oder verschwimmen die Grenzen?
Auffällig: Die Zeit im Roman springt hin und her. Wie hängt diese nicht-gerade-Erzählweise mit der Migrationserfahrung zusammen? Ist Zeit anders, wenn man zwischen zwei Welten lebt?
Körper, Geschlecht, Gewalt
Der Text ist sehr körperlich. Sex, Menstruation, Fabrikarbeit, Gewalt – all das wird direkt und detailliert beschrieben. Gleichzeitig geschieht das in dieser poetisch-fremden Sprache, die eine eigene Distanz schafft.
Fragen: Wie werden männliche und weibliche Körper gezeigt? Gibt es Unterschiede? Gewalt gegen Frauen zieht sich durch – sowohl sexuelle als auch politische Gewalt. Wie hängt das zusammen?
Weiterforschen: Özdamar hat lange am Theater gearbeitet. Ist der Körper hier auch eine Bühne? Gibt es Szenen, die wie Theater wirken?
Das politische Geschehen
Die 1960er und frühen 1970er Jahre in der Türkei waren geprägt von Studentenprotesten, linken Gruppen und staatlicher Unterdrückung. Der Militärputsch von 1971 ist ein Wendepunkt. Der Roman zeigt diese Ereignisse aus einer sehr persönlichen, bruchstückhaften Perspektive.
Wie viel muss ich über die historischen Hintergründe wissen? Setzt der Text Kenntnisse voraus oder erklärt er? Was passiert, wenn ich die Hintergründe nicht kenne?
Beobachtung: Politik erscheint oft körperlich – in Demos, Versammlungen, Folterszenen. Gibt es eine Verbindung zwischen politischer und geschlechtlicher Gewalt?
Rechercheidee: Den historischen Kontext genauer anschauen – was war los in der Türkei zwischen 1965 und 1975? Welche Rolle spielte die Linke? Was bedeutete der Militärputsch?
Theater als Ort der Verwandlung
Das Theater erscheint im Roman als Ort, wo sich etwas verändert. Die Protagonistin findet über die Theaterarbeit in Istanbul einen Weg zu künstlerischem Ausdruck und politischem Bewusstsein.
Alle Szenen, die mit Theater zu tun haben: Wie werden Proben, Aufführungen, die Theatergruppe beschrieben?
Eine Ebene tiefer: Özdamar selbst hat mit Brecht und Benno Besson gearbeitet. Gibt es Spuren von Brechts Theaterideen im Roman? Die Szenen-Struktur, die Verfremdung, die Distanz – sind das Theater-Techniken in Buchform?
Weiterdenken: Ist der ganze Roman vielleicht selbst theatral zu verstehen? Sind die kurzen Abschnitte wie Szenen einer Aufführung?
Was der Text alles mitbringt – Geschichten in der Geschichte
Beim Lesen fällt auf: Da tauchen immer wieder Lieder auf, Märchen, Sprichwörter, Geschichten. Manche klingen vertraut, andere komplett fremd. Die Erzählerin zitiert, singt, erinnert sich an Erzählungen ihrer Großmutter, an Theaterstücke, an Gedichte. Manchmal sind es nur einzelne Zeilen, manchmal ganze Episoden. Was erkenne ich? „Rotkäppchen“ kenne ich, aber wenn ein türkisches Volkslied auftaucht – keine Ahnung. Und das ist völlig okay.
Interessant: Wie fühlt sich das an, wenn ich etwas nicht verstehe? Macht es mich neugierig oder frustriert? Hole ich mein Handy raus und google, oder lese ich einfach weiter? Aber vielleicht ist gerade dieses Gefühl – „Hier verstehe ich nur die Hälfte“ – genau das, was die Erzählerin auch empfindet. In beiden Richtungen.
Eine Vermutung: Özdamar baut hier eine Welt, in der deutsche und türkische Kultur nicht sauber getrennt sind, sondern wild durcheinandergehen. Wie im echten Leben auch. Wir alle haben Referenzen, die andere nicht haben – egal wo wir herkommen.
Praktisch: Vielleicht einfach eine Liste machen: „Das kenne ich / Das kenne ich nicht“. Und dann schauen: Brauche ich wirklich Hintergrundwissen, um die Szene zu verstehen? Oft funktioniert sie auch ohne. Die Stimmung, die Musik der Worte, der Kontext – das trägt schon viel.
Wie ist der Roman gebaut?
Der Roman besteht aus kurzen Szenen, die aneinandergereiht sind. Manchmal mit klaren Zeitsprüngen, manchmal fließend. Erinnerungen mischen sich mit Gegenwart, Träume mit Realität.
Gibt es trotzdem eine Ordnung? Könnte ich eine Chronologie rekonstruieren? Oder ist gerade das Nicht-Rekonstruierbare wichtig?
Auffällig: Manche Bilder und Motive kommen immer wieder – wie Melodien, die sich wiederholen. Welche sind das? Was verändert sich, wenn sie wiederkehren?
Zur Form: Wie enden die einzelnen Abschnitte? Gibt es Cliffhanger, offene Enden, kehrt etwas zum Anfang zurück?
Der Schatten – eine Spur durch den Text
Zurück zum Titel. Der Schatten taucht bestimmt immer wieder auf – als Bild, als Vergleich, vielleicht auch ganz konkret.
Alle Stellen mit Schatten, Dunkelheit, Licht markieren. Gibt es ein Muster? Wann erscheinen Schatten?
Nachdenken: Was ist ein Schatten eigentlich? In manchen Geschichten ist er ein schlechteres Abbild. In anderen ist er ein Doppelgänger, ein verlorener Teil der Seele (wie bei Peter Schlemihl!). Und manchmal ist er Schutz vor zu viel Licht, vor zu viel Sichtbarkeit.
Verbindung: Emine Sevgi Özdamar hat den Adelbert-von-Chamisso-Preis bekommen. Peter Schlemihl verkauft seinen Schatten. Gibt es da eine Verbindung?
Fragen, die (vorerst) offen bleiben
- Wie viel von Özdamars eigenem Leben steckt im Text? Spielt das überhaupt eine Rolle? Was macht diesen Roman zu „Migrationsliteratur“? Ist das eine hilfreiche Schublade oder eine einengende? Für wen schreibt Özdamar? Für deutsche Leser? Für türkische? Für beide? Für keine von beiden? Wie verändert die fremde Sprache meine Art zu lesen? Lese ich langsamer? Aufmerksamer? Verwirrter? Gibt es im Roman auch Glück, Leichtigkeit, Humor? Oder überwiegt das Schwere? Verändert sich die Sprache im Laufe des Romans?
Was danach kommt
Nach der Lektüre wäre es spannend, die anderen Bücher Özdamars zu lesen – die Fortsetzungen Die Brücke vom Goldenen Horn und Seltsame Sterne starren zur Erde. Bilden sie eine Reihe? Entwickelt sich die Sprache weiter?
Außerdem: Andere Autor*innen lesen, die auch zwischen Sprachen und Kulturen schreiben – Yoko Tawada, Rafik Schami, Feridun Zaimoglu. Gibt es Gemeinsamkeiten oder ist jede Stimme ganz eigen?
Titelfoto: Roman Kogomachenko
-

Serhij Zhadan | Anarchy in the UKR
in Roman4–5 Minuten»Vergiss die Politik, lies keine Zeitung, geh nicht ins Netz, verweigere deine Stimme[…]« So beginnt der »Linke Marsch«, ein Kapitel aus Serhij Zhadans zweitem Prosaband, dem ein Song der Sex Pistols, Anarchy in the UKR, als Motto dient. Zhadan ist dabei, sich zur stärksten Stimme der jungen ukrainischen Literatur zu entwickeln – und zum Antipoden…
-

Otto F. Walter – Wie wird Beton zu Gras
3–5 MinutenOtto F. Walters Roman Wie wird Beton zu Gras? (erstmals 1979 erschienen, hier in der Rororo-Taschenbuchausgabe von 1988 vorliegend) wird zur ökologischen Literaturbewegung der späten 1970er Jahre gezählt. Im Zentrum steht der Stadtplaner Viktor B., ein zerrissener Antiheld, der täglich an der Transformation natürlicher Landschaften in betonierte Stadt- und Industrieflächen mitwirkt. Sein Beruf steht im fundamentalen Konflikt mit seinem wachsenden…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
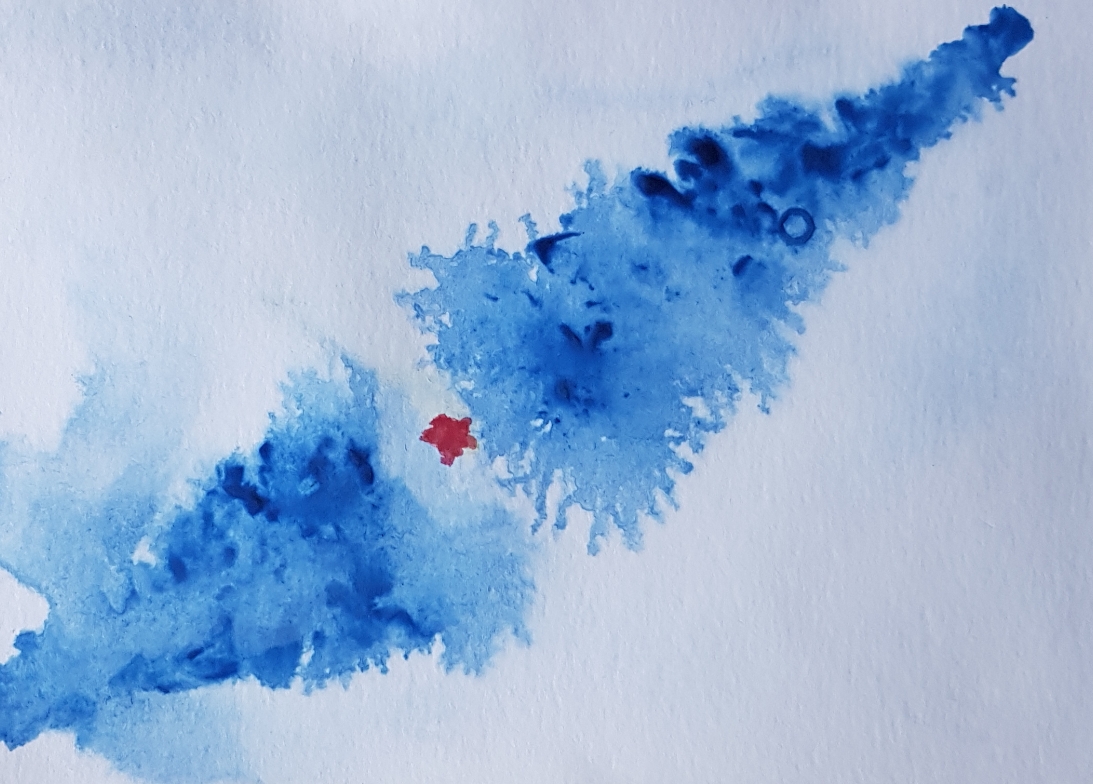
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
in Safiye Can – Poesie und Pandemie, AD, LektüreNotizen, Lyrik, Safiye Can – Einzeltäter, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDas Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Körper als Archiv
2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…
-

Annette Hagemann – MEINE ERBSCHAFT IST DIESE
Annette Hagemanns Gedicht „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ setzt sich behutsam mit dem ambivalenten Erbe familialer Prägung auseinander. Die scheinbar willkürlichen Relikte, die das lyrische Ich von den Eltern übernimmt – die spezifische Röte der Wangen der Mutter, eine deformierte Jazzplatte aus New York, ein unscheinbarer Koi des Vaters –, erscheinen zunächst als marginale Alltagsfragmente. Doch…
-

Das Päckchen – Franz Hohler
3–4 MinutenFranz Hohler, der Schweizer Meister der leisen Töne, entführt uns in seinem 2017 erschienenen Roman Das Päckchen (Luchterhand Literaturverlag) auf eine Reise durch Zeit und Verantwortung. Die Geschichte ist mehr als nur eine spannende Quest (So bezeichnet von der hiesigen Bibliothekarin im Schulzentrum) – es ist eine Parabel über kulturelles Erbe, historische Schuld und die unerwartete Macht kleiner…
-

Besuch aus der Vergangenheit – Renate Welsh
2–3 MinutenRenate Welsh’s Roman „Besuch aus der Vergangenheit“ (2002) setzt sich mit den langen Schatten der Vergangenheit und den Auswirkungen von Krieg und Verfolgung auf das Leben nachfolgender Generationen auseinander. Das Buch ist ein gutes Beispiel für ihre Fähigkeit, historische Themen mit persönlichen Schicksalen zu verweben und dabei universelle Fragen von Schuld, Erinnerung und Identität zu stellen. Die…
-

Widerstand gegen Femizide: Von historischen Gegenstimmen zu aktuellen Bewegungen
2–4 MinutenEin erster – zugegeben oberflächlicher – Überblick. Ausgangspunkt ist das Gedicht BECKENENDLAGE von Kathrin Niemela. Drekkingarhylur, Island Zwischen 1618-1749 wurden mindestens 18 Frauen im Drekkingarhylur (Ertränkungsbecken) in Þingvellir hingerichtet. Während Frauen das Ertrinken erwartete, wurden Männer für ähnliche Verbrechen enthauptet – ein deutlicher Hinweis auf geschlechtsspezifische Bestrafung. Frauen wurden wegen Ehebruch oder unehelicher Kinder angeklagt,…
-

David Szalays „Was ein Mann ist“
2–3 MinutenDavid Szalay erzählt von Männern in der Krise – und vom Menschsein selbst | In neun Geschichten begleitet der britisch-kanadische Autor David Szalay (*1974) Männer durch Europa und durchs Leben. Sein für den Booker Prize 2016 nominiertes Buch „Was ein Mann ist“ beginnt bei einem siebzehnjährigen Rucksacktouristen auf Zypern und endet bei einem sterbenden Millionär…
-
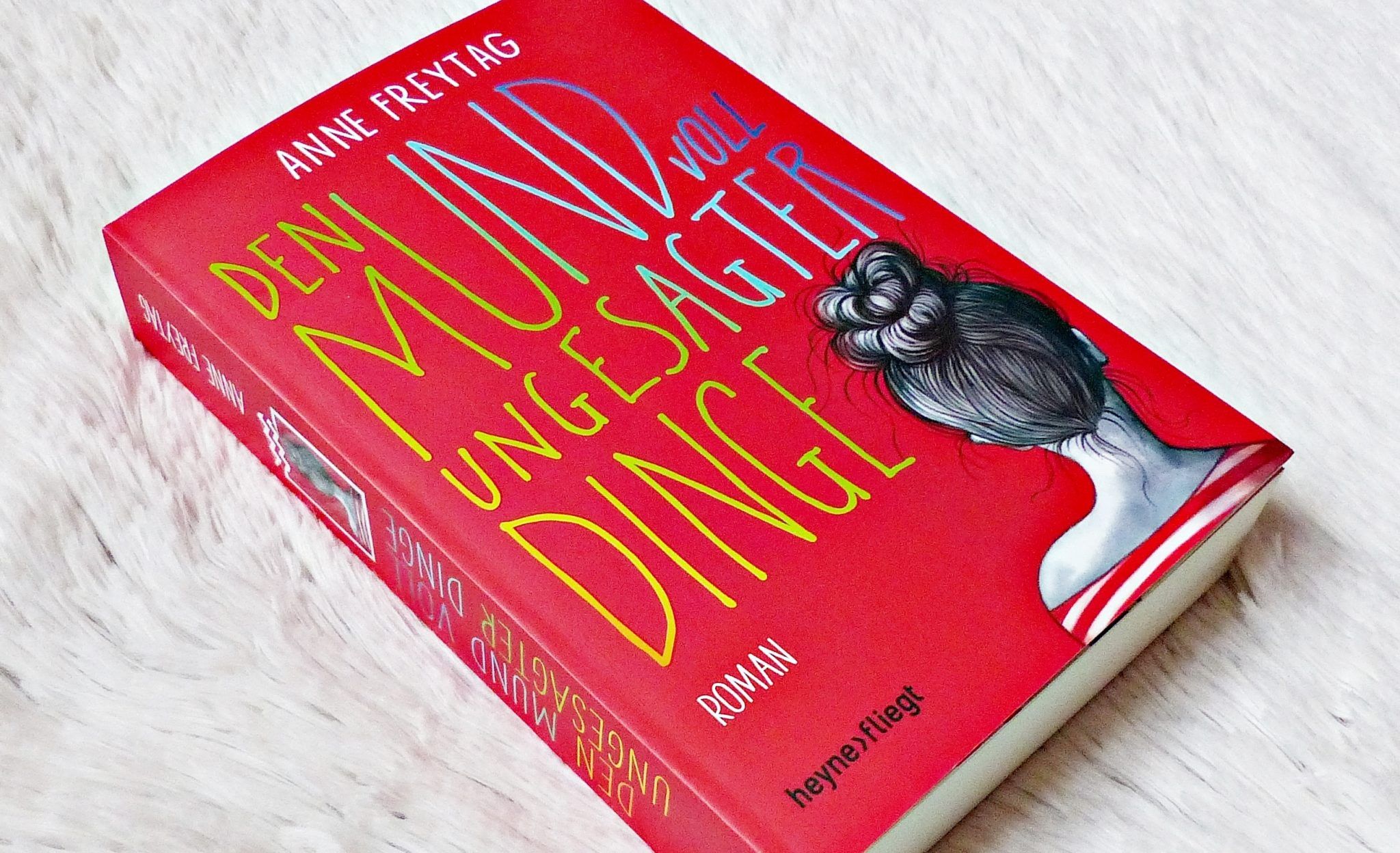
Sophie lernt zu lieben
in Roman4–5 MinutenDen Mund voll ungesagter Dinge | Anne Freytag Die Geschichte ist kurz erzählt: Sophie, 17, kurz vor dem Abitur, lebt bei ihrem Vater. Einem Arzt. Der hat eine neue Lebensgefährtin, die in München lebt. Als ihr Vater im Alleingang beschließt zu dieser zu ziehen, muss Sophie mit. Ihre Mutter hatte sich sehr früh von der…
