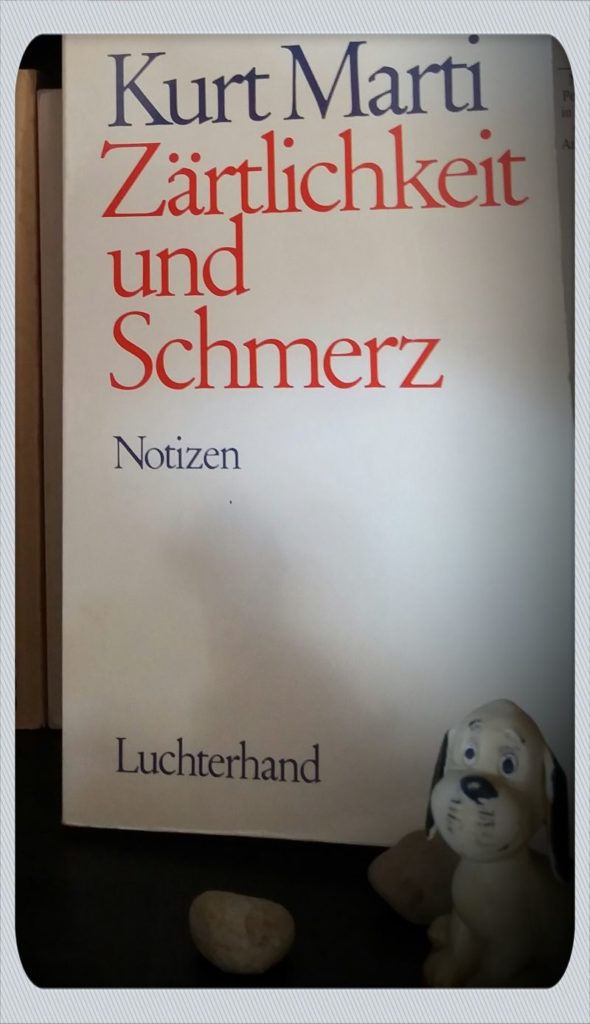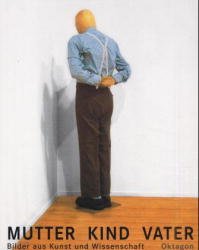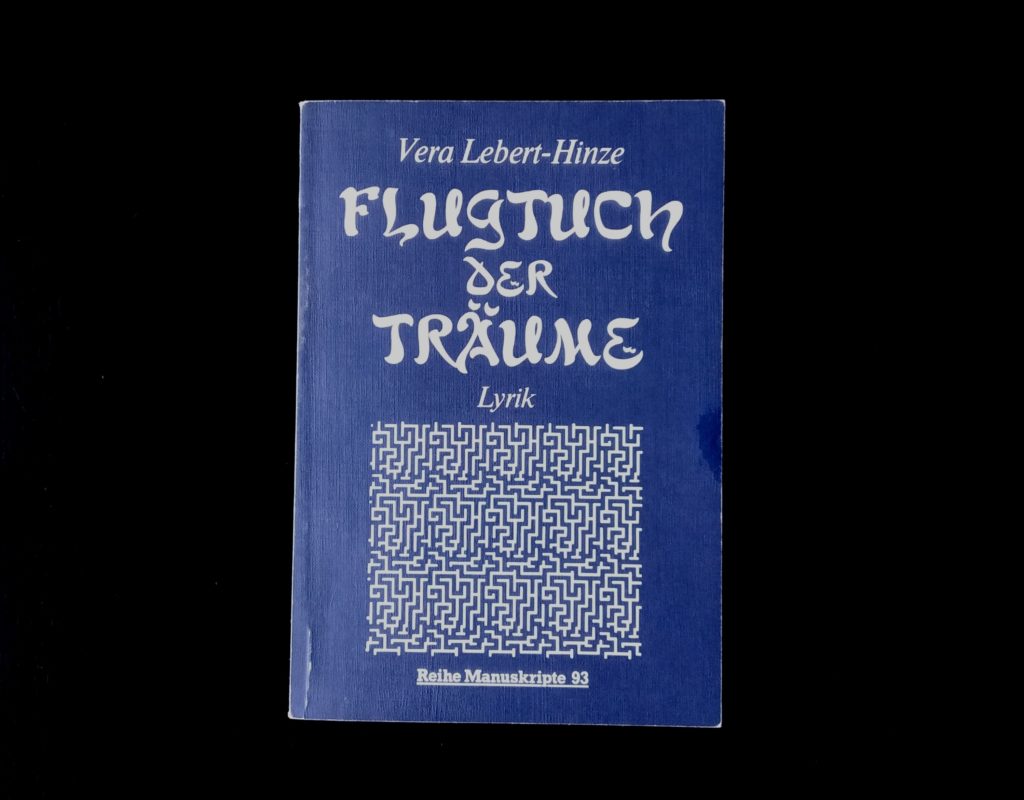Die Amerikaner sind bekanntlich sehr neugierig.Seit Jahren schreibe ich für ein Kunstblatt jenseits des Ozeans Ausstellungsberichte, Kunstbriefe und alles, was sonst dazu gehört, die wissensdurstige Seele des »gebildeten Laien«, der sich für Kunst interessiert, einmal im Monat zu sättigen.Jetzt ist das nicht mehr sensationell genug. Man will mehr – anderes.
Die Redaktion verlangte zuerst »Intimes aus dem Leben der großen Künstler« – modern Intimes natürlich – und neuerdings soll ich auch noch interessante Details aus dem Leben der Modelle und ihrem Verhältnis zur Künstlerwelt bringen.
Mir ist alles recht. Ich bin ein zufriedener Mensch und möchte auch andere zufrieden stellen. Nach längerem Bemühen ist es mir geglückt, das Notizbuch eines »vielversprechenden Genies« in die Hände zu bekommen. Die darin verzeichnete Modelliste sollte mir als Richtschnur meiner demnächstigen Recherchen dienen.
Aber nun die richtige Auswahl zu treffen:
1. Walburga Stümpfl, als Giftmischerin beliebt, sehr grün im Ton.
2. Crescenz – Nachname fehlt im Notizbuch – stilvoller Rokokoakt.
3. Anna Huber, sehnsüchtiges Profil, sehr geeignet zum Stilisieren.
4. Adalbert Apfelkammer, Athlet und Ringkämpfer, kolossaler Bizeps, unglaubliche Deltamuskeln.
5. Marie Mayr, famose Zierleiste für die »Jugend«.
6. Clemens Brückner, hinterlistiger Priester etc.
Du lieber Gott, die Auswahl ist einfach überwältigend reich, da kann’s nicht fehlen.
Tagelang stieg ich treppauf, treppab. Modelle interviewen ist keine Kleinigkeit, sie sind nie zu Hause. Ich begab mich also auf den Rat eines erfahrenen Freundes zu einer Vormittagsstunde an die Stufen der Akademie. Aber ich hatte wieder Pech. Die Stunde war entschieden unglücklich gewählt. Es war nur ein schwerhöriger alter Mann da und einige zerlumpte Italienerweiber. Den letzteren schien es sehr am Herzen zu liegen, von mir interviewt zu werden, aber da sich meine Kenntnisse der italienischen Sprache auf: »Si Signora« und »Non capisco« beschränken, konnten wir zu keinem befriedigenden Resultat gelangen.
Schon wollte ich verzagt und um eine Illusion ärmer dem Tempel der Kunst den Rücken wenden, als ich auf einen großen, hageren Mann aufmerksam wurde, der in einen flatternden Havelock eingehüllt mit majestätischem Schritt die Treppe herauf kam.
Ich hielt ihn erst für einen Königlichen Professor, so gebieterisch war sein Auftreten, so lang und wallend sein Haupthaar.
Als er sich aber schließlich neben den Italienerinnen auf die Balustrade niederließ, fasste ich Mut. »Sie stehen Modell?«
»Jawohl, jewiss, ich bin der Christus – braucht der Herr –«
»Wie heißen Sie?«
»Friedrich Wilhelm Köppke – wenn der Herr mit Kostüm wünscht« –
Er machte mich auf eine große Pappschachtel aufmerksam, die er unter dem Arm trug – »brauner Mantel, dunkelrotes Unterkleid« –
»Sie sind nicht von hier?«
»Ne, ich bin aus Berlin, mit Spreewasser jetauft, aber ich bin schon lange hier.«
Er zerrte wieder an der Schachtel.
»Lassen Sie nur, lassen Sie nur – wo haben Sie das Kostüm denn her?«
»Das hab‘ ich mir auf der Auer Dult jekauft, sechs Mark hat es jekostet, aber schön ist es auch.« –
Er riß die Schachtel auf und wollte den Havelock abwerfen.
»Warten Sie, warten Sie, es pressiert nicht. – Wie lange sind Sie schon Modell?«
»So an die sechs, sieben Jahre.« –
»Und was trieben Sie vordem?« –
»Da hab ich ’ne Jeschäft jehabt –«
»Was denn für ein Geschäft«, das Vorleben meines Christus war doch jedenfalls nicht ohne Interesse.
»Na, wissen Sie, ich bin so in die Wirtshäuser rumjegangen und hab‘ mit wollne Hemden hausiert, aber das bringt –«
»Und wie kam es, dass Sie Modell wurden?«
»Das Jeschäft ist nich mehr recht jejangen und dann mit die langen Haare hab‘ ich mir jedacht –«
»Trugen Sie denn das Haar früher schon so lang?« Mit Bewunderung betrachtete ich seine Mähne.
»Ja, wissen Sie, ich hab‘ das Reissen jekriegt von den vielen Zug und da hab‘ ich mir das Haar wachsen jelassen und dann haben mir die Freunde jesagt: laß dich doch malen, Fritze, du hast ja den schönsten Christuskopp, daß der Herrgott seine Freude dran haben könnte. So was suchen die Herrn Kunstmaler jrade.«
»Und da wurden Sie Christusmodell?«
»Ja, da hab‘ ich die wollnen Hemden Hemden sein jelassen und bin in die Ateliers rumjejangen und bin ein sehr beliebter Christuskopf jeworden.«
»Sind Sie denn hier das einzige Christusmodell?«
»O ne, jewiss nicht. Seit der Uhde anjefangen hat, seine biblischen Bilder zu malen, da haben se noch einen modernen Christus uffjeangelt, der hat so langes straffes Haar und so ein schlichtes Jesicht. Das ist der Aois Brüllmayr, der hat mir ne janz jefährliche Konkurrenz jemacht. Überall muß Konkurrenz sein heutzutage.«
»Das Modellstehen muß doch recht anstrengend sein, was?«
»Na, davon könnte ich Sie ein Lied singen. Anstrengend ist die Jeschichte, aber es rentiert sich. Da hab‘ ich zuweilen ans Kreuz müssen, mit so ’n Jerüst, wissen Sie. Mit ausjebreiteten Armen und die Ojen verdrehen, jehört allens dazu von wegen den schmerzlichen Ausdruck. Aber jetzt bin ich zu alt und zu steif dazu. Es jeht nich mehr so. Da steh ich nur Kopp und es wird ein anderer jekreuzigt.«
»Haben Sie denn immer Beschäftigung? Es wird doch nicht alle Tage ein Christus gemalt.«
»Na, da kennt sich der Herr aber schlecht aus, da sind Sie jewiss kein Kunstmaler. Heutzutage muß doch jeder ’n Christus jemalt haben. Das is jetzt jrade die neuste Mode, mit das Biblische. Ne Zeit lang, so vor ’n paar Jahren, da war’s schlimm, da hat niemand mehr ’nen Christus jemalt. Da haben sie alle Ölein-Air jemacht. Da war nischt zu haben für unsereinen. Lauter jrüne Wiesen und lila Bäume und die Menschen dadrin alle nackich. Das war ’ne schlimme Zeit, da hab‘ ich nur Kopp jestanden in die Schulen und mit ’n Christus war jarnischt.« »Na, und jetzt? Die moderne Richtung?« – »O jetzt is viel besser jeworden. Symbolistisch muß sin, sagen die Herren. Das is Mode. Und Mode is in der Kunst jrad‘ so gut wie sonst im Leben. Jetzt machen sie Ihnen ’nen altdeutschen Christus, wie ’n die alten Meister jemalt haben, denn das sind doch immer die jrößten jewesen, sagen sie. Da machen sie Ihnen die Haare janz lang und jrad‘ wie Schlangen und die Dornenkrone janz spitz und was die janz Neusten sind in der Malerei, die machen ’nen stilisierten Christus, da ziehen sie Ihnen det Jesicht in die Länge und die Dornenkrone kommt vom Kopp und auf beiden Seiten wird auch in die Länge jezogen und –«
Mich befiel eine stille Furcht, Christus möchte mich auch noch über das Wesen der Renaissance oder des Rokoko belehren, und ich unterbrach ihn:
»Sind Sie denn schon oft zu großen Bildern gestanden?«
»Na und ob – det will ich meinen. Ich häng‘ Ihnen schon in alle möglichen Jalerien und Pinakotheken. Einmal am Kreuz mit die beiden Schächer. Das is sehr schön jewesen. Was die beiden Schächer waren, das sind ein paar Athleten jewesen. Die haben Sie gehangen, det es eine Freude war. Und dann mit der Magdalene. ›Christus und die jroße Sünderin‹ hat’s geheißen.«
»Wer war denn die Magdalena?«
»Das is die Josephine Zimmerer jewesen, oder wie sie heißt. Das is ein Mädel jewesen. Immer hat sie ihre Jeschichten mit den Malern jehabt. So janz rotes Haar hat sie. Ich kann ’s nich so schön finden, aber den Herren hat ’s jefallen und über Jeschmack läßt sich nicht streiten. ›Der reine Tizian‹ haben sie immer jesagt.« Allen Respekt. Christus imponierte mir immer mehr.
»Sie verstehen wohl bald eben soviel von der Kunst wie die Maler selbst, Christus?« »Ja, wenn ich die Kunst nich hätt‘. Ich schwärme für alles, was Kunst ist. Das is meine jrößte Freude. Und Jeld bringt’s auch ein.«
»Was verdienen Sie denn so im Durchschnitt am Tage?«
»Na, sehen Sie, das schwankt so hin und her. Was die jroßen Meister sind, die berühmten, die zahlen mehr. Und dann kommt’s auf die Stellung an, fürs Kreuzigen hat’s eine Mark jejeben die Stunde. Jott Strambach, das sind schöne Zeiten jewesen! Aber für jewöhnlich jiebt’s nur 50 Pfennige für die Stunde, wenn man bloß Kopp steht.« Du mein Gott, dacht‘ ich, während Christus sich noch des Näheren über seine Lohnverhältnisse verbreitete, viel, viel »Interessantes« ist aus dem Manne nicht herauszukriegen. Was soll ich nur in meinen Artikel hineinschreiben? Und dazu macht mich sein Dialekt nervös – ich hatt‘ auf irgendeinen biederen Bajuwaren gehofft, dafür interessiert man sich doch heutzutage viel mehr. Es klingt viel origineller. – Ich musste entschieden noch etwas »Intimes« herausbringen.
»Christus«, sagte ich deshalb eindringlich, »Sie wissen wohl recht viel von dem Leben der Künstler, so von dem Privatleben. – Als Modell müssen Sie doch recht oft Gelegenheit haben, hinter die Kulisse zu schauen.«
»Na«, sagt Christus mit großem Nachdruck, »wir Modelle, wir sehen alles, wir hören alles, wir sind bei allem dabei, aber wissen tun wir jarnischt, wir sind diskret. Ich könnt‘ Ihnen da Jeschichten erzählen – aber wir Modelle müssen diskret sein, sonst is jarnischt mehr, sonst werden wir abjeschafft.«
»Na ja, aber wissen Sie, Christus, ich bin fremd hier. Ich gehe in ein paar Tagen wieder fort. Mir können Sie schon etwas erzählen. Ich bin Journalist, da muss man auch oft diskret sein. – – Es muss doch oft recht fidel hergehen unter den Künstlern, was?«
»Na ja, fidel, det will ich Sie jlauben. Da liebt man sich und wird jeliebt, det is die reine Wonne und Herrlichkeit.«
Mein Christus machte ein ganz pfiffiges Gesicht und zwinkert mit den Augen. Mich ärgerte nur, dass er so zugeknöpft war. Ich hätte so gerne etwas Pikantes erfahren.
Noch einen Versuch wollt‘ ich machen. So ein Liebesroman zwischen einem weltbekannten Genie und der rothaarigen Tizian- Magdalena – famoser Mittelpunkt für meinen Artikel: ›Modelle und Künstler, Interieurs aus der Münchner Moderne.‹ Das Herz wurde mir ganz groß.
»Na sagen Sie mal, Christus – Sie haben mir vorhin von der Magdalena erzählt, die den Malern so gefällt, die wird wohl viel geliebt haben, was?«
Ich schlug meinen jovialsten Ton an, aber Christus blieb ungerührt. –
»Det hab‘ ich Sie doch schon jesagt. Jetzt hab‘ ich sie schon lange nicht mehr jesehen, aber früher, als ich mal mit ihr jestanden bin. Da hab‘ ich alle ihre Jeheimnisse jewußt.« – Er zwinkerte wieder verständnisvoll – und fuhr fort:
»Ich hab‘ ihr damals noch sozusagen zum moralischen Halt jedient. Manchesmal hab‘ ich ihr ins Jewissen jeredt‘. Magdalena, hab‘ ich ihr jesagt, Jugend hat keine Tugend, des weess ich auch. Ich bin auch mal jung jewesen und habe keine Tugend jehabt, aber jetzt bin ich Familienvater und kenne die Welt. Mach’s nicht zu schlimm, Magdalena, sonst kommste noch unter den Leierkasten. Aber sie hat es immer sehr leicht jenommen. ›Schaugt’s den Christus an‹, hat sie jesagt und dann haben sie alle jelacht. Na, ich sage Ihnen.« –
»Mit wem hat sie denn?«
»Na, mit allen hat sie Jeschichten jemacht. Sie hat eben für ’ne Schönheit jejolten, aber was die Herren waren, ›Christus‹, haben sie jesagt, ›wir wissen, daß Sie diskret sind‹. – Na, diskret muss man sein.« –
Er lächelte bedeutungsvoll und zog seine Visitenkarte hervor, die er mir feierlich überreichte: »Friedrich Wilhelm Köppke, Katzmaierstraße 16, IV«, darunter stand geschrieben: »Im Besitz eines neuen Christus- Kostüms, dunkelrotes Unterkleid, brauner Mantel, Sandalen etc. empfehle mich den Herren Kunstmalern als Christusmodell.« »Eine schöne Handschrift haben Sie, Christus«, sagte ich bewundernd.
»Das hat meine Jette geschrieben, was meine Älteste is«, sagte er, »die steht auch schon Modell, aber ich laß sie nur Kopp stehen, ›wenn man Familienvater ist‹ –.«
Ich sah auf meine Uhr und verabschiedete mich von Christus, indem ich ihm einen Zwanziger in die Hand drückte. Er steckte denselben voll Würde dankend ein und hüllte sich fester in seinen Havelock, denn es war kalt.
Ich entfernte mich langsam und einigermaßen deprimiert. Mein Artikel war an der starren Moral und unbeugsamen Diskretion des Christus gescheitert.
Quelle: Franziska zu Reventlow | Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel
Herausgeber | Else Reventlow
Titelbild: Edward Okuń, Chimäre || Farblithographie, 1903