Eine Begegnung mit Virginia Woolf über Umwege – Ausgangspunkt: Eine Lithographie von Wolfgang Mattheuer
Manchmal führen merkwürdige Wege zu einem Text. In meinem Fall begann es mit einer Lithographie des DDR-Künstlers Wolfgang Mattheuer in dem Band „Äußerungen“. Zu finden ist der Druck vor dem ersten Texteintrag, trägt den Titel „Abendliches Studium“ und stammt aus dem Jahr 1958. Die Darstellung ist schlicht: Eine Frau sitzt an einem Tisch und blättert in einem Buch – so jedenfalls sehe ich es.
Über diese Druckgraphik selbst habe ich bisher nichts weiter herausfinden können. Was hatte er im Sinn, als er diese Szene schuf? Welche Bedeutung sollte das abendliche Studium dieser Frau haben – in der DDR der späten 1950er Jahre, in einer Zeit des Aufbaus, der ideologischen Auseinandersetzungen, der neuen gesellschaftlichen Rollen?
Ich weiß es nicht. Und gerade weil mir der ursprüngliche Kontext verborgen bleibt, erlaube ich mir, frei zu assoziieren.
Der Sprung zu Virginia Woolf
Von dieser lesenden, studierenden Frau war es gedanklich nicht weit zu Virginia Woolfs berühmtem Essay „Ein Zimmer für sich allein“ von 1929. Woolf stellt darin eine ebenso einfache wie radikale Forderung auf: Eine Frau brauche Geld und ein eigenes Zimmer, wenn sie schreiben wolle. Es geht ihr um die materiellen Voraussetzungen geistiger Arbeit, um Raum, Zeit und ökonomische Unabhängigkeit.
In Mattheuers Lithographie sitzt eine Frau für sich, vertieft in ein Buch. Sie hat offenbar diesen Moment für sich – einen Raum, eine Abendstunde, die Möglichkeit zu studieren. Natürlich hinkt der Vergleich: Mattheuer arbeitete in einem völlig anderen historischen und politischen Kontext als Woolf. Die DDR proklamierte die Gleichberechtigung der Frau, förderte Bildung und Berufstätigkeit von Frauen – wenn auch unter anderen Vorzeichen als die feministische Bewegung im Westen. Trotzdem bleibt die Frage: Hatte diese Frau wirklich ein „eigenes Zimmer“ im Woolfschen Sinne? Oder war es ein Studium im Dienst anderer Ziele, eingebettet in kollektive Strukturen?
Ich maße mir keine Antwort an. Aber die Lithographie hat mich zu Woolfs Text geführt.
Eine Lesung in Lüneburg
Parallel zu meiner Beschäftigung mit Woolfs Essay erinnerte ich mich an eine Lesung mit Antje Rávik Strubel im Literaturhaus Lüneburg. Strubel, selbst Schriftstellerin und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, erzählte damals von ihrer Arbeit an Woolf-Texten. Es war das erste Mal, dass ich davon hörte – dass sie 2019 „Ein Zimmer für sich allein“ neu ins Deutsche übersetzt hatte, erschienen beim Kampa Verlag.
Strubel sprach darüber, wie sie versuchte, Woolfs Ton zu treffen: die Leichtigkeit, den Witz, die Ironie, mit der Woolf patriarchale Strukturen unterläuft. Woolf schreibt keineswegs trocken oder akademisch, sondern literarisch, mit Eleganz und Raffinesse. Ältere Übersetzungen hatten diese Qualität teilweise verloren, waren zu ernst, zu bildungsbürgerlich geworden. Strubel wollte den Text als das lesbar machen, was er ist: ein Essay, der zugleich Kunstwerk ist.
Diese Lesung hatte sich mir eingeprägt, ohne dass ich damals schon den Essay selbst gelesen hätte. Nun, beim Nachdenken über Mattheuers Lithographie, fiel sie mir wieder ein.
Freie Assoziationen
Ich bin mir bewusst, dass Wolfgang Mattheuer 1958 wahrscheinlich etwas ganz anderes im Sinn hatte, als er seine Lithographie schuf. Vielleicht ging es um Bildung im sozialistischen Staat, um den neuen Menschen, um die arbeitende Frau, die sich weiterbildet. Vielleicht war es eine ganz persönliche Szene ohne programmatischen Anspruch. Vielleicht etwas Drittes.
Da mir dieser ursprüngliche Zusammenhang bisher verborgen geblieben ist, nehme ich mir die Freiheit, das Bild in einen anderen Kontext zu stellen: in den von Woolfs Essay. Die lesende, studierende Frau am Tisch – hat sie ein Zimmer für sich allein? Hat sie Zeit, die ihr gehört? Welche Bücher liest sie, und für wen oder für was liest sie?
Diese Fragen stellte Woolf 1929. Sie stellen sich noch heute. Und sie stellten sich vermutlich auch 1958 in der DDR, wenn auch unter völlig anderen Bedingungen und mit anderen Antworten.
Drei Fäden zusammengeführt
So sind drei Stränge zusammengekommen: eine Lithographie aus der frühen DDR, ein feministischer Essay aus dem England der Zwischenkriegszeit und eine zeitgenössische Neuübersetzung, vorgestellt in einer Lesung in Norddeutschland. Sie gehören nicht natürlicherweise zusammen. Aber manchmal entstehen gerade aus solchen zufälligen Verbindungen interessante Gedanken.
Mattheuers „Abendliches Studium“ zeigt eine Frau mit einem Buch. Virginia Woolf fragt danach, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Frauen nicht nur lesen, sondern auch schreiben können. Antje Rávik Strubel hat diese Frage ins Heute übersetzt – sprachlich und inhaltlich. Und ich betrachte ein altes Bild und denke über Räume nach, über Zeit, über die Möglichkeit, für sich zu sein.
Was Mattheuer wirklich sagen wollte, weiß ich nicht. Aber sein Bild hat mich auf einen Weg gebracht, der zu Woolf führte. Und das ist vielleicht mehr, als man von einer Lithographie erwarten kann. – Randbemerkung: Eine Reproduktion des Bildes ist mir bisher nur im genannten Band ‚Äußerungen‘ begegnet, nicht aber frei zugänglich im Internet.
Bibliografische Angaben „meiner“ Ausgabe
Ein Zimmer für sich allein
Virginia Woolf | Antje Rávik Strubel Übersetzung
ISBN 978-3-311-22003-9
Kampa Verlag
Reihe Gatsby
Erschienen 2019
192 Seiten
-

Jane Wels‘ Sandrine
3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…
-

Aus dem Reifen treten – Lyrik von Nathalie Schmid
5–7 MinutenAbstammung bedeutet nicht nurvon Männern über Männer zu Männern.Abstammung bedeutet auchmeine Gewaltgegen mich eine Hetze.Abstammung: Immer nochaus Sternenstaub gemacht. Immer nochsehr komplex. Immer nochauf die Spur kommend.Abstammung im Sinne von:Ring um den Hals eher auf Schulterhöheein loser Reifen. Ein Reifenden man fallen lassen kannaus ihm hinaustreten und sagen:Das ist mein Blick. Das ist meine Zeit.Das…
-

BECKENENDLAGE – Kathrin Niemela
3–4 MinutenWenn Wasser zur Hinrichtungsstätte wird – Eine Annäherung an das Gedicht „Beckenendlage“ von Kathrin Niemela | Der Titel klingt nach Krankenhaus, nach Ultraschall und besorgten Hebammen: „Beckenendlage“ – ein geburtshilflicher Fachbegriff für eine riskante Position des Kindes im Mutterleib. Doch Kathrin Niemelas Gedicht führt nicht in den Kreißsaal. Es führt ins Wasser. Ins Ertränkungsbecken. Drekkingarhylur:…
-

Ursula Mattheuer-Neustädt und Wolfgang Mattheuer Stiftung
1–2 MinutenDie Ursula Mattheuer-Neustädt und Wolfgang Mattheuer Stiftung wurde 2006 von der Künstlerin Ursula Mattheuer-Neustädt ins Leben gerufen, um das künstlerische Erbe ihres verstorbenen Ehemannes, des renommierten Malers und Grafikers Wolfgang Mattheuer, zu bewahren. Die Stiftung hat ihren Sitz in Leipzig, im ehemaligen Wohn- und Arbeitshaus des Künstlerpaares in der Hauptmannstraße 1. Ziel der Stiftung ist…
-
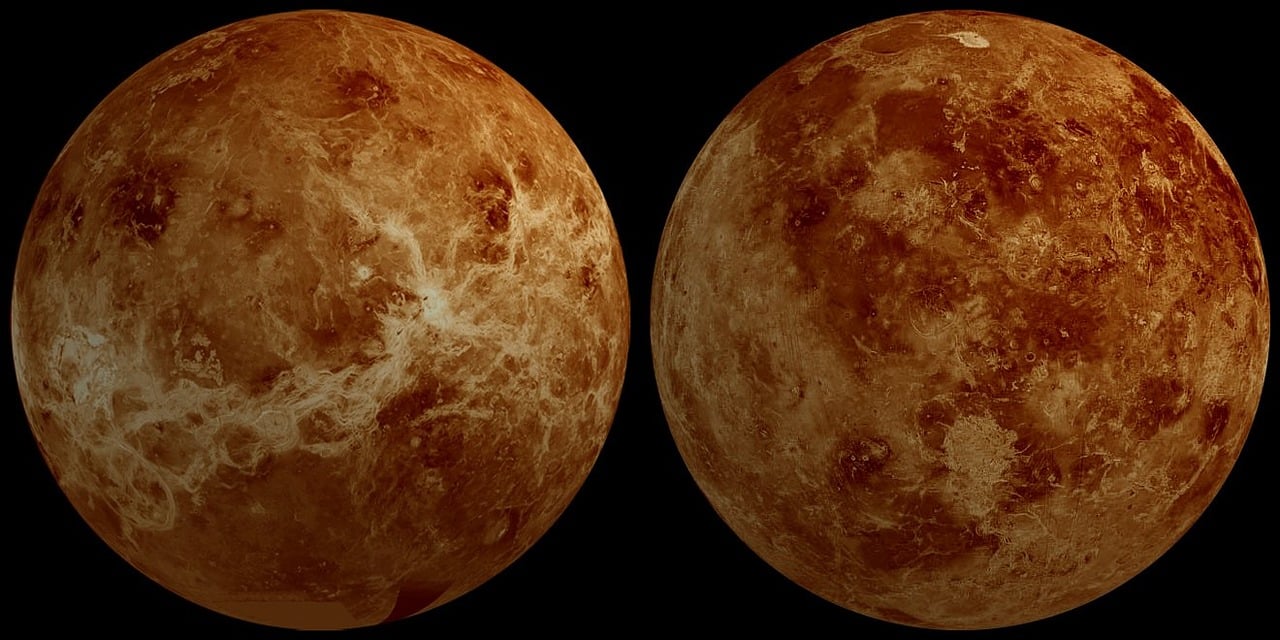
Safiye Can – Aussicht auf Leben und Gleichberechtigung
2–3 MinutenDas Gedicht im Wortlaut (gekürzt):„Frauen / kauft von Frauen / lest von Frauen // […] / bildet eine Faust / werdet laut! // […] / Die Welt muss lila werden.“ Entnommen dem Lyrikband Poesie und PANDEMIE von Safiya Can | Wallstein Verlag 2021 Was steht da?Die Autorin richtet sich in direkter Ansprache an Frauen. In…
-

Ille Chamier – Lied 76
2–3 MinutenEine Annäherung | Ille Chamiers Gedicht „Lied 76“ aus den 1970er Jahren erzählt von einer Frau, die zwischen patriarchalen Erwartungen und eigener Ohnmacht gefangen ist. Ihr Mann schickt sie mit dem unmöglichen Auftrag aufs Feld, „Stroh zu Gold zu spinnen“ – eine bittere Anspielung auf das Rumpelstilzchen-Märchen. Doch anders als im Märchen gibt es hier…
-

Fünf Teller. / Fünf Hemden. / Fünf Sätze. / Keiner ganz.
1–2 MinutenIlle Chamiers Stil ist schwer zu imitieren – weil er nicht nur Technik, sondern eine Haltung ist. Ihre Sprache wirkt wie gehämmertes Geröll: kantig, verdichtet, mit plötzlichen Bildsprüngen. Ein Gedicht zum Thema „Sorgearbeit und Schreiben“ hätte bei ihr möglicherweise so geklungen: Mögliche Stilmerkmale (rekonstruiert aus ihren Texten): Lakonische Präzision:Nicht:„Die Last der unendlichen Pflichten drückt mich…
-

Ille Chamier – Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…
in Ille Chamier – Am Tag, Erzählung, Ille Chamier – Spurensuche, LektüreNotizen, Weibliche Persepktiven2–3 MinutenDie Erzählung „Am Tag, als ich hinfuhr, zum Treffen schreibender Frauen…“ (erschienen in Courage – Berliner Frauenzeitung, Juli 1979) offenbart scharfe gesellschaftskritische und feministische Positionen: Die Last der unsichtbaren Arbeit Ille Chamier beschreibt minutiös, wie Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt) ihr Schreiben behindert. Bevor sie zum Frauentreffen aufbrechen kann, muss sie ein komplexes Netz aus Versorgungsaufgaben organisieren:…
-

Feministische Lyrik nach 1945 | Eine historische Annäherung
6–9 MinutenIch zeichne hier eine Entwicklung nach: Wie Dichterinnen sich im deutschsprachigen Raum nach 1945 zurückholten, was ihnen zustand – sprachlich, politisch und ästhetisch. Sie beginnt nicht erst mit der Neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre, sondern wurzelt tief in den Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, wo Dichterinnen begannen, neue Formen des Sprechens zu finden. Es ist die Geschichte…
-
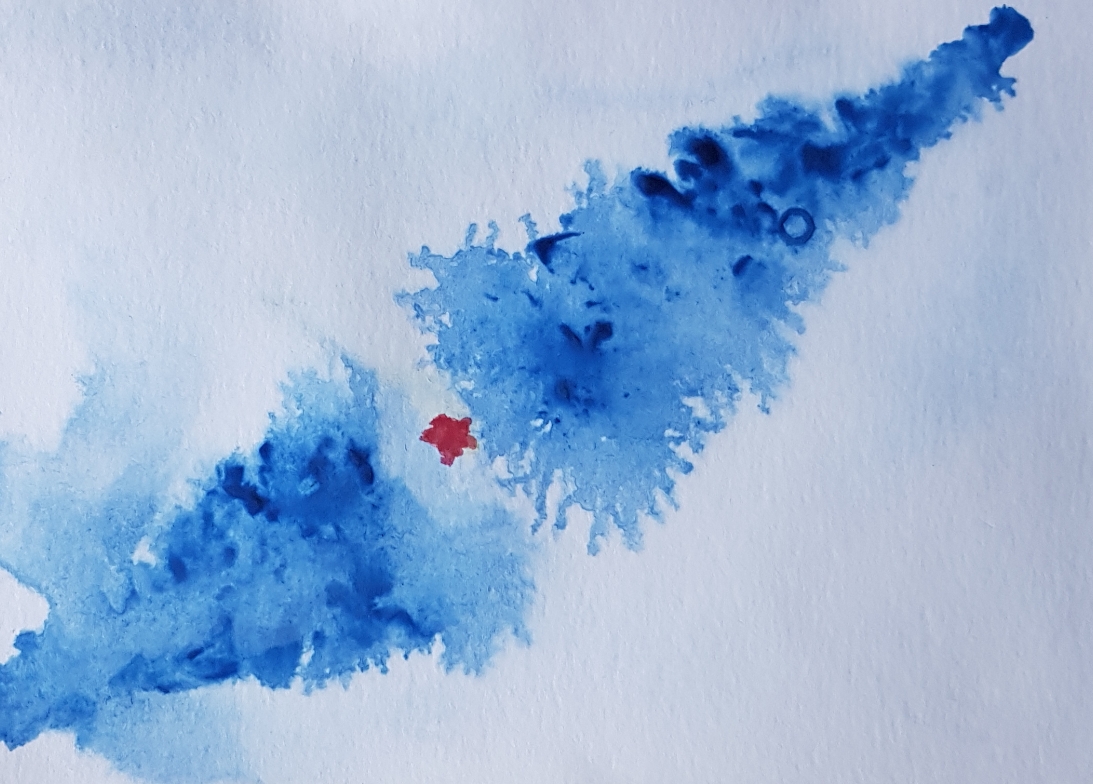
Einzeltäter – Gedicht von Safiye Can
Das Gedicht „Einzeltäter“ nutzt die intensive Wiederholung des Titelmotivs, um eine vielschichtige Deutungsebene zu eröffnen. Hier eine Analyse der zentralen Aspekte: Form und Struktur Wiederholung als Stilmittel: Die ständige Wiederholung von „Einzeltäter“ und Phrasen wie „noch ein“ oder „nur ein“ erzeugt eine rhythmische Monotonie. Dies spiegelt möglicherweise die endlose Wiederkehr des Phänomens oder die gesellschaftliche…
-

Körper als Archiv
2–3 MinutenIn Annette Hagemanns „MEINE ERBSCHAFT IST DIESE“ offenbart sich der Körper als ein vielschichtiges Archiv, in dem die Spuren der Herkunft auf ebenso subtile wie prägnante Weise gespeichert sind. Vordergründig scheinen die Erbschaften des lyrischen Ichs in ihrer Konkretheit begrenzt: die spezifische „Form der Röte auf den Wangen“, ein genetisches Vermächtnis der Mutter, das den…

