Ein merkwürdiges Wort: aufgegeben. Es trägt in sich die ganze Ambivalenz unseres Umgangs mit Literatur, mit Autoren, mit dem, was geschrieben wurde und nun in der Welt ist – oder eben nicht mehr ist, nicht mehr wahrgenommen wird, aus dem Sichtfeld geraten ist.
Frank Witzels Titel legt eine Fährte, die zunächst in die Irre führt: Wer gibt hier eigentlich auf? Der Autor selbst, der die Feder niederlegt? Der Verlag, der nicht mehr druckt? Die Leserschaft, die wegschaut? Oder gibt es eine übergeordnete Instanz – den Literaturbetrieb, die Zeit selbst, das kollektive Gedächtnis –, die einen Autor aufgibt wie man ein Territorium aufgibt, ein Gebäude, einen Posten?
Die doppelte Bewegung des Aufgebens
Im Deutschen öffnet sich hier ein semantischer Abgrund. Aufgeben meint zweierlei: das Verlassen, das Preisgeben – aber auch das Aufgeben einer Sendung, eines Gepäckstücks, das zur Beförderung übergeben wird. Ein Text, der geschrieben ist, wird aufgegeben: an die Welt, an die Zukunft, an unbekannte Leser. Er verlässt die Hand des Autors wie ein Brief ohne Adressat, wie eine Flaschenpost. Darin liegt bereits ein Verzicht, eine ursprüngliche Form des Aufgebens – der Autor gibt seinen Text auf, im Sinne von: her, fort, weg von sich.
Aber was geschieht, wenn niemand dieses Aufgegebene annimmt? Wenn die Sendung nicht zugestellt wird, weil der Empfänger verzogen ist – oder nie existiert hat? Dann kippt die Geste des Übergebens um in die des Preisgebens. Dann wird aus dem produktiven Akt des Loslassens die Verlassenheit, das Aufgegebensein.
Die Wertigkeit als Beziehungsgeschehen
Sie sprechen von Wertigkeit – und das ist der Kern. Denn Literatur entsteht nicht allein im Schreiben, sondern in der Beziehung zwischen Text und Leser, zwischen Autor und Zeit, zwischen Geschriebenem und Erinnern. Ein Text ohne Leser ist wie ein nicht schwingender Resonanzkörper: vorhanden, aber stumm. Seine Wertigkeit konstituiert sich erst im Widerhall.
Diese Wertigkeit ist keine objektive Eigenschaft, kein Goldgehalt, der dem Text innewohnt. Sie ist eine Zuschreibung, eine Geste der Anerkennung, ein Akt des Würdigens. Der Autor schafft die Möglichkeit zur Wertigkeit – durch Sorgfalt, durch Präzision, durch das Ringen um Ausdruck. Aber die Wertigkeit selbst entsteht erst, wenn jemand liest, wenn jemand erkennt, wenn jemand antwortet.
Hier liegt die Verantwortung, von der Sie sprechen: auf beiden Seiten. Der Autor trägt die Verantwortung für die Qualität, für die Ernsthaftigkeit seines Unternehmens. Er kann nicht erzwingen, dass sein Text gelesen wird – aber er kann einen Text schaffen, der des Lesens würdig ist. Der Leser wiederum trägt die Verantwortung des Wahrnehmens, des Suchens, des Würdigens. Nicht jeder Text verdient diese Zuwendung – aber manche Texte verdienen sie, ohne sie je zu erhalten.
Die Ökonomie der Aufmerksamkeit und das Vergessen
In unserer Zeit, in der täglich mehr geschrieben wird als je zuvor in der Geschichte, potenziert sich das Problem. Das Vergessen wird nicht mehr zur Ausnahme, sondern zur Regel. Die meisten Texte werden bereits im Moment ihrer Veröffentlichung aufgegeben – nicht aus Böswilligkeit, sondern aus schierem Mangel an Zeit, an Aufmerksamkeit, an Raum im kollektiven Gedächtnis.
Witzel spricht von hundert Autoren: vergessen, verkannt, verschollen. Hinter jedem dieser Worte steht eine andere Form des Aufgegebenseins. Vergessen ist das sanfte Verschwinden, das allmähliche Verblassen. Verkannt ist die tragischere Variante: Man hat gesehen, aber nicht verstanden, hat gelesen, aber nicht erkannt. Verschollen schließlich meint die vollständige Tilgung aus dem Archiv, die spurlose Auflösung.
Und doch: Wer von diesen Autoren spricht, holt sie bereits zurück. Wer sie auflistet, hebt sie wieder auf – im dreifachen Hegelschen Sinne: bewahren, emporheben, annullieren. Die Liste selbst wird zur Rettungsgeste, zur Rehabilitation, zur Wiederaneignung.
Das Gedächtnis als ethische Praxis
Vielleicht besteht die Würde der Literatur gerade darin, dass sie aufgegeben werden kann – und muss. Dass sie nicht gesichert ist, nicht garantiert, nicht unsterblich. Dass jede Generation neu entscheiden muss, was sie liest, was sie bewahrt, welche Stimmen sie hören will. Diese Ungesichertheit ist keine Schwäche, sondern die Bedingung ihrer Lebendigkeit.
Das Erinnern wird damit zu einer ethischen Praxis. Nicht im Sinne einer moralischen Pflicht, jeden vergessenen Autor zu rehabilitieren – das wäre unmöglich und auch sinnlos. Sondern im Sinne einer Wachsamkeit: zu wissen, dass hinter jedem gegenwärtigen Kanon unzählige aufgegebene Autoren stehen, deren Texte vielleicht gerade heute, gerade für uns, von Bedeutung sein könnten.
Die Wertigkeit eines Essays wie des von Witzel geplanten liegt dann genau darin: Er macht das Aufgegebensein sichtbar. Er erinnert uns daran, dass Literaturgeschichte nicht nur das ist, was überlebt hat, sondern auch das, was verloren ging. Und er lädt uns ein, das Verhältnis von Schreiben und Lesen, von Schaffen und Würdigen, von Verantwortung und Zuwendung neu zu bedenken.
Coda: Die Zukunft des Aufgegebenen
Am Ende bleibt die Frage: Was tun wir mit den aufgegebenen Autoren? Müssen wir sie alle retten? Können wir das überhaupt? Oder geht es vielmehr darum, die Bedingungen zu verstehen, unter denen Texte aufgegeben werden – und unsere eigene Rolle in diesem Prozess zu erkennen?
Vielleicht ist das Aufgegebensein die eigentliche Existenzform von Literatur. Jeder Text, einmal geschrieben, ist der Zeit übergeben, der Nachwelt aufgegeben – ohne Garantie, ohne Sicherheit. In dieser Verletzlichkeit liegt seine Würde. Und in unserem Lesen, unserem Erinnern, unserem Würdigen liegt unsere Antwort darauf.
Die hundert Namen, die Witzel aufruft, sind Stellvertreter für Tausende, für Zehntausende. Sie sind die stillen Begleiter jeder Literaturgeschichte, die Schatten hinter dem Kanon. Ihre Aufgegebenheit zu benennen, heißt nicht, sie zurückzuholen. Es heißt, ihre Abwesenheit zu würdigen – und die Frage nach der Wertigkeit von Literatur überhaupt neu zu stellen.
Jetzt freue ich mich auf die Lektüre von Frank Witzels Beitrag und auf sein Verständnis des Aufgegebenen.
Das Titelfoto: Bild von ddzphoto auf Pixabay
-

Emine Sevgi Özdamar – Ein von Schatten begrenzter Raum
5–8 MinutenAnnähernd gelesen | Was begrenzt einen Raum durch Schatten? Ist es die Abwesenheit von Licht oder gerade seine Anwesenheit, die den Schatten erst wirft? Wo erscheinen räumliche Begrenzungen? Sind es physische Räume (Fabrikhallen, Wohnungen, Gefängniszellen) oder metaphorische (kulturelle Zugehörigkeit, Geschlechterrollen, politische Zuordnungen)? Frage zur Vertiefung: Wie verhält sich der Buchtitel zu den konkreten Räumen im…
-
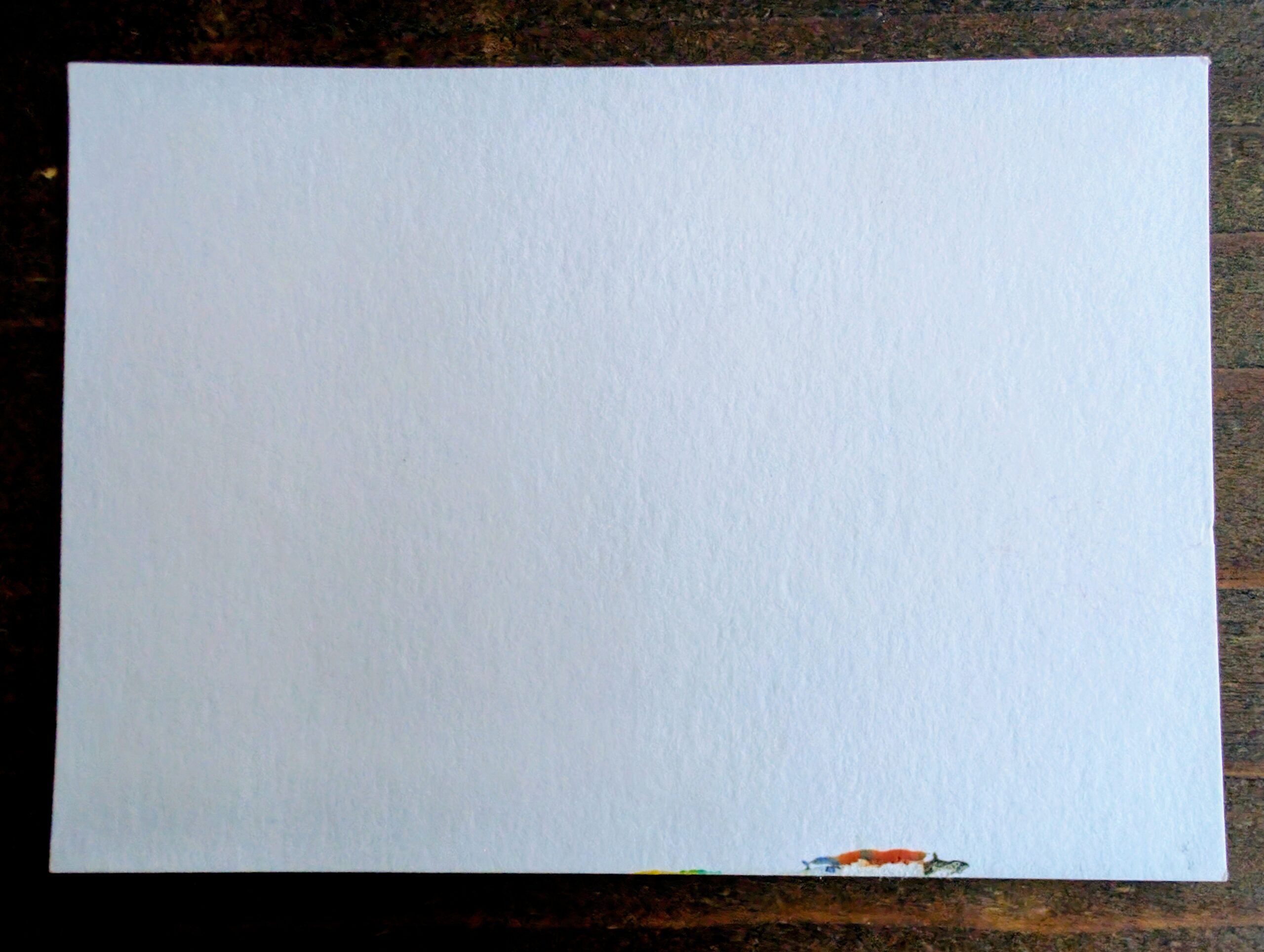
Autobiografie als Spur
Schreiben jenseits der Erinnerung I. Das Problem mit dem Erinnern Wenn Frank Witzel vom Erinnern als „diffuser und unzureichender Prämisse für das Schreiben“ spricht, meint er zunächst das aktive, willentliche Erinnern: Ich setze mich hin, rufe meine Vergangenheit ab, konstruiere aus Fragmenten eine Geschichte. Dieses autobiografische Schreiben ist Arbeit am Material der Erinnerung – Auswahl,…
-

Schreiben im reinen Präsens. Ein Experiment nach Frank Witzel
Frank Witzel beginnt seinen Text über vergessene, verkannte und verschollene Autoren mit einem Eingeständnis: Der Vorgang des Erinnerns, obwohl er sein gesamtes literarisches Schaffen zu durchziehen scheint, erscheint ihm als „diffuse und unzureichende Prämisse für das Schreiben“. Was auf den ersten Blick wie eine Selbstkritik klingt, entpuppt sich als radikale Sehnsucht nach einem anderen Schreiben…
-

Dialog über Hermetik und Zugänglichkeit in der Lyrik
5–7 MinutenEin Nachtrag zur WORTSCHAU Nr. 43 | Mein kritischer Beitrag zur WORTSCHAU Nr. 43 hat auf Facebook eine bemerkenswert konstruktive Diskussion ausgelöst. Dass sich Herausgeber, Autorinnen und Autoren die Zeit genommen haben, auf meine Fragen einzugehen, freut mich sehr – und zeigt, dass die Spannung zwischen Hermetik und Zugänglichkeit keine einseitige Irritation ist, sondern ein…
-

Schreibheft – Ausgabe 100
Schreibheft. Zeitschrift für Literatur ist eine deutschsprachige Literaturzeitschrift, die seit Jahrzehnten erscheint. Sie wird von Norbert Wehr herausgegeben und im Rigodon Verlag in Essen verlegt. Redaktionelles Profil | Die Zeitschrift arbeitet mit längeren Essayformaten und thematischen Schwerpunkten. Jede Ausgabe versammelt sich um einen inhaltlichen Kern. Das redaktionelle Programm umfasst: Die Zeitschrift richtet sich an ein…
-

Frank Witzel – Von aufgegebenen Autoren
4–6 MinutenEin merkwürdiges Wort: aufgegeben. Es trägt in sich die ganze Ambivalenz unseres Umgangs mit Literatur, mit Autoren, mit dem, was geschrieben wurde und nun in der Welt ist – oder eben nicht mehr ist, nicht mehr wahrgenommen wird, aus dem Sichtfeld geraten ist. Frank Witzels Titel legt eine Fährte, die zunächst in die Irre führt:…
-

Annette Hagemann: ARTIST
3–5 MinutenDer Künstler als Versuchsanordnung und Schaustück? Auf den ersten Blick scheint Annette Hagemanns Gedicht ARTIST ein feines, fast ehrfürchtiges Porträt eines schöpferischen Menschen zu sein – eines, der sich einen Raum erbittet, um seine Arbeit zu tun: „Du hattest um den Geheimnisraum gebeten, das Innere des Turms ein leuchtender Lichthof …“ Ein Bild der Sammlung,…
-

Franz Mon – lesebuch
9–13 Minuten„Versuche, dich an alle namen zu erinnern, die je für dich verwendet wurden, denen du irgendwann / einmal ausgesetzt warst, die du dir selbst einmal ausgedacht hast, die du den tatsächlich benutzten / namen vorgezogen hättest; die sich als täuschungen erwiesen haben.“ Mit diesen Zeilen aus seinen „worttaktik[en]“ stellt Franz Mon eine grundlegende Frage: Wer…
-

Jane Wels‘ Sandrine
3–4 MinutenErinnerungen sind selten linear. Sie flackern, tauchen auf, verschwimmen, brechen ab – und genau dieses Flirren liegt im Text über Sandrine. Ein weibliches Ich spricht, nicht in klaren Linien, sondern in Schichten und Sprüngen. „Ihr Atem ist so leise wie ein Hauch Gänsedaunen.“ Zeit scheint stillzustehen, nur um im nächsten Moment „ein Hüpfspiel“ zu werden.…
-

Die Kunst des mündlichen Erzählens
4–6 MinutenAm Anfang war das Wort – nicht geschrieben, sondern gesprochen. Lange bevor Gutenbergs Druckerpresse die Welt veränderte, lebten Geschichten in der Stimme, im Gedächtnis, in der unmittelbaren Begegnung zwischen Erzähler und Zuhörer. Das mündliche Erzählen ist die Urform aller Literatur, der Ausgangspunkt jeder kulturellen Überlieferung. Doch in einer Zeit, in der das gedruckte Wort dominiert…
