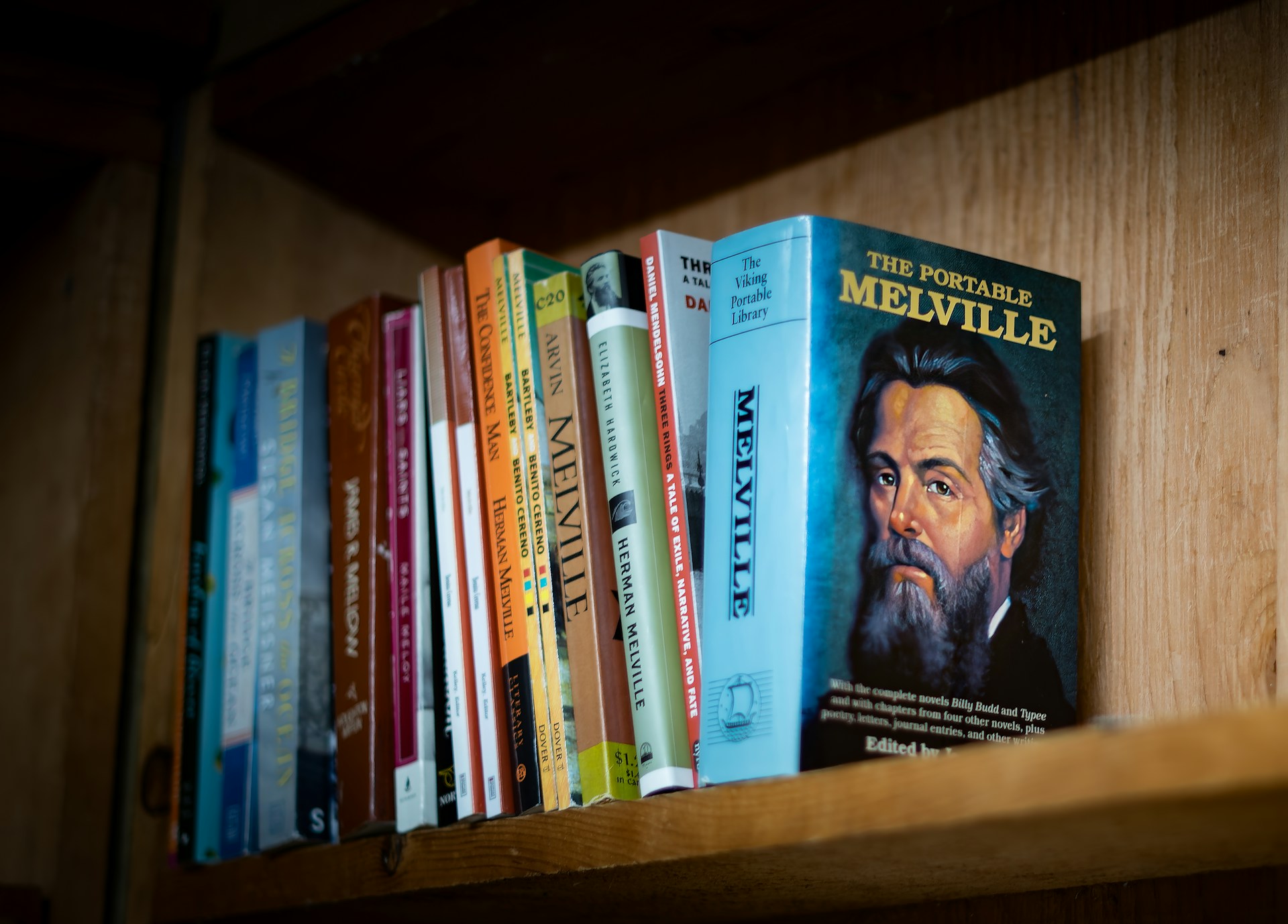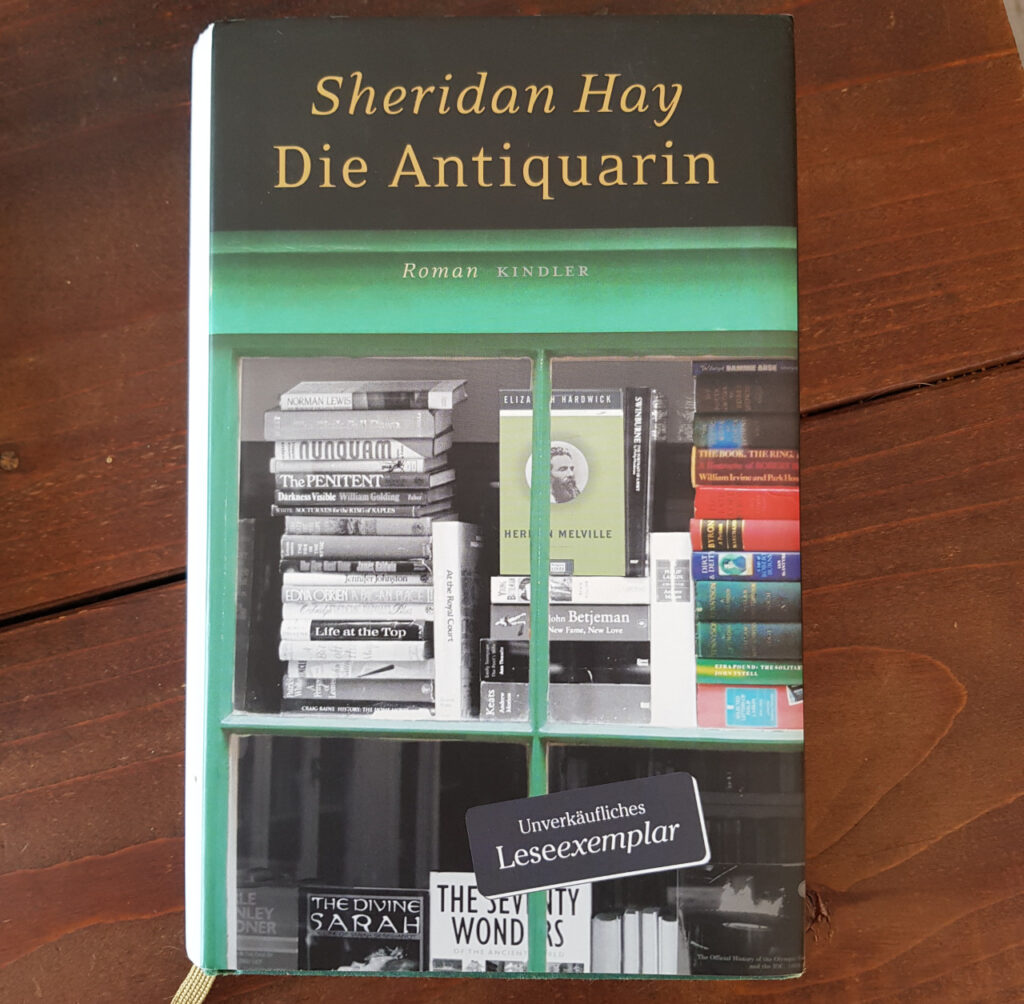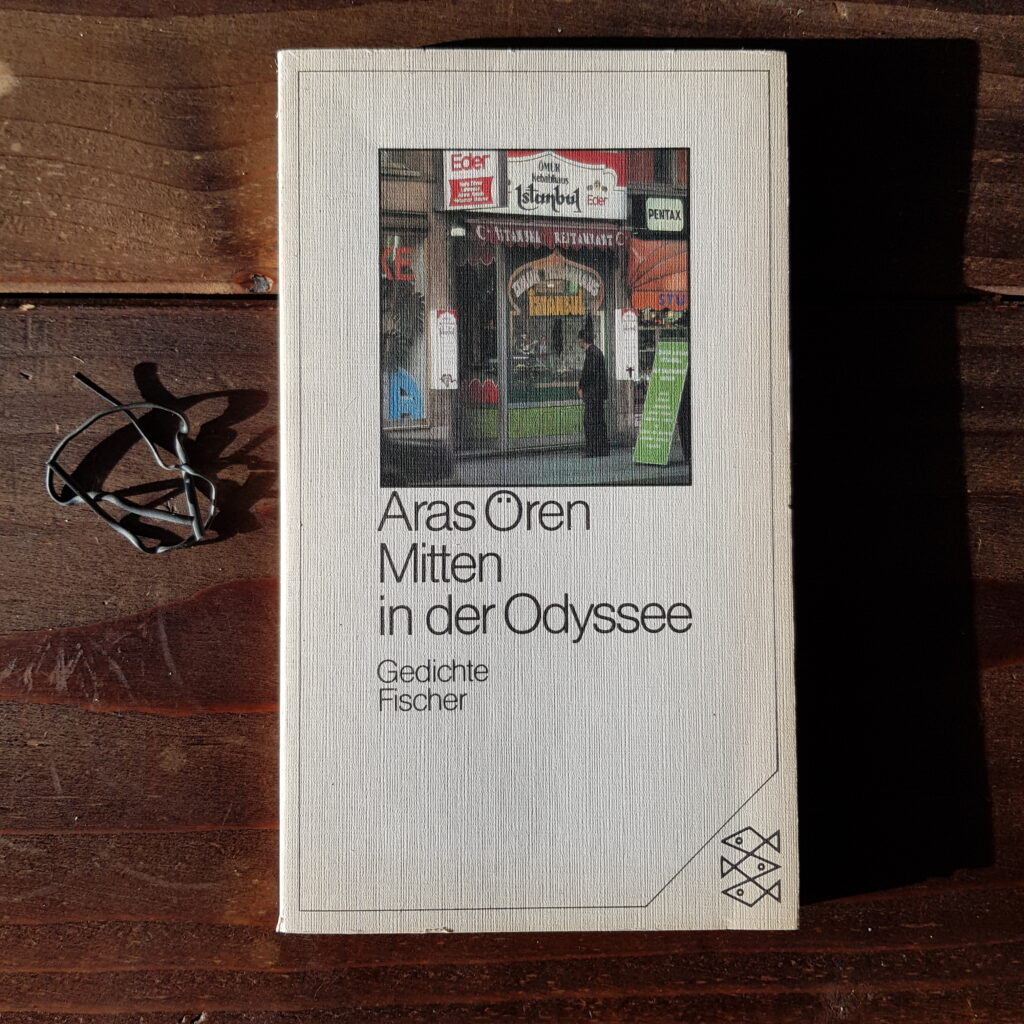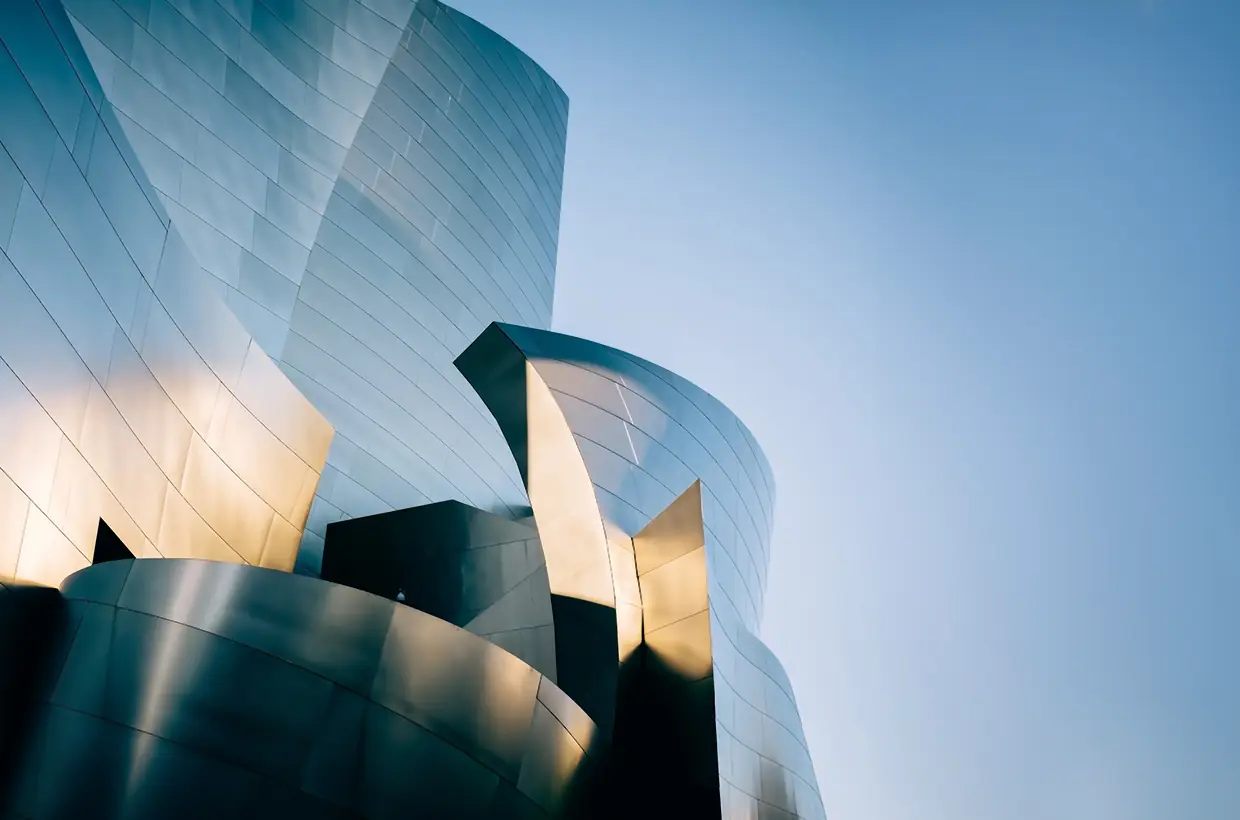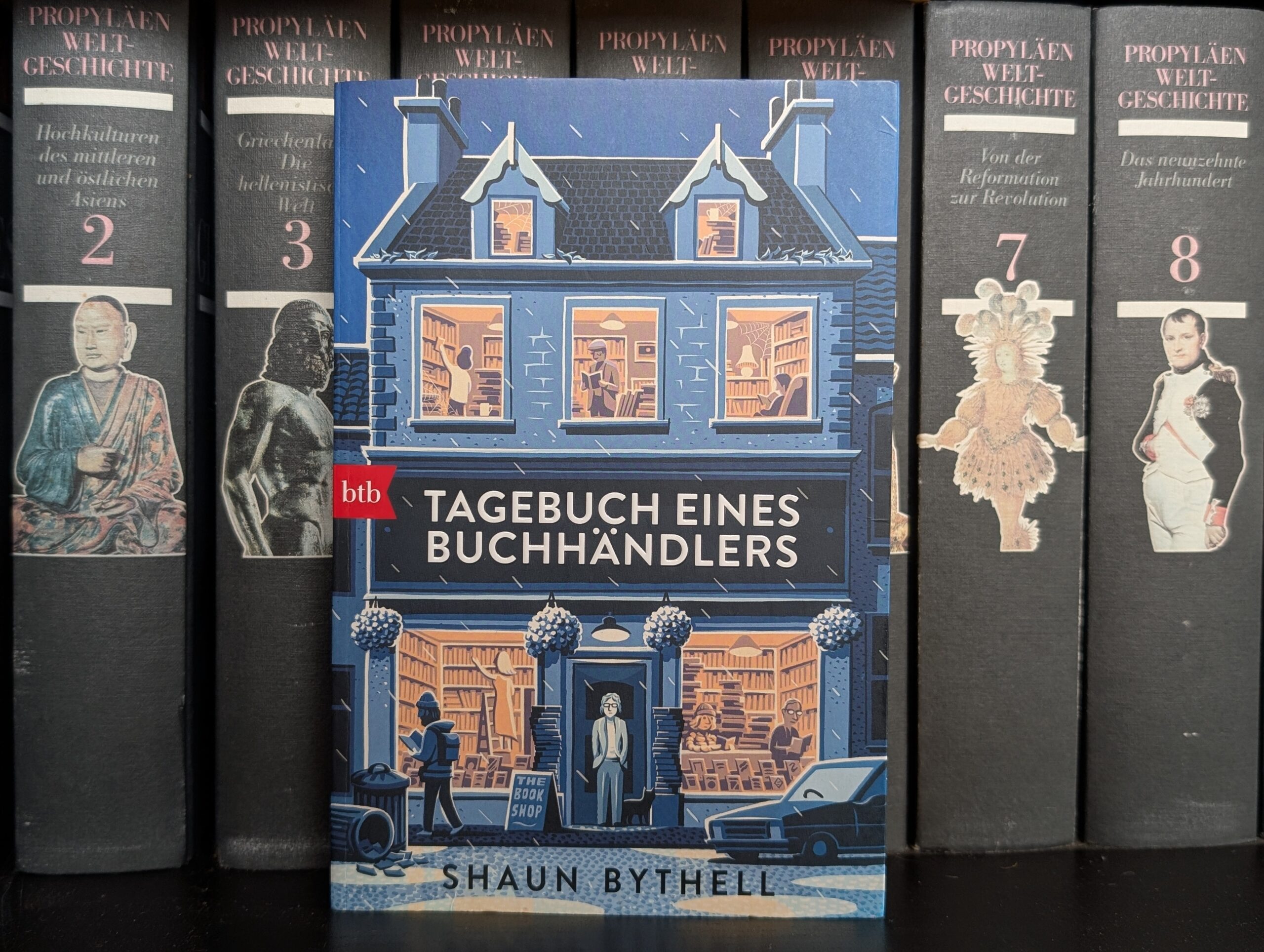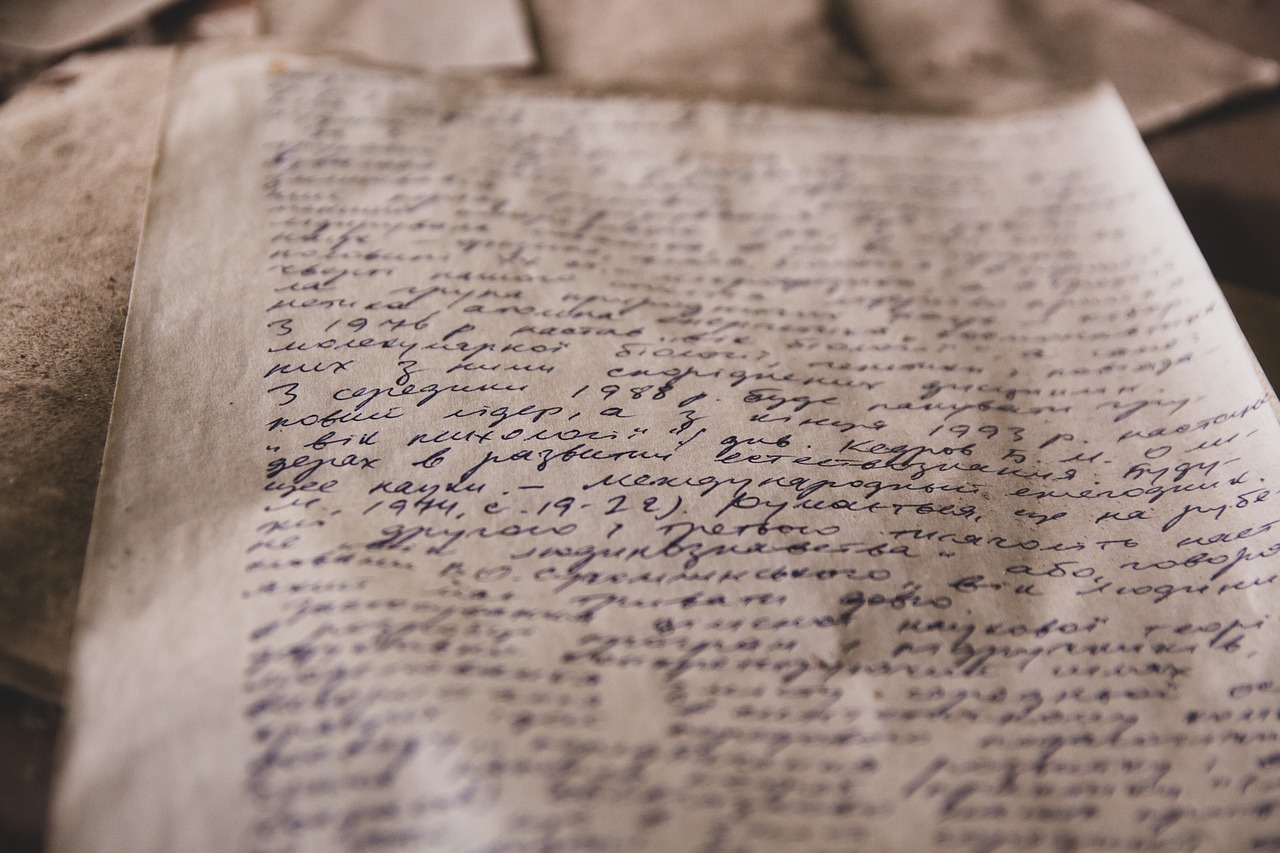Willi Sitte (1921–2013) war einer der bedeutendsten und zugleich umstrittensten Künstler der DDR. Sein Werk umfasst Malerei, Grafik und Zeichnungen, die sich durch expressive Formensprache, politische Aussagen und eine intensive Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper auszeichnen. Sitte war nicht nur ein produktiver Künstler, sondern auch eine zentrale Figur im Kulturleben der DDR, was ihm sowohl Anerkennung als auch Kritik einbrachte.
Er schuf ein Werk, das sich zwischen politischem Pathos, existenzieller Dramatik und ästhetischer Radikalität bewegt. Geboren im böhmischen Kratzau, durchlief er eine handwerkliche Ausbildung, bevor er an der Wiener Akademie der Bildenden Künste studierte. Seine Desertion von der Wehrmacht 1944 und der Beitritt zur italienischen Resistenza wurden zur politischen und moralischen Wegmarke: „Ich sah das Grauen des Krieges und erkannte, dass Kunst nicht neutral sein darf“, reflektierte Sitte später. Nach 1945 ließ er sich in Halle nieder und entwickelte eine expressive Formensprache, die den menschlichen Körper als zentrales Motiv in verzerrten, dynamischen Kompositionen feierte – ein Stil, der Kubismus, Expressionismus und sozialistischen Realismus verschmolz.
Sittes Kunst war stets politisch. Werke wie „Die Erschießung des Ernst Thälmann“ (1961), mit seiner schmerzhaft verdrehten Figur des ermordeten KPD-Führers, oder „Lob des Kommunismus“ (1973), eine Hommage an die Arbeiterklasse in heroischen Posen, standen im Dienst des DDR-Staates. Doch auch abseits offizieller Auftragskunst drang er in existenzielle Abgründe: In „Die große Nacht im Eimer“ (1983) verdichten sich düstere, fast apokalyptische Szenen zu einer Allegorie menschlicher Verlorenheit. Sein „Tanz mit Fahnen“ (1976) wiederum inszeniert revolutionäre Euphorie durch wirbelnde Körper, die Fahnen wie Waffen schwingen – ein Sinnbild kollektiver Kraft. Später wandte er sich auch globalen Konflikten zu, etwa im „Zyklus zum Vietnamkrieg“ (1970er Jahre), der die Brutalität des Krieges in grellen Farben und fragmentierten Körpern entlarvte.
Neben Malerei prägten Kooperationen mit Schriftstellern und Theatermachern sein Schaffen. Mit dem Dramatiker Volker Braun, einem wichtigen Vertreter der DDR-Literatur, verband ihn eine produktive, wenn auch ambivalente Zusammenarbeit. Für Brauns Stück „Die Übergangsgesellschaft“ (1988), das den Niedergang des Sozialismus reflektierte, entwarf Sitte Bühnenbilder, die mit düsteren Farben und gebrochenen Formen die gesellschaftliche Desillusionierung visualisierten. Braun würdigte Sitte als „Maler der Widersprüche, der selbst im Staatsauftrag nie die kritische Schärfe verlor“. Auch mit dem Lyriker Stefan Hermlin arbeitete Sitte zusammen, etwa an Illustrationen für politische Gedichtbände, in denen seine grafischen Werke Hermlins Texte über Krieg und Widerstand visuell verstärkten.
Trotz staatlicher Anerkennung – als Präsident des Verbands Bildender Künstler der DDR (1974–1988) prägte er die Kulturpolitik maßgeblich – blieb Sitte umstritten. Der westdeutsche Kunstkritiker Eduard Beaucamp urteilte: „Seine Bilder sind sperrig, voller erotischer und politischer Energie, aber sie entziehen sich jeder Vereinnahmung.“ In der DDR hielten ihm manche vor, seine Kunst sei „zu formalistisch“ oder „zu wenig volksnah“, während Dissidenten ihm Nähe zum Regime kritisierten. Sitte selbst sah sich stets als „Parteikünstler im besten Sinne“: „Der Künstler hat die Pflicht, sich einzumischen. Kunst ist kein Selbstzweck, sondern ein Hammer, der die Welt formt“, betonte er.
Nach 1989 stürzte Sitte in eine tiefe Krise. Ausstellungen wurden abgesagt, Werke aus Museen entfernt. Erst ab den 2000er-Jahren erfolgte eine Neubewertung: Retrospektiven wie 2011 im Kunstmuseum Moritzburg Halle zeigten, wie Sitte auch im Staatsdienst künstlerische Autonomie bewahrte. Arbeiten wie „Die Ausgebeuteten“ (1964), eine drastische Darstellung ausgezehrter Bergarbeiter, oder das späte „Selbstbildnis mit Palette“ (2005), in dem er sich als greisen, aber unbeugsamen Maler porträtierte, belegen seine kompromisslose Haltung. Sogar frühe Kriegszeichnungen, die er als Deserteur anfertigte, wurden neu entdeckt – als Dokumente eines Mannes, der stets zwischen Anpassung und Aufbegehren balancierte.
Willi Sittes Erbe bleibt ambivalent: Einerseits der „Staatskünstler“, der das DDR-System stützte, andererseits der scharfäugige Chronist von Macht, Gewalt und menschlicher Fragilität. Wie kaum ein anderer verkörpert er die Widersprüche der Kunst im Sozialismus – und die Unmöglichkeit, sie auf politische Botschaften zu reduzieren. Sein Werk, so der Kulturhistoriker Paul Kaiser, „ist ein Schlüssel, um die DDR zu verstehen: voller Brüche, voller Leidenschaft, voller unbequemer Wahrheiten“.
Das Interview mit Günter Gaus im Rahmen der Sendung „Zur Person“
Im Interview mit Günter Gaus in der Sendung „Zur Person“ vom 14. September 1996 reflektierte der Maler Willi Sitte ausführlich über sein Leben, seine künstlerische Entwicklung und seine politischen Überzeugungen. Sitte, geboren 1921 in Nordböhmen, sprach über seine frühen Erfahrungen, darunter seine Desertion von der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs und seine anschließende Zusammenarbeit mit italienischen Partisanen. Nach dem Krieg blieb er zunächst in Italien, kehrte jedoch 1946 in die Tschechoslowakei zurück und siedelte später in die sowjetische Besatzungszone über.
Sitte betonte seine Identität als politischer Maler und zog Parallelen zu Künstlern wie Delacroix und Courbet. Er diskutierte die Herausforderungen und Kritiken, denen er in der DDR ausgesetzt war, insbesondere die Vorwürfe des Formalismus in den 1950er Jahren. Trotz dieser Konflikte blieb er der SED treu und übernahm von 1974 bis 1989 das Amt des Präsidenten des Verbandes Bildender Künstler der DDR.
Im Gespräch mit Gaus äußerte Sitte auch seine Enttäuschung über die Entwicklungen nach der Wende 1989. Er kritisierte die seiner Meinung nach unsachliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten einiger seiner ehemaligen Kollegen, die nach der Wende ihre Haltung änderten. Trotz dieser Bitterkeit betonte Sitte, dass er kein Opportunist gewesen sei und stets mit Überzeugung gehandelt habe. Link zu Sendung: https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/sitte_willi.html